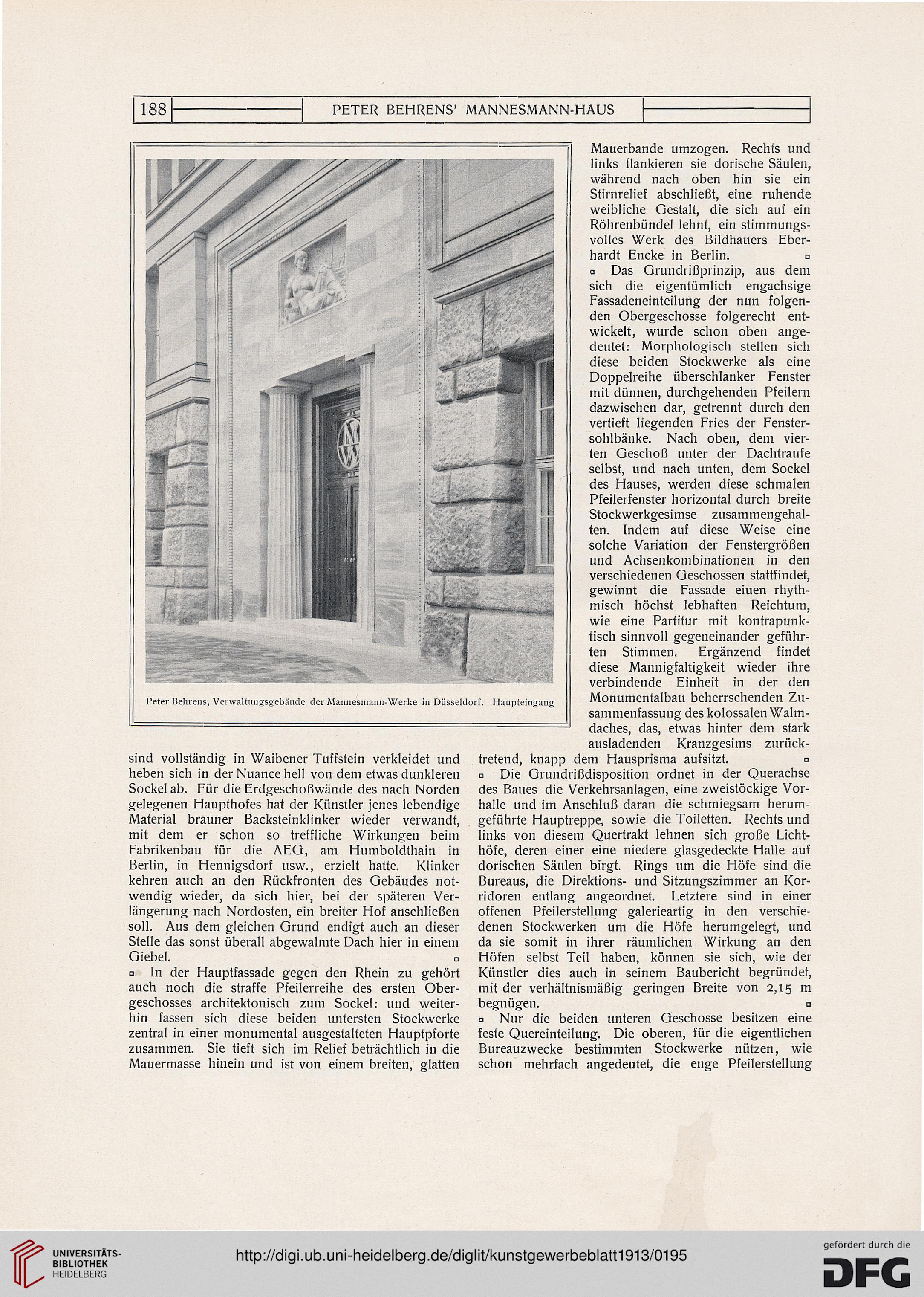PETER BEHRENS’ MANNESMANN-HAUS
1 OÖ
100
sind vollständig in Waibener Tuffstein verkleidet und
heben sich in der Nuance hell von dem etwas dunkleren
Sockel ab. Für die Erdgeschoßwände des nach Norden
gelegenen Haupthofes hat der Künstler jenes lebendige
Material brauner Backsteinklinker wieder verwandt,
mit dem er schon so treffliche Wirkungen beim
Fabrikenbau für die AEG, am Humboldthain in
Berlin, in Hennigsdorf usw., erzielt hatte. Klinker
kehren auch an den Rückfronten des Gebäudes not-
wendig wieder, da sich hier, bei der späteren Ver-
längerung nach Nordosten, ein breiter Hof anschließen
soll. Aus dem gleichen Grund endigt auch an dieser
Stelle das sonst überall abgewalmte Dach hier in einem
Giebel. □
q In der Hauptfassade gegen den Rhein zu gehört
auch noch die straffe Pfeilerreihe des ersten Ober-
geschosses architektonisch zum Sockel: und weiter-
hin fassen sich diese beiden untersten Stockwerke
zentral in einer monumental ausgestalteten Hauptpforte
zusammen. Sie tieft sich im Relief beträchtlich in die
Mauermasse hinein und ist von einem breiten, glatten
Mauerbande umzogen. Rechts und
links flankieren sie dorische Säulen,
während nach oben hin sie ein
Stirnrelief abschließt, eine ruhende
weibliche Gestalt, die sich auf ein
Röhrenbündel lehnt, ein stimmungs-
volles Werk des Bildhauers Eber-
hardt Encke in Berlin. □
o Das Grundrißprinzip, aus dem
sich die eigentümlich engachsige
Fassadeneinteilung der nun folgen-
den Obergeschosse folgerecht ent-
wickelt, wurde schon oben ange-
deutet: Morphologisch stellen sich
diese beiden Stockwerke als eine
Doppelreihe überschlanker Fenster
mit dünnen, durchgehenden Pfeilern
dazwischen dar, getrennt durch den
vertieft liegenden Fries der Fenster-
sohlbänke. Nach oben, dem vier-
ten Geschoß unter der Dachtraufe
selbst, und nach unten, dem Sockel
des Hauses, werden diese schmalen
Pfeilerfenster horizontal durch breite
Stockwerkgesimse zusammengehal-
ten. Indem auf diese Weise eine
solche Variation der Fenstergrößen
und Achsenkombinationen in den
verschiedenen Geschossen stattfindet,
gewinnt die Fassade eiuen rhyth-
misch höchst lebhaften Reichtum,
wie eine Partitur mit kontrapunk-
tisch sinnvoll gegeneinander geführ-
ten Stimmen. Ergänzend findet
diese Mannigfaltigkeit wieder ihre
verbindende Einheit in der den
Monumentalbau beherrschenden Zu-
sammenfassung des kolossalen Walm-
daches, das, etwas hinter dem stark
ausladenden Kranzgesims zurück-
tretend, knapp dem Hausprisma aufsitzt. °
□ Die Grundrißdisposition ordnet in der Querachse
des Baues die Verkehrsanlagen, eine zweistöckige Vor-
halle und im Anschluß daran die schmiegsam herum-
geführte Hauptreppe, sowie die Toiletten. Rechtsund
links von diesem Quertrakt lehnen sich große Licht-
höfe, deren einer eine niedere glasgedeckte Halle auf
dorischen Säulen birgt. Rings um die Höfe sind die
Bureaus, die Direktions- und Sitzungszimmer an Kor-
ridoren entlang angeordnet. Letztere sind in einer
offenen Pfeilerstellung galerieartig in den verschie-
denen Stockwerken um die Höfe herumgelegt, und
da sie somit in ihrer räumlichen Wirkung an den
Höfen selbst Teil haben, können sie sich, wie der
Künstler dies auch in seinem Baubericht begründet,
mit der verhältnismäßig geringen Breite von 2,15 m
begnügen. □
□ Nur die beiden unteren Geschosse besitzen eine
feste Quereinteilung. Die oberen, für die eigentlichen
Bureauzwecke bestimmten Stockwerke nützen, wie
schon mehrfach angedeutet, die enge Pfeilerstellung
1 OÖ
100
sind vollständig in Waibener Tuffstein verkleidet und
heben sich in der Nuance hell von dem etwas dunkleren
Sockel ab. Für die Erdgeschoßwände des nach Norden
gelegenen Haupthofes hat der Künstler jenes lebendige
Material brauner Backsteinklinker wieder verwandt,
mit dem er schon so treffliche Wirkungen beim
Fabrikenbau für die AEG, am Humboldthain in
Berlin, in Hennigsdorf usw., erzielt hatte. Klinker
kehren auch an den Rückfronten des Gebäudes not-
wendig wieder, da sich hier, bei der späteren Ver-
längerung nach Nordosten, ein breiter Hof anschließen
soll. Aus dem gleichen Grund endigt auch an dieser
Stelle das sonst überall abgewalmte Dach hier in einem
Giebel. □
q In der Hauptfassade gegen den Rhein zu gehört
auch noch die straffe Pfeilerreihe des ersten Ober-
geschosses architektonisch zum Sockel: und weiter-
hin fassen sich diese beiden untersten Stockwerke
zentral in einer monumental ausgestalteten Hauptpforte
zusammen. Sie tieft sich im Relief beträchtlich in die
Mauermasse hinein und ist von einem breiten, glatten
Mauerbande umzogen. Rechts und
links flankieren sie dorische Säulen,
während nach oben hin sie ein
Stirnrelief abschließt, eine ruhende
weibliche Gestalt, die sich auf ein
Röhrenbündel lehnt, ein stimmungs-
volles Werk des Bildhauers Eber-
hardt Encke in Berlin. □
o Das Grundrißprinzip, aus dem
sich die eigentümlich engachsige
Fassadeneinteilung der nun folgen-
den Obergeschosse folgerecht ent-
wickelt, wurde schon oben ange-
deutet: Morphologisch stellen sich
diese beiden Stockwerke als eine
Doppelreihe überschlanker Fenster
mit dünnen, durchgehenden Pfeilern
dazwischen dar, getrennt durch den
vertieft liegenden Fries der Fenster-
sohlbänke. Nach oben, dem vier-
ten Geschoß unter der Dachtraufe
selbst, und nach unten, dem Sockel
des Hauses, werden diese schmalen
Pfeilerfenster horizontal durch breite
Stockwerkgesimse zusammengehal-
ten. Indem auf diese Weise eine
solche Variation der Fenstergrößen
und Achsenkombinationen in den
verschiedenen Geschossen stattfindet,
gewinnt die Fassade eiuen rhyth-
misch höchst lebhaften Reichtum,
wie eine Partitur mit kontrapunk-
tisch sinnvoll gegeneinander geführ-
ten Stimmen. Ergänzend findet
diese Mannigfaltigkeit wieder ihre
verbindende Einheit in der den
Monumentalbau beherrschenden Zu-
sammenfassung des kolossalen Walm-
daches, das, etwas hinter dem stark
ausladenden Kranzgesims zurück-
tretend, knapp dem Hausprisma aufsitzt. °
□ Die Grundrißdisposition ordnet in der Querachse
des Baues die Verkehrsanlagen, eine zweistöckige Vor-
halle und im Anschluß daran die schmiegsam herum-
geführte Hauptreppe, sowie die Toiletten. Rechtsund
links von diesem Quertrakt lehnen sich große Licht-
höfe, deren einer eine niedere glasgedeckte Halle auf
dorischen Säulen birgt. Rings um die Höfe sind die
Bureaus, die Direktions- und Sitzungszimmer an Kor-
ridoren entlang angeordnet. Letztere sind in einer
offenen Pfeilerstellung galerieartig in den verschie-
denen Stockwerken um die Höfe herumgelegt, und
da sie somit in ihrer räumlichen Wirkung an den
Höfen selbst Teil haben, können sie sich, wie der
Künstler dies auch in seinem Baubericht begründet,
mit der verhältnismäßig geringen Breite von 2,15 m
begnügen. □
□ Nur die beiden unteren Geschosse besitzen eine
feste Quereinteilung. Die oberen, für die eigentlichen
Bureauzwecke bestimmten Stockwerke nützen, wie
schon mehrfach angedeutet, die enge Pfeilerstellung