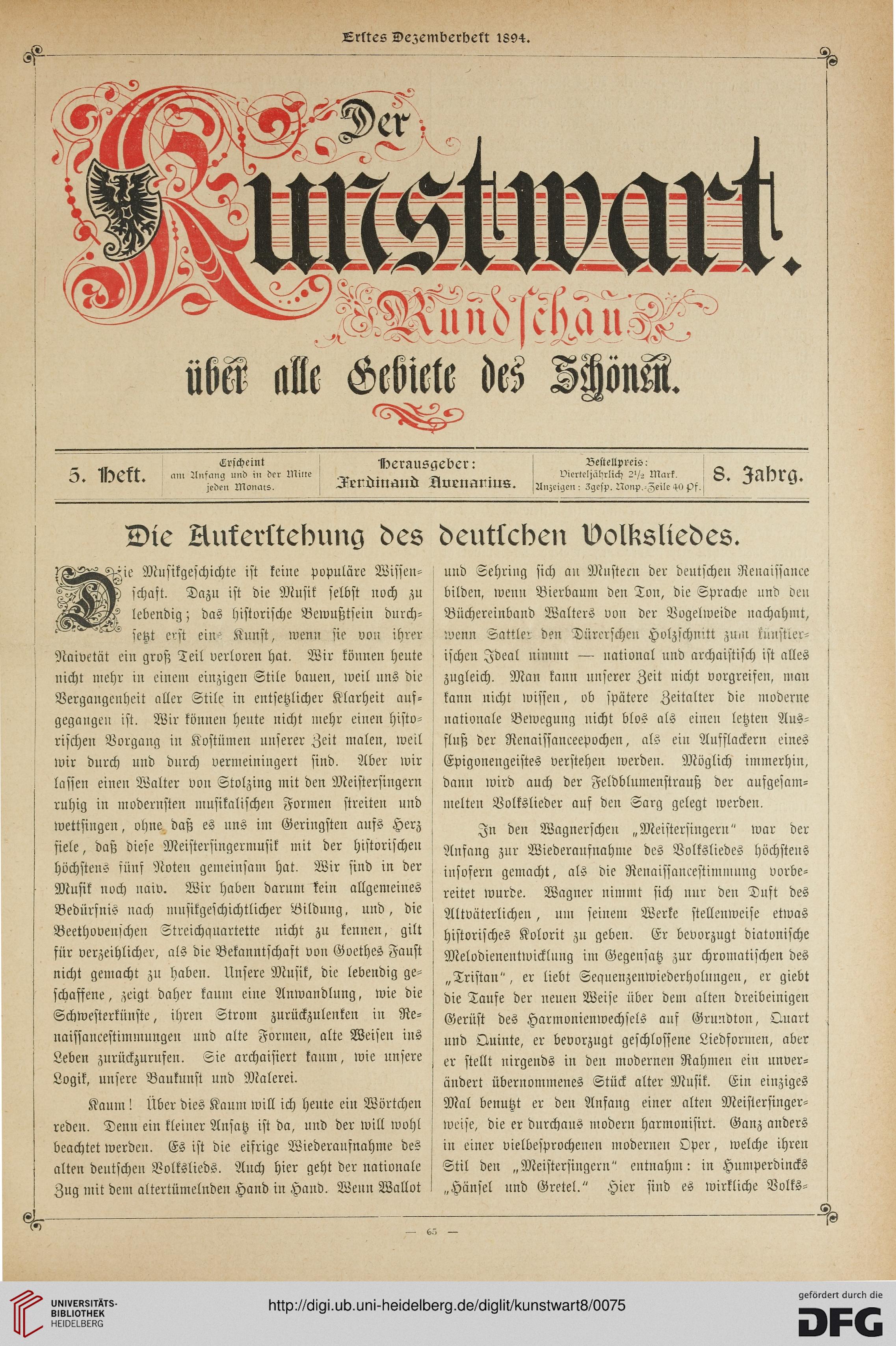5. Delt.
Lrscheint^
Derausgeber:
Ferrüinünü Zvensmus.
Bettellpreis:
^ vierteljährlich tNark.
S. Zabrg.
Die Aukerltebung des deutlcbeu Volksliedes.
ie Musikgeschichte ist keiue pvpuläre Wissen-
schaft. Dazu ist die Musik selbst uoch zu
lebendig; das lststorische Bewußtseiu durch-
setzt erst ein' Kuust, wenu sie vou ihrer
Naivetät ein groß Teil verloren hat. Wir köunen heute
uicht mehr in einem einzigen Stile bauen, weil nns die
Vergangenheit aller Stile in entsetzlicher Klarheit anf-
gegaugeu ist. Wir könneu heute nicht mehr einen histo-
rischen Vorgang in Kostümen unserer Zeit malen, weil
wir durch und durch vermeiningert sind. Aber wir
lasseu einen Walter von Stolzing mit den Meistersingern
ruhig in modernsten musikalischen Formen streiten und
wettsingen, ohne daß es uns im Geringsten anfs Herz
fiele, daß diese Meisterfingermufik mit der historischen
höchstens iünf Noten gemeinfam hat. Wir sind in der
Musik noch naiv. Wir haben darum kein allgemeines
Bedürfnis nach musikgeschichtlicher Bildung, und, die
Beethovenschen Streichqnartette nicht zu kennen, gilt
für verzeihlicher, als die Bekanntfchaft von Goethes Fauft
nicht gemacht zu haben. Nnsere Musik, die lebendig ge-
fchaffene, zeigt daher kaum eiue Anwandlung, wie die
Schwesterkünste, ihren Strom zurückzulenken in Re-
naiffancestimmungen und alte Formen, alte Weisen ins
Leben zurückzurufen. Sie archaisiert kaum, wie unsere
Logik, unsere Baukunst und Malerei.
Kaum! Nber dies Kaum will ich heute ein Wörtchen
reden. Denn ein kleiner Ansatz ist da, und der will wohl
beachtet werden. Es ist die eifrige Wiederaufnahme des
alten deutschen Volkslieds. Auch hier geht der nationale
Zug mit dem altertümelnden Hand in Hand. Wenn Wallot !
und Sehriug sich an Mustern der deutschen Reuaissanee
bilden, wenn Bierbaum den Ton, die Sprache und deu
Büchereinband Walters von der Vvgelweide nachahmt,
wenn Sattler den Dürerschen Holzschmtt zu.u kunstler-
ischen Jdeal nimmt — national und archaistisch ist alles '
zugleich. Man kann unserer Zeit nicht vorgreifen, man
kann nicht wisfen, ob spätere Zeitalter die moderne
nationale Bewegung nicht blos als einen letzten Aus-
fluß der Renaisfaneeepochen, als ein Aufflackern eines ^
Epigonengeistes verstehen werdeu. Möglich immerhin,
dann wird auch der Feldblumenstrauß der aufgesam-
melten Volkslieder auf den Sarg gelegt werden.
Jn den Wagnerschen „Meistersingern" war der
Anfang zur Wiederanfnahme des Volksliedes höchstens
iusofern gemacht, als die Renaisfaneestimmung vorbe-
reitet wurde. Wagner nimmt sich nur den Duft des
Altväterlichen, um seinem Werke stellenweise etwas
historisches Kolorit zu geben. Er bevorzugt diatonische
Melodienentwicklung im Gegensatz zur chromatischen des
„Tristan", er liebt Sequenzenwiederholungen, er giebt
die Tause der neuen Weise über dem alten dreibeinigen
Gerüst des Harmonienwechsels auf Grundton, Quart
und Quinte, er bevorzugt geschlosfene Liedsormen, aber
er stellt nirgends in den modernen Rahmen ein unver-
ändert übernommenes Stück alter Musik. Ein einziges
Mal benutzt er den Anfang einer alten Meisterfinger-
weise, die er durchaus modern harmonisirt. Ganz anders
in einer vielbesprocheuen modernen Oper, welche ihren
Stil den „Meistersingern" entnahm: in Humperdincks
„Hänsel und Gretel." Hier sind es wirkliche Volks-
Lrscheint^
Derausgeber:
Ferrüinünü Zvensmus.
Bettellpreis:
^ vierteljährlich tNark.
S. Zabrg.
Die Aukerltebung des deutlcbeu Volksliedes.
ie Musikgeschichte ist keiue pvpuläre Wissen-
schaft. Dazu ist die Musik selbst uoch zu
lebendig; das lststorische Bewußtseiu durch-
setzt erst ein' Kuust, wenu sie vou ihrer
Naivetät ein groß Teil verloren hat. Wir köunen heute
uicht mehr in einem einzigen Stile bauen, weil nns die
Vergangenheit aller Stile in entsetzlicher Klarheit anf-
gegaugeu ist. Wir könneu heute nicht mehr einen histo-
rischen Vorgang in Kostümen unserer Zeit malen, weil
wir durch und durch vermeiningert sind. Aber wir
lasseu einen Walter von Stolzing mit den Meistersingern
ruhig in modernsten musikalischen Formen streiten und
wettsingen, ohne daß es uns im Geringsten anfs Herz
fiele, daß diese Meisterfingermufik mit der historischen
höchstens iünf Noten gemeinfam hat. Wir sind in der
Musik noch naiv. Wir haben darum kein allgemeines
Bedürfnis nach musikgeschichtlicher Bildung, und, die
Beethovenschen Streichqnartette nicht zu kennen, gilt
für verzeihlicher, als die Bekanntfchaft von Goethes Fauft
nicht gemacht zu haben. Nnsere Musik, die lebendig ge-
fchaffene, zeigt daher kaum eiue Anwandlung, wie die
Schwesterkünste, ihren Strom zurückzulenken in Re-
naiffancestimmungen und alte Formen, alte Weisen ins
Leben zurückzurufen. Sie archaisiert kaum, wie unsere
Logik, unsere Baukunst und Malerei.
Kaum! Nber dies Kaum will ich heute ein Wörtchen
reden. Denn ein kleiner Ansatz ist da, und der will wohl
beachtet werden. Es ist die eifrige Wiederaufnahme des
alten deutschen Volkslieds. Auch hier geht der nationale
Zug mit dem altertümelnden Hand in Hand. Wenn Wallot !
und Sehriug sich an Mustern der deutschen Reuaissanee
bilden, wenn Bierbaum den Ton, die Sprache und deu
Büchereinband Walters von der Vvgelweide nachahmt,
wenn Sattler den Dürerschen Holzschmtt zu.u kunstler-
ischen Jdeal nimmt — national und archaistisch ist alles '
zugleich. Man kann unserer Zeit nicht vorgreifen, man
kann nicht wisfen, ob spätere Zeitalter die moderne
nationale Bewegung nicht blos als einen letzten Aus-
fluß der Renaisfaneeepochen, als ein Aufflackern eines ^
Epigonengeistes verstehen werdeu. Möglich immerhin,
dann wird auch der Feldblumenstrauß der aufgesam-
melten Volkslieder auf den Sarg gelegt werden.
Jn den Wagnerschen „Meistersingern" war der
Anfang zur Wiederanfnahme des Volksliedes höchstens
iusofern gemacht, als die Renaisfaneestimmung vorbe-
reitet wurde. Wagner nimmt sich nur den Duft des
Altväterlichen, um seinem Werke stellenweise etwas
historisches Kolorit zu geben. Er bevorzugt diatonische
Melodienentwicklung im Gegensatz zur chromatischen des
„Tristan", er liebt Sequenzenwiederholungen, er giebt
die Tause der neuen Weise über dem alten dreibeinigen
Gerüst des Harmonienwechsels auf Grundton, Quart
und Quinte, er bevorzugt geschlosfene Liedsormen, aber
er stellt nirgends in den modernen Rahmen ein unver-
ändert übernommenes Stück alter Musik. Ein einziges
Mal benutzt er den Anfang einer alten Meisterfinger-
weise, die er durchaus modern harmonisirt. Ganz anders
in einer vielbesprocheuen modernen Oper, welche ihren
Stil den „Meistersingern" entnahm: in Humperdincks
„Hänsel und Gretel." Hier sind es wirkliche Volks-