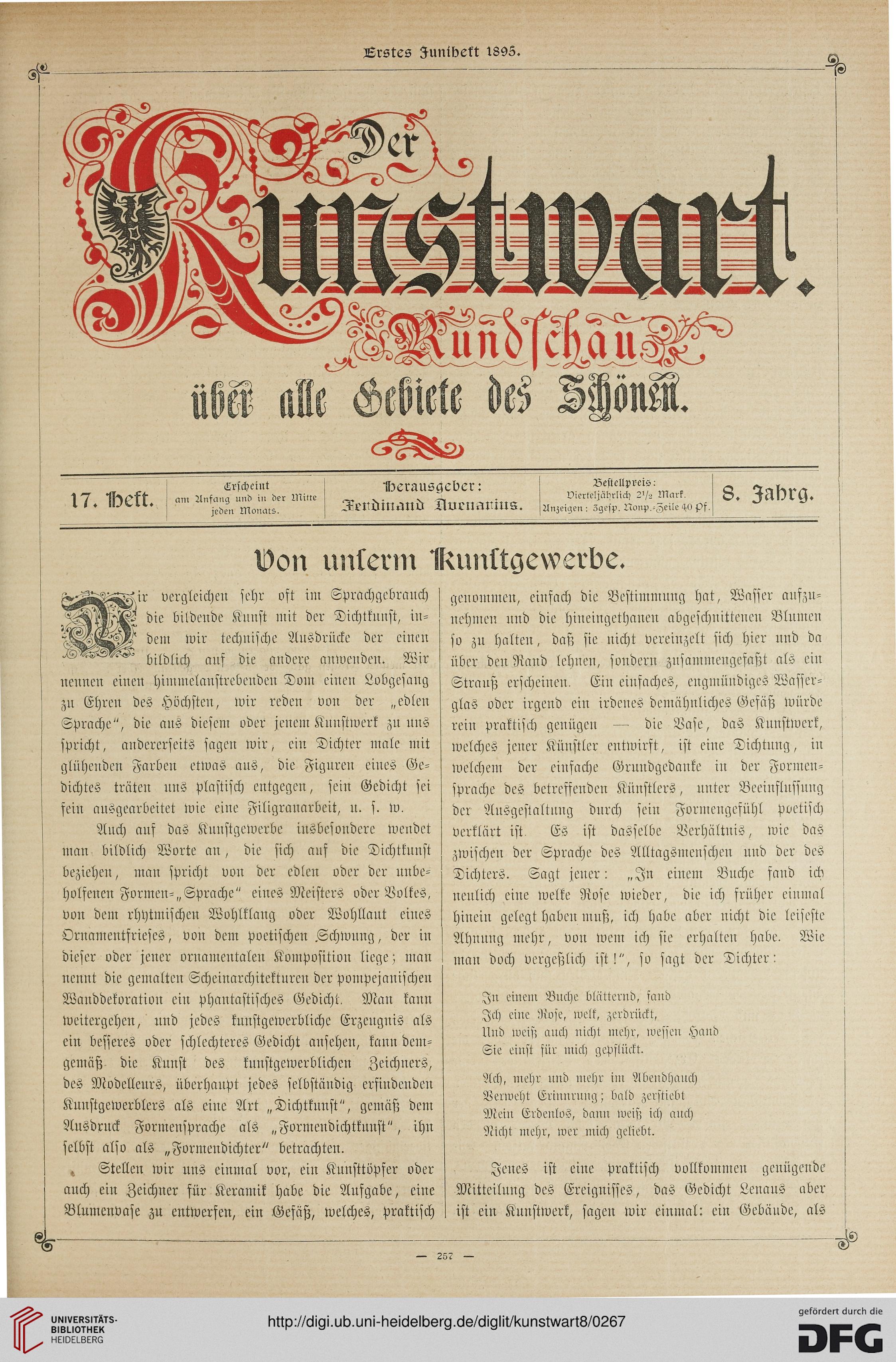Lrstes Aunibett 1895.
17. Dekt.
Lrscheint^
Derausgeber:
Muüinanü Ilnrnnmns.
Bestellpreis:
Vierteljährlich 2^/s Ulcirk.
8. Z.rkrg.
lDon uuterm Ikuuttgevverbe.
'.ir vergleichen sehr vft im Sprachgebrauch
die bildende Knnst init der Dichtknnst, in-
dem wir technische Ansdrücke der einen
bildlich anf die andere anwcnden. Wir
nennen einen hiinmelanstrebenden Doin einen Lobgesang
zu Ehren des Höchsten, wir reden von der „edlen
Sprache", die aus diesem oder jenem Knnstwerk zn nns
spricht, andererseits sagen wir, ein Dichter male mit
glühenden Farben etwas ans, die Fignren eines Ge-
dichtes träten uns Plastisch entgegen, sein Gedicht sei
fein ausgearbeitet wie eine Filigranarbeit, u. s. w.
Anch anf das Knnstgewerbe insbesondere wendet
man bildlich Worte an, die sich auf die Dichtknnst
beziehen, man spricht von dcr edlen oder der unbe-
holfenen Formen-„Sprache" eines Meisters oder Volkes,
von dem rhytmischen Wohlklang oder Wohllant eines
Ornamentfrieses, von dem poetischen.Schwung, der in
dieser oder jener ornamentalen Komposition liege; man
nennt die gemalten Scheinarchitekturen der pompejanischen
Wanddekoration ein Phantastisches Gedicht. Man kann
weitergehcn, und jedes knnstgewerbliche Erzengnis als
ein besseres oder schlechteres Gedicht ansehen, kann dcm-
gemäß die Kunst des knnstgewerblichen Zeichners,
des Modelleurs, überhaupt jedes selbständig erfindenden
Kunstgewerblers als eine Art „Dichtknnst", gemäß dem
Ausdrnck Formensprache als „Formendichtknnst", ihn
selbst also als „Formendichter" betrachten.
. Stellen wir uns einmal vor, ein Kunsttöpfer oder
auch ein Zeichner für Keramik habe die Anfgabe, eine
Blumenvase zu entwerfen, ein Gefäß, welches, praktisch
gcnommen, einsach die Bestimmnng hat, Wasser anfzu-
nehmen und die hineingethanen abgeschnittenen Blumen
so zu halten, daß sie nicht vereinzelt sich hier und da
über den Rand lehnen, sondern znsammengefaßt als ein
Stranß erscheinen. Ein einfaches, engmündiges Wasser-
glas odcr irgend ein irdenes demähnliches Gesäß würde
rein praktisch genügen — die Vase, das Kunstwcrk,
welches jener Künstler entwirft, ist eine Dichtnng, in
welchem der einfache Grnndgedanke in der Formen-
sprache des betreffenden Künstlers, unter Beeinflnssnng
der Ansgestaltnng durch sein Formengefühl poetisch
verklärt ist. Es ist dasselbe Verhältnis, wie das
zwischen der Sprache des Alltagsmenschen und der des
Dichters. Sagt jener: „Jn einem Bnche fand ich
nenlich eine welke Rose wieder, die ich früher einmal
hinein gelegt haben mnß, ich habe aber nicht die leiseste
Ahnnng mehr, von wem ich sie erhalten habe. Wie
man doch vergeßlich ist!", so sagt der Dichter:
Jn einem Buche blätternd, fand
Jch eine Rose, welk, zerdrückt,
llnd weiß anch nicht mehr, wessen Hand
Sie einst für mich gepflückt.
Ach, mehr nnd mehr im Abendhauch
Verweht Erinnrung; bald zerstiebt
Mein Erdenlos, dann weiß ich auch
Nicht mehr, wer mich geliebt.
Jenes ist eine praktisch vollkommen genügcnde
Mitteilnng des Ereignisses, das Gedicht Lenans uber
ift ein Kunstwerk, sagen wir einmal: ein Gebäude, als
257
17. Dekt.
Lrscheint^
Derausgeber:
Muüinanü Ilnrnnmns.
Bestellpreis:
Vierteljährlich 2^/s Ulcirk.
8. Z.rkrg.
lDon uuterm Ikuuttgevverbe.
'.ir vergleichen sehr vft im Sprachgebrauch
die bildende Knnst init der Dichtknnst, in-
dem wir technische Ansdrücke der einen
bildlich anf die andere anwcnden. Wir
nennen einen hiinmelanstrebenden Doin einen Lobgesang
zu Ehren des Höchsten, wir reden von der „edlen
Sprache", die aus diesem oder jenem Knnstwerk zn nns
spricht, andererseits sagen wir, ein Dichter male mit
glühenden Farben etwas ans, die Fignren eines Ge-
dichtes träten uns Plastisch entgegen, sein Gedicht sei
fein ausgearbeitet wie eine Filigranarbeit, u. s. w.
Anch anf das Knnstgewerbe insbesondere wendet
man bildlich Worte an, die sich auf die Dichtknnst
beziehen, man spricht von dcr edlen oder der unbe-
holfenen Formen-„Sprache" eines Meisters oder Volkes,
von dem rhytmischen Wohlklang oder Wohllant eines
Ornamentfrieses, von dem poetischen.Schwung, der in
dieser oder jener ornamentalen Komposition liege; man
nennt die gemalten Scheinarchitekturen der pompejanischen
Wanddekoration ein Phantastisches Gedicht. Man kann
weitergehcn, und jedes knnstgewerbliche Erzengnis als
ein besseres oder schlechteres Gedicht ansehen, kann dcm-
gemäß die Kunst des knnstgewerblichen Zeichners,
des Modelleurs, überhaupt jedes selbständig erfindenden
Kunstgewerblers als eine Art „Dichtknnst", gemäß dem
Ausdrnck Formensprache als „Formendichtknnst", ihn
selbst also als „Formendichter" betrachten.
. Stellen wir uns einmal vor, ein Kunsttöpfer oder
auch ein Zeichner für Keramik habe die Anfgabe, eine
Blumenvase zu entwerfen, ein Gefäß, welches, praktisch
gcnommen, einsach die Bestimmnng hat, Wasser anfzu-
nehmen und die hineingethanen abgeschnittenen Blumen
so zu halten, daß sie nicht vereinzelt sich hier und da
über den Rand lehnen, sondern znsammengefaßt als ein
Stranß erscheinen. Ein einfaches, engmündiges Wasser-
glas odcr irgend ein irdenes demähnliches Gesäß würde
rein praktisch genügen — die Vase, das Kunstwcrk,
welches jener Künstler entwirft, ist eine Dichtnng, in
welchem der einfache Grnndgedanke in der Formen-
sprache des betreffenden Künstlers, unter Beeinflnssnng
der Ansgestaltnng durch sein Formengefühl poetisch
verklärt ist. Es ist dasselbe Verhältnis, wie das
zwischen der Sprache des Alltagsmenschen und der des
Dichters. Sagt jener: „Jn einem Bnche fand ich
nenlich eine welke Rose wieder, die ich früher einmal
hinein gelegt haben mnß, ich habe aber nicht die leiseste
Ahnnng mehr, von wem ich sie erhalten habe. Wie
man doch vergeßlich ist!", so sagt der Dichter:
Jn einem Buche blätternd, fand
Jch eine Rose, welk, zerdrückt,
llnd weiß anch nicht mehr, wessen Hand
Sie einst für mich gepflückt.
Ach, mehr nnd mehr im Abendhauch
Verweht Erinnrung; bald zerstiebt
Mein Erdenlos, dann weiß ich auch
Nicht mehr, wer mich geliebt.
Jenes ist eine praktisch vollkommen genügcnde
Mitteilnng des Ereignisses, das Gedicht Lenans uber
ift ein Kunstwerk, sagen wir einmal: ein Gebäude, als
257