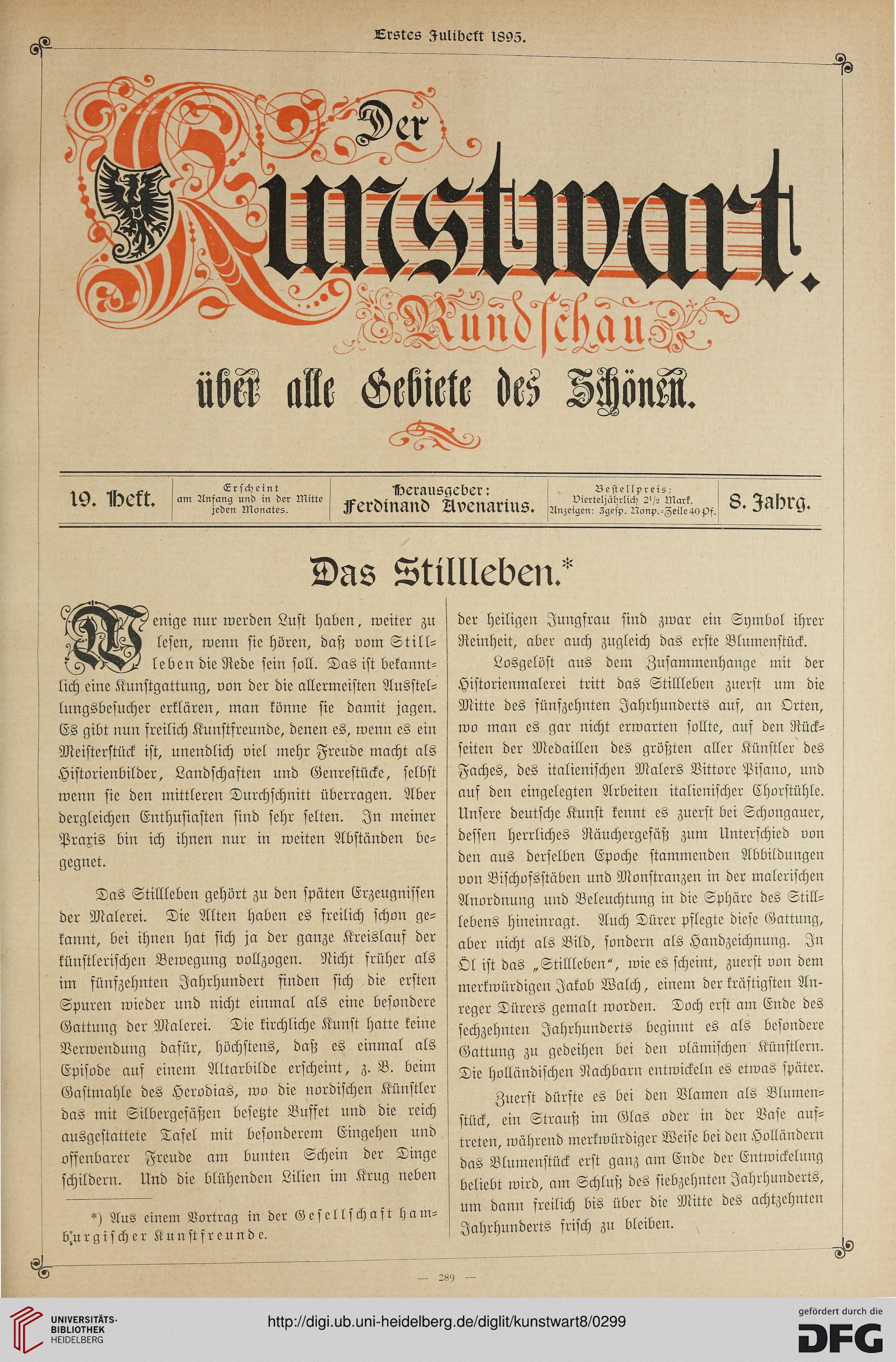Lrstes Aulibekt I89Z.
-^
19. Dett.
Erscheint
am Anfang und in der Mitte
Derausgeber:
Ferdmand NnenarLus.
vierteljährlich 2'/s Mark.
Anzeigcm Zgesp. Nonp.-Zeile^O ssf.
S. Zsbrg.
Das StiUIeben.'
eniae nur werden Lust haben, weiter zu
lesen, wenn sie hören, daß vom Still-
s leben die Rede sein soll. Das ist bekannt-
lich eine Kunstgattung, von der die allermeisten Ausstel-
lungsbesucher erklären, man könne sie damit jagen.
Es gibt nun freilich Kunstfreunde, denen es, wenn es ein
Meisterstück ist, unendlich viel mehr Freude macht als
Historienbilder, Landschasten und Genrestücke, selbst
wenn sie den mittleren Durchschnitt überragen. Aber
dergleichen Enthusiasten sind sehr selten. Jn meiner
Praxis bin ich ihnen nur in weiten Abständen be-
gegnet.
Das Stillleben gehört zu den späten Erzeugnissen
der Malerei. Die Alten haben es freilich schon ge-
kannt, bei ihnen hat sich ja der ganze Kreislaus der
künstlerischen Bewegung vollzogen. Nicht früher als
im fünfzehnten Jahrhundert finden sich die ersten
Spuren wieder und nicht einmal ats eine besondere
Gattung der Malerei. Die kirchliche Kunst hatte keine
Verwendung dafür, höchstens, daß es einmal als
Episode auf einem Altarbilde erscheint, z. B. beim
Gastmahle des Herodias, wo die nordischen Künstler
das mit Silbergefüßen besetzte Buffet und die reich
ausgestattete Tafel mit besonderem Eingehen und
ossenbarer Freude am bunten Schein der Dinge
schildern. Und die blühenden Lilien im Krug neben
*) Aus einem Vortrag in der Geseltschast ham-
b^urgischer Kunstfreund e.
der heiligen Jungsrau sind zwar ein Symbol ihrer
Reinheit, aber auch zugleich das erste Blumenstück.
Losgelöst aus dem Zusammenhange mit der
Historienmalerei tritt das Stillleben zuerst um die
Mitte des fünszehnten Jahrhunderts aus, an Orten,
wo man es gar nicht erwarten sollte, aus den Rück-
seiten der Medaillen des größten aller Künstler des
Faches, des italienischen Malers Vittore Pisano, und
auf den eingelegten Arbeiten italienischer Chorstühle.
Unsere deutsche Kunst kennt es zuerst bei Schongauer,
dessen herrliches Räuchergefüß zum Unterschied von
den aus derselben Epoche stammenden Abbildungen
von Bischofsstäben und Monstranzen in der malerischen
Anordnung und Beleuchtung in die Sphäre des Still-
lebens hineinragt. Auch Dürer pflegte diese Gattung,
aber nicht als Bild, sondern als Handzeichnung. Jn
Öl ist das „Stillleben", wie es scheint, zuerst von dem
merkwürdigen Jakob Walch, einem der krüstigsten An-
reger Dürers gemalt worden. Doch erst am Ende des
sechzehnten Jahrhunderts beginnt es als besondere
Gattung zu gedeihen bei den vlämischen Künstlern.
Die holländischen Nachbarn entwickeln es etwas später.
Zuerst dürfte es bei den Vlamen als Blumen-
stück, ein Strauß im Glas oder in der Vase auf-
treten, während merkwürdiger Weise bei den Holländern
das Blumenstück erst ganz am Ende der Entwickeluug
beliebt wird, am Schluß des siebzehnten Cahihundeitv,
um dann sreilich bis über die Mitte des achtzehnten
Jahrhunderts srisch zu bleiben.
289
-^
19. Dett.
Erscheint
am Anfang und in der Mitte
Derausgeber:
Ferdmand NnenarLus.
vierteljährlich 2'/s Mark.
Anzeigcm Zgesp. Nonp.-Zeile^O ssf.
S. Zsbrg.
Das StiUIeben.'
eniae nur werden Lust haben, weiter zu
lesen, wenn sie hören, daß vom Still-
s leben die Rede sein soll. Das ist bekannt-
lich eine Kunstgattung, von der die allermeisten Ausstel-
lungsbesucher erklären, man könne sie damit jagen.
Es gibt nun freilich Kunstfreunde, denen es, wenn es ein
Meisterstück ist, unendlich viel mehr Freude macht als
Historienbilder, Landschasten und Genrestücke, selbst
wenn sie den mittleren Durchschnitt überragen. Aber
dergleichen Enthusiasten sind sehr selten. Jn meiner
Praxis bin ich ihnen nur in weiten Abständen be-
gegnet.
Das Stillleben gehört zu den späten Erzeugnissen
der Malerei. Die Alten haben es freilich schon ge-
kannt, bei ihnen hat sich ja der ganze Kreislaus der
künstlerischen Bewegung vollzogen. Nicht früher als
im fünfzehnten Jahrhundert finden sich die ersten
Spuren wieder und nicht einmal ats eine besondere
Gattung der Malerei. Die kirchliche Kunst hatte keine
Verwendung dafür, höchstens, daß es einmal als
Episode auf einem Altarbilde erscheint, z. B. beim
Gastmahle des Herodias, wo die nordischen Künstler
das mit Silbergefüßen besetzte Buffet und die reich
ausgestattete Tafel mit besonderem Eingehen und
ossenbarer Freude am bunten Schein der Dinge
schildern. Und die blühenden Lilien im Krug neben
*) Aus einem Vortrag in der Geseltschast ham-
b^urgischer Kunstfreund e.
der heiligen Jungsrau sind zwar ein Symbol ihrer
Reinheit, aber auch zugleich das erste Blumenstück.
Losgelöst aus dem Zusammenhange mit der
Historienmalerei tritt das Stillleben zuerst um die
Mitte des fünszehnten Jahrhunderts aus, an Orten,
wo man es gar nicht erwarten sollte, aus den Rück-
seiten der Medaillen des größten aller Künstler des
Faches, des italienischen Malers Vittore Pisano, und
auf den eingelegten Arbeiten italienischer Chorstühle.
Unsere deutsche Kunst kennt es zuerst bei Schongauer,
dessen herrliches Räuchergefüß zum Unterschied von
den aus derselben Epoche stammenden Abbildungen
von Bischofsstäben und Monstranzen in der malerischen
Anordnung und Beleuchtung in die Sphäre des Still-
lebens hineinragt. Auch Dürer pflegte diese Gattung,
aber nicht als Bild, sondern als Handzeichnung. Jn
Öl ist das „Stillleben", wie es scheint, zuerst von dem
merkwürdigen Jakob Walch, einem der krüstigsten An-
reger Dürers gemalt worden. Doch erst am Ende des
sechzehnten Jahrhunderts beginnt es als besondere
Gattung zu gedeihen bei den vlämischen Künstlern.
Die holländischen Nachbarn entwickeln es etwas später.
Zuerst dürfte es bei den Vlamen als Blumen-
stück, ein Strauß im Glas oder in der Vase auf-
treten, während merkwürdiger Weise bei den Holländern
das Blumenstück erst ganz am Ende der Entwickeluug
beliebt wird, am Schluß des siebzehnten Cahihundeitv,
um dann sreilich bis über die Mitte des achtzehnten
Jahrhunderts srisch zu bleiben.
289