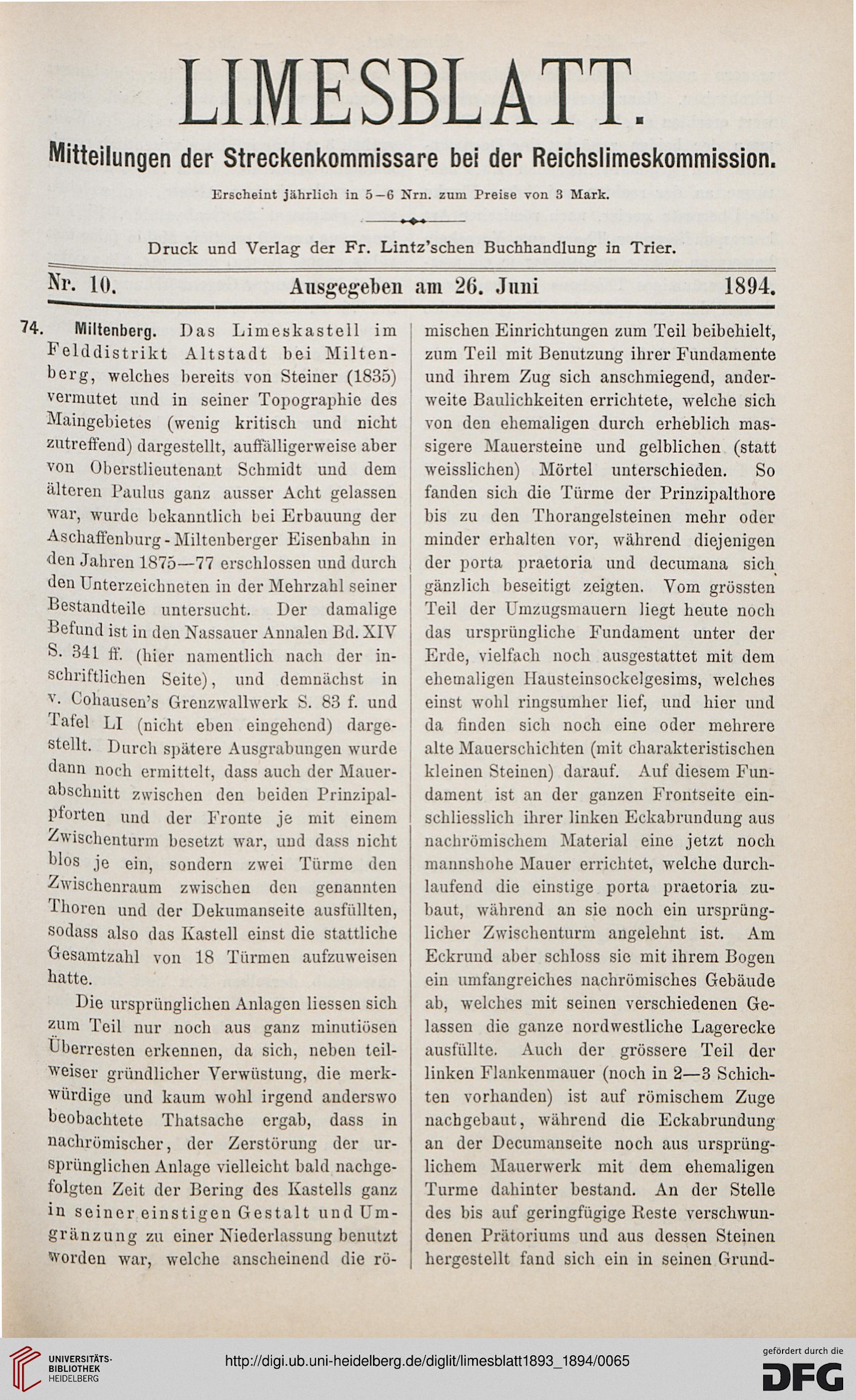LIMESBLATT.
Mitteilungen der Streckenkommissare bei der Reichslimeskommission.
Erscheint jährlich in 5—6 Nrn. zum Preise von 3 Mark.
Druck und Verlag der Fr. Lintz'schen Buchhandlung in Trier.
Nr. 10.
Ausgegeben am 26. Juni
1894.
74. Miltenberg. Das Limeskastell im
Felddistrikt Altstadt bei Milten-
berg, welches bereits von Steiner (1835)
vermutet und in seiner Topographie des
Maingebietes (wenig kritisch und nicht
zutreffend) dargestellt, auffälligerweise aber
von Oberstlieutenant Schmidt und dem
älteren Paulus ganz ausser Acht gelassen
war, wurde bekanntlich bei Erbauung der
Aschaffenburg -Miltenberger Eisenbahn in
den Jahren 1875—77 erschlossen und durch
den Unterzeichneten in der Mehrzahl seiner
Bestandteile untersucht. Der damalige
Befund ist in den Nassauer Annalen Bd. XIV
S. 341 ff. (hier namentlich nach der in-
schriftlichen Seite), und demnächst in
v. Cohauseu's Grenzwallwerk S. 83 f. und
Tafel LI (nicht eben eingehend) darge-
stellt. Durch spätere Ausgrabungen wurde
dann noch ermittelt, dass auch der Mauer-
abschnitt zwischen den beiden Prinzipal-
pforten und der Fronte je mit einem
Zwischenturm besetzt war, und dass nicht
blos je ein, sondern zwei Türme den
Zwischenraum zwischen den genannten
Thoren und der Dekumanseite ausfüllten,
sodass also das Kastell einst die stattliche
Gesamtzahl von 18 Türmen aufzuweisen
hatte.
Die ursprünglichen Anlagen Hessen sich
zum Teil nur noch aus ganz minutiösen
Überresten erkennen, da sich, neben teil-
weiser gründlicher Verwüstung, die merk-
würdige und kaum wohl irgend anderswo
beobachtete Thatsache ergab, dass in
nachrömischer, der Zerstörung der ur-
sprünglichen Anlage vielleicht bald nachge-
folgten Zeit der Bering des Kastells ganz
in seincreinstigenGestalt undUm-
gränzung zu einer Niederlassung benutzt
Worden war, welche anscheinend die rö-
mischen Einrichtungen zum Teil beibehielt,
zum Teil mit Benutzung ihrer Fundamente
und ihrem Zug sich anschmiegend, ander-
weite Baulichkeiten errichtete, welche sich
von den ehemaligen durch erheblich mas-
sigere Mauersteine und gelblichen (statt
weisslichen) Mörtel unterschieden. So
fanden sich die Türme der Prinzipalthore
bis zu den Thorangelsteinen mehr oder
minder erhalten vor, während diejenigen
der porta praetoria und decumana sich
gänzlich beseitigt zeigten. Vom grössten
Teil der Umzugsmauern liegt heute noch
das ursprüngliche Fundament unter der
Erde, vielfach noch ausgestattet mit dem
ehemaligen Ilausteinsockelgesims, welches
einst wohl ringsumher lief, und hier und
da finden sich noch eine oder mehrere
alte Mauerschichten (mit charakteristischen
kleinen Steinen) darauf. Auf diesem Fun-
dament ist an der ganzen Frontseite ein-
schliesslich ihrer linken Eckabrundung aus
nachrömischem Material eine jetzt noch
mannshohe Mauer errichtet, welche durch-
laufend die einstige porta praetoria zu-
baut, während an sie noch ein ursprüng-
licher Zwischenturm angelehnt ist. Am
Eckruud aber schloss sie mit ihrem Bogen
ein umfangreiches nachrömisches Gebäude
ab, welches mit seinen verschiedenen Ge-
lassen die ganze nordwestliche Lagerecke
ausfüllte. Audi der grössere Teil der
linken Flankenmauer (noch in 2—3 Schich-
ten vorhanden) ist auf römischem Zuge
nachgebaut, während die Eckabrundung
an der Decumanseite noch aus ursprüng-
lichem Mauerwerk mit dem ehemaligen
Turme dahinter bestand. An der Stelle
des bis auf geringfügige Reste verschwun-
denen Prätoriums und aus dessen Steinen
hergestellt fand sich ein in seinen Grund-
Mitteilungen der Streckenkommissare bei der Reichslimeskommission.
Erscheint jährlich in 5—6 Nrn. zum Preise von 3 Mark.
Druck und Verlag der Fr. Lintz'schen Buchhandlung in Trier.
Nr. 10.
Ausgegeben am 26. Juni
1894.
74. Miltenberg. Das Limeskastell im
Felddistrikt Altstadt bei Milten-
berg, welches bereits von Steiner (1835)
vermutet und in seiner Topographie des
Maingebietes (wenig kritisch und nicht
zutreffend) dargestellt, auffälligerweise aber
von Oberstlieutenant Schmidt und dem
älteren Paulus ganz ausser Acht gelassen
war, wurde bekanntlich bei Erbauung der
Aschaffenburg -Miltenberger Eisenbahn in
den Jahren 1875—77 erschlossen und durch
den Unterzeichneten in der Mehrzahl seiner
Bestandteile untersucht. Der damalige
Befund ist in den Nassauer Annalen Bd. XIV
S. 341 ff. (hier namentlich nach der in-
schriftlichen Seite), und demnächst in
v. Cohauseu's Grenzwallwerk S. 83 f. und
Tafel LI (nicht eben eingehend) darge-
stellt. Durch spätere Ausgrabungen wurde
dann noch ermittelt, dass auch der Mauer-
abschnitt zwischen den beiden Prinzipal-
pforten und der Fronte je mit einem
Zwischenturm besetzt war, und dass nicht
blos je ein, sondern zwei Türme den
Zwischenraum zwischen den genannten
Thoren und der Dekumanseite ausfüllten,
sodass also das Kastell einst die stattliche
Gesamtzahl von 18 Türmen aufzuweisen
hatte.
Die ursprünglichen Anlagen Hessen sich
zum Teil nur noch aus ganz minutiösen
Überresten erkennen, da sich, neben teil-
weiser gründlicher Verwüstung, die merk-
würdige und kaum wohl irgend anderswo
beobachtete Thatsache ergab, dass in
nachrömischer, der Zerstörung der ur-
sprünglichen Anlage vielleicht bald nachge-
folgten Zeit der Bering des Kastells ganz
in seincreinstigenGestalt undUm-
gränzung zu einer Niederlassung benutzt
Worden war, welche anscheinend die rö-
mischen Einrichtungen zum Teil beibehielt,
zum Teil mit Benutzung ihrer Fundamente
und ihrem Zug sich anschmiegend, ander-
weite Baulichkeiten errichtete, welche sich
von den ehemaligen durch erheblich mas-
sigere Mauersteine und gelblichen (statt
weisslichen) Mörtel unterschieden. So
fanden sich die Türme der Prinzipalthore
bis zu den Thorangelsteinen mehr oder
minder erhalten vor, während diejenigen
der porta praetoria und decumana sich
gänzlich beseitigt zeigten. Vom grössten
Teil der Umzugsmauern liegt heute noch
das ursprüngliche Fundament unter der
Erde, vielfach noch ausgestattet mit dem
ehemaligen Ilausteinsockelgesims, welches
einst wohl ringsumher lief, und hier und
da finden sich noch eine oder mehrere
alte Mauerschichten (mit charakteristischen
kleinen Steinen) darauf. Auf diesem Fun-
dament ist an der ganzen Frontseite ein-
schliesslich ihrer linken Eckabrundung aus
nachrömischem Material eine jetzt noch
mannshohe Mauer errichtet, welche durch-
laufend die einstige porta praetoria zu-
baut, während an sie noch ein ursprüng-
licher Zwischenturm angelehnt ist. Am
Eckruud aber schloss sie mit ihrem Bogen
ein umfangreiches nachrömisches Gebäude
ab, welches mit seinen verschiedenen Ge-
lassen die ganze nordwestliche Lagerecke
ausfüllte. Audi der grössere Teil der
linken Flankenmauer (noch in 2—3 Schich-
ten vorhanden) ist auf römischem Zuge
nachgebaut, während die Eckabrundung
an der Decumanseite noch aus ursprüng-
lichem Mauerwerk mit dem ehemaligen
Turme dahinter bestand. An der Stelle
des bis auf geringfügige Reste verschwun-
denen Prätoriums und aus dessen Steinen
hergestellt fand sich ein in seinen Grund-