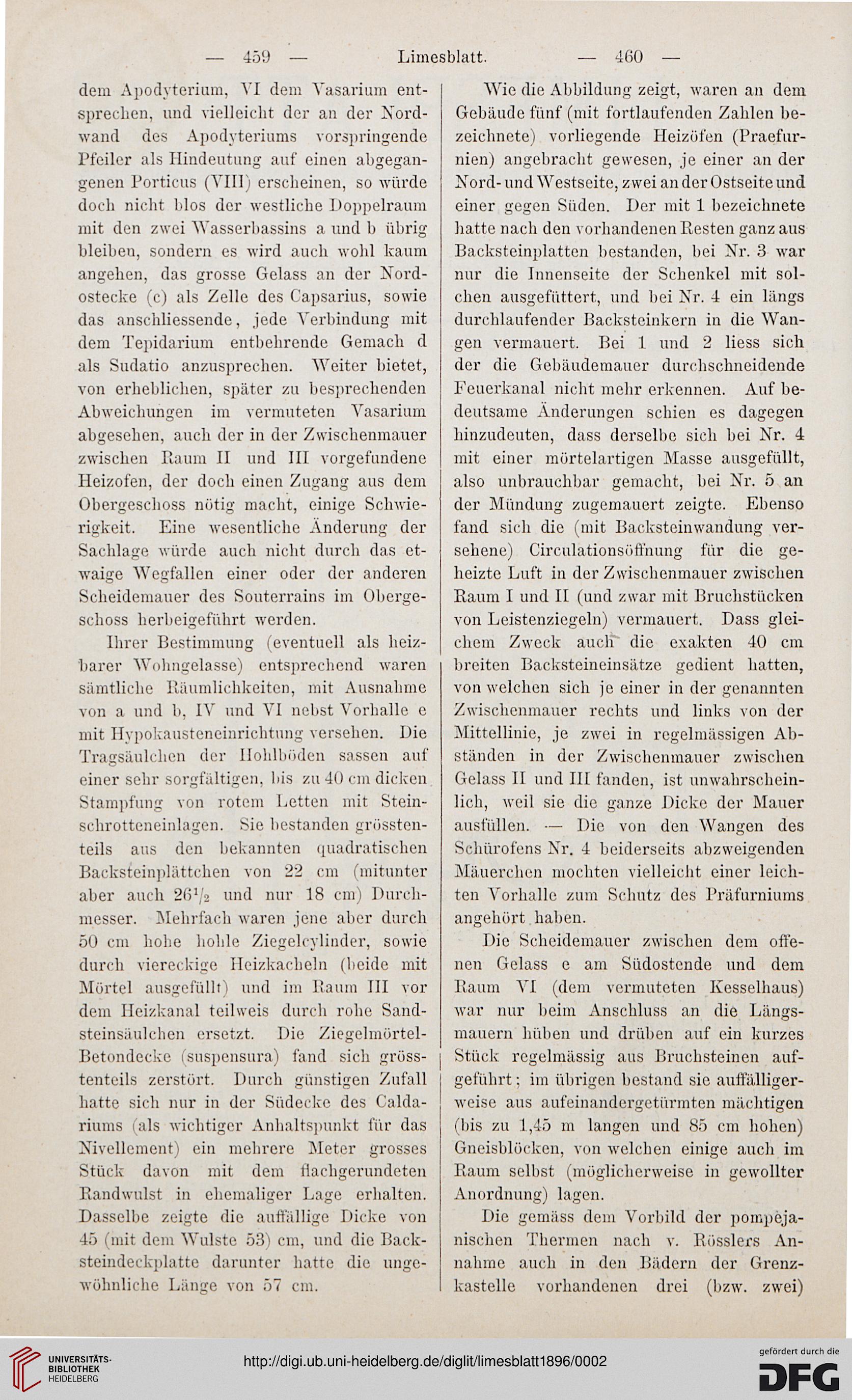— 459 —
Limei
sblatt.
— 460 —
dem Apodyterium, VI dem Vasarium ent-
sprechen, und vielleicht der an der Nord-
wand des Apodyteriums vorspringende
l'feiler als Hindeatung auf einen abgegan-
genen Forticus (VIII) erscheinen, so würde
doch nicht blos der westliche Doppelraum
mit den zwei 'Wasserbassins a und b übrig
bleiben, sondern es wird auch wohl kaum
angehen, das grosse Gelass an der Nord-
ostecke (c) als Zelle des Capsarius, sowie
das anschliessende, .jede Verbindung mit
dem Tepidarium entbehrende Gemach d
als Sudatio anzusprechen. Weiter bietet,
von erheblichen, später zu besprechenden
Abweichungen im vermuteten Vasarium
abgesehen, auch der in der Zwischenmauer
zwischen Raum II und III vorgefundene
Heizofen, der doch einen Zugang aus dem
Obergeschoss nötig macht, einige Schwie-
rigkeit. Eine wesentliche Änderung der
Sachlage würde auch nicht durch das et-
waige Wegfallen einer oder der anderen
Scheidemauer des Souterrains im Oberge-
schoss herbeigeführt werden.
Ihrer Bestimmung (eventuell als heiz-
barer Wohngelasse) entsprechend wraren
samtliche Räumlichkeiten, mit Ausnahme
von a und b, IV und VI nebst Vorhalle c
mit Hypokausteneinrichtnng versehen. Die
TragsUulchen der Ilohlböden sassen auf
einer sehr sorgfältigen, Iiis zu 40 cm dicken
Stampfung von rotem Letten mit Stein-
schrotteneinlagen. Sie bestanden grössten-
teils aus den bekannten quadratischen
Backsteinplättchen von 22 cm (mitunter
aber auch 261/! und nur 18 cm) Durch-
messer. Mehrfach waren jene aber durch
50 cm hohe hohle Ziegelcylinder, sowie
durch viereckige Heizkacheln (beide mit
Mörtel ausgefüllt"! und im Raum III vor
dem Heizkanal teilweis durch rohe Sand-
steinsäulchen ersetzt. Die Ziegelmörtel-
Betondccke (suspensura) fand sich gröss-
tenteils zerstört. Durch günstigen Zufall
hatte sich nur in der Südecke des Calda-
riums (als wichtiger Anhaltspunkt für das
Nivellement) ein mehrere Meter grosses
Stück davon mit dem flachgerundeten
Bandwulst in ehemaliger Lage erhalten.
Dasselbe zeigte die autfällige Dicke von
45 (mit dem Wulste 53") cm, und die Back-
Steindeckplatte darunter hatte die unge-
wöhnliche Länge von 57 cm.
Wie die Abbildung zeigt, waren an dem
Gebäude fünf (mit fortlaufenden Zahlen be-
zeichnete) vorliegende Heizöfen (Praefur-
nien) angebracht gewesen, je einer an der
Nord- und Westseite, zwei an der Ostseite und
einer gegen Süden. Der mit 1 bezeichnete
hatte nach den vorhandenen Kesten ganz aus
Backsteinplatten bestanden, bei Nr. 3 war
nur die Innenseite der Schenkel mit sol-
chen ausgefüttert, und bei Nr. 4 ein längs
durchlaufender Backsteinkern in die Wan-
gen vermauert. Bei 1 und 2 Hess sich
der die Gebäudemauer durchschneidende
Feuerkanal nicht mehr erkennen. Auf be-
deutsame Änderungen schien es dagegen
hinzudeuten, dass derselbe sich bei Nr. 4
mit einer mörtelartigen Masse ausgefüllt,
also unbrauchbar gemacht, bei Nr. 5 an
der Mündung zugemauert zeigte. Ebenso
fand sich die (mit Backsteinwandung ver-
sehene) Circulationsöffnung für die ge-
heizte Luft in der Zwischenmauer zwischen
Baum I und II (und zwar mit Bruchstücken
von Leistenziegeln) vermauert. Dass glei-
chem Zweck aucir die exakten 40 cm
breiten Backsteineinsätze gedient hatten,
von welchen sich je einer in der genannten
Zwischenmauer rechts und links von der
Mittellinie, je zwei in regelmässigen Ab-
ständen in der Zwischenmauer zwischen
Gelass II und III fanden, ist unwahrschein-
lich, weil sie die ganze Dicke der Mauer
ausfüllen. — Die von den Wangen des
Schürofens Nr. 4 beiderseits abzweigenden
Mäuerchen mochten vielleicht einer leich-
ten Vorhalle zum Schutz des l'räftirniums
angehört haben.
Die Scheidemauer zwischen dem offe-
nen Gelass e am Südostende und dem
Baum VI (dem vermuteten Kesselhaus)
war nur beim Anschluss an die Längs-
mauern hüben und drüben auf ein kurzes
Stück regelmässig aus Bruchsteinen auf-
geführt : im übrigen bestand sie auffälliger-
weise aus aufeinandergetürmten mächtigen
(bis zu 1,45 m langen und 85 cm hohen)
Gneisblöcken, von welchen einige auch im
Baum selbst (möglicherweise in gewollter
Anordnung) lagen.
Die gemäss dem Vorbild der pompeja-
nischen Thermen nach v. Bosslers An-
nahme auch in den Bädern der Grenz-
kastelle vorhandenen drei (bzw. zwei)
Limei
sblatt.
— 460 —
dem Apodyterium, VI dem Vasarium ent-
sprechen, und vielleicht der an der Nord-
wand des Apodyteriums vorspringende
l'feiler als Hindeatung auf einen abgegan-
genen Forticus (VIII) erscheinen, so würde
doch nicht blos der westliche Doppelraum
mit den zwei 'Wasserbassins a und b übrig
bleiben, sondern es wird auch wohl kaum
angehen, das grosse Gelass an der Nord-
ostecke (c) als Zelle des Capsarius, sowie
das anschliessende, .jede Verbindung mit
dem Tepidarium entbehrende Gemach d
als Sudatio anzusprechen. Weiter bietet,
von erheblichen, später zu besprechenden
Abweichungen im vermuteten Vasarium
abgesehen, auch der in der Zwischenmauer
zwischen Raum II und III vorgefundene
Heizofen, der doch einen Zugang aus dem
Obergeschoss nötig macht, einige Schwie-
rigkeit. Eine wesentliche Änderung der
Sachlage würde auch nicht durch das et-
waige Wegfallen einer oder der anderen
Scheidemauer des Souterrains im Oberge-
schoss herbeigeführt werden.
Ihrer Bestimmung (eventuell als heiz-
barer Wohngelasse) entsprechend wraren
samtliche Räumlichkeiten, mit Ausnahme
von a und b, IV und VI nebst Vorhalle c
mit Hypokausteneinrichtnng versehen. Die
TragsUulchen der Ilohlböden sassen auf
einer sehr sorgfältigen, Iiis zu 40 cm dicken
Stampfung von rotem Letten mit Stein-
schrotteneinlagen. Sie bestanden grössten-
teils aus den bekannten quadratischen
Backsteinplättchen von 22 cm (mitunter
aber auch 261/! und nur 18 cm) Durch-
messer. Mehrfach waren jene aber durch
50 cm hohe hohle Ziegelcylinder, sowie
durch viereckige Heizkacheln (beide mit
Mörtel ausgefüllt"! und im Raum III vor
dem Heizkanal teilweis durch rohe Sand-
steinsäulchen ersetzt. Die Ziegelmörtel-
Betondccke (suspensura) fand sich gröss-
tenteils zerstört. Durch günstigen Zufall
hatte sich nur in der Südecke des Calda-
riums (als wichtiger Anhaltspunkt für das
Nivellement) ein mehrere Meter grosses
Stück davon mit dem flachgerundeten
Bandwulst in ehemaliger Lage erhalten.
Dasselbe zeigte die autfällige Dicke von
45 (mit dem Wulste 53") cm, und die Back-
Steindeckplatte darunter hatte die unge-
wöhnliche Länge von 57 cm.
Wie die Abbildung zeigt, waren an dem
Gebäude fünf (mit fortlaufenden Zahlen be-
zeichnete) vorliegende Heizöfen (Praefur-
nien) angebracht gewesen, je einer an der
Nord- und Westseite, zwei an der Ostseite und
einer gegen Süden. Der mit 1 bezeichnete
hatte nach den vorhandenen Kesten ganz aus
Backsteinplatten bestanden, bei Nr. 3 war
nur die Innenseite der Schenkel mit sol-
chen ausgefüttert, und bei Nr. 4 ein längs
durchlaufender Backsteinkern in die Wan-
gen vermauert. Bei 1 und 2 Hess sich
der die Gebäudemauer durchschneidende
Feuerkanal nicht mehr erkennen. Auf be-
deutsame Änderungen schien es dagegen
hinzudeuten, dass derselbe sich bei Nr. 4
mit einer mörtelartigen Masse ausgefüllt,
also unbrauchbar gemacht, bei Nr. 5 an
der Mündung zugemauert zeigte. Ebenso
fand sich die (mit Backsteinwandung ver-
sehene) Circulationsöffnung für die ge-
heizte Luft in der Zwischenmauer zwischen
Baum I und II (und zwar mit Bruchstücken
von Leistenziegeln) vermauert. Dass glei-
chem Zweck aucir die exakten 40 cm
breiten Backsteineinsätze gedient hatten,
von welchen sich je einer in der genannten
Zwischenmauer rechts und links von der
Mittellinie, je zwei in regelmässigen Ab-
ständen in der Zwischenmauer zwischen
Gelass II und III fanden, ist unwahrschein-
lich, weil sie die ganze Dicke der Mauer
ausfüllen. — Die von den Wangen des
Schürofens Nr. 4 beiderseits abzweigenden
Mäuerchen mochten vielleicht einer leich-
ten Vorhalle zum Schutz des l'räftirniums
angehört haben.
Die Scheidemauer zwischen dem offe-
nen Gelass e am Südostende und dem
Baum VI (dem vermuteten Kesselhaus)
war nur beim Anschluss an die Längs-
mauern hüben und drüben auf ein kurzes
Stück regelmässig aus Bruchsteinen auf-
geführt : im übrigen bestand sie auffälliger-
weise aus aufeinandergetürmten mächtigen
(bis zu 1,45 m langen und 85 cm hohen)
Gneisblöcken, von welchen einige auch im
Baum selbst (möglicherweise in gewollter
Anordnung) lagen.
Die gemäss dem Vorbild der pompeja-
nischen Thermen nach v. Bosslers An-
nahme auch in den Bädern der Grenz-
kastelle vorhandenen drei (bzw. zwei)