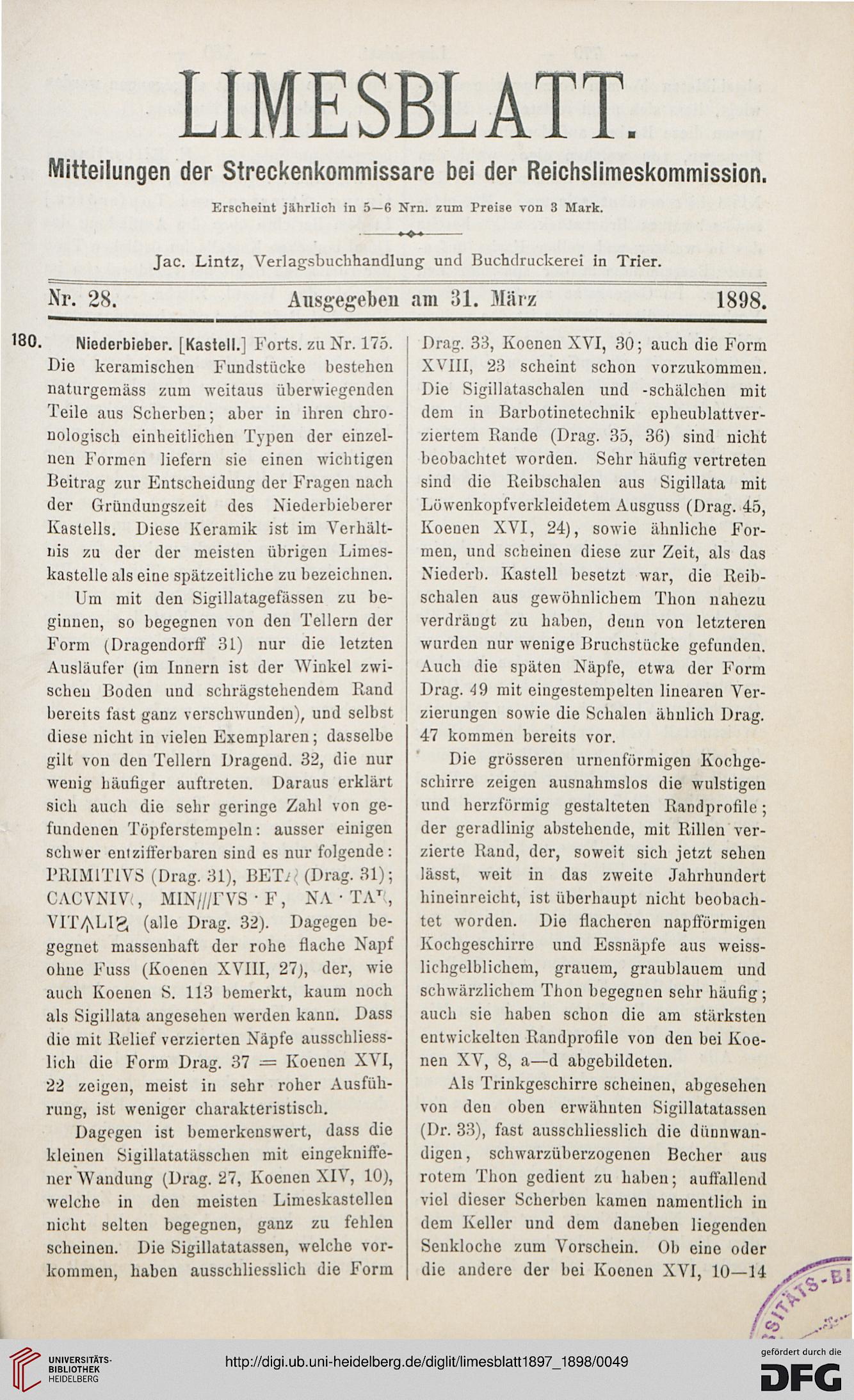LIMESBLATT.
Mitteilungen der Streckenkommissare bei der Reichslimeskommission,
Erscheint jährlich in 5—6 Nrn. zum Preise von 3 Mark.
Jac. Lintz, Verlagsbuchhandlung und Buchdruckerei in Trier.
Nr. 28.
Ausgegeben am 31. März
1898.
180. Niederbieber. [Kastell.] Forts, zu Nr. 175.
Die keramischen Fundstücke bestehen
naturgemäss zum weitaus überwiegenden
Teile aus Scherben; aber in ihren chro-
nologisch einheitlichen Typen der einzel-
nen Formen liefern sie einen wichtigen
Beitrag zur Entscheidung der Fragen nach
der Gründungszeit des Niederbieberer
Kastells. Diese Keramik ist im Verhält-
nis zu der der meisten übrigen Limes-
kastelle als eine spätzeitliche zu bezeichnen.
Um mit den Sigillatagefässen zu be-
ginnen, so begegnen von den Tellern der
Form (Dragendorff 31) nur die letzten
Ausläufer (im Innern ist der Winkel zwi-
schen Boden und schrägstehendem Rand
bereits fast ganz verschwunden), und selbst
diese nicht in vielen Exemplaren; dasselbe
gilt von den Tellern IJragend. 32, die nur
wenig häufiger auftreten. Daraus erklärt
sich auch die sehr geringe Zahl von ge-
fundenen Töpferstempeln: äusser einigen
schwer entzifferbaren sind es nur folgende:
I’RIMITIVS (Drag. 31), BET^ (Drag. 31);
CACVNIV, MIN///FVS • F, NA • TAT.,
VIT/)<LIg (alle Drag. 32). Dagegen be-
gegnet massenhaft der rohe flache Napf
ohne Fuss (Koenen XVIII, 27), der, wie
auch Koenen S. 113 bemerkt, kaum noch
als Sigillata angesehen werden kann. Dass
die mit Relief verzierten Näpfe ausschliess-
lich die Form Drag. 37 = Koenen XVI,
22 zeigen, meist in sehr roher Ausfüh-
rung, ist weniger charakteristisch.
Dagegen ist bemerkenswert, dass die
kleinen Sigillatatässchen mit eingekniffe-
ner Wandung (Drag. 27, Koenen XIV, 10),
welche in den meisten Limeskastellen
nicht selten begegnen, ganz zu fehlen
scheinen. Die Sigillatatassen, welche vor-
kommen, haben ausschliesslich die Form
Drag. 33, Koenen XVI, 30; auch die Form
XVIII, 23 scheint schon vorzukommen.
Die Sigillataschalen und -Schälchen mit
dem in Barbotinetechnik epheublattver-
ziertem Rande (Drag. 35, 36) sind nicht
beobachtet worden. Sehr häufig vertreten
sind die Reibschalen aus Sigillata mit
Löwenkopfverkleidetem Ausguss (Drag. 45,
Koenen XVI, 24), sowie ähnliche For-
men, und scheinen diese zur Zeit, als das
Niederb. Kastell besetzt war, die Reib-
schalen aus gewöhnlichem Thon nahezu
verdrängt zu haben, denn von letzteren
wurden nur wenige Bruchstücke gefunden.
Auch die späten Näpfe, etwa der Form
Drag. 49 mit eingestempelten linearen Ver-
zierungen sowie die Schalen ähnlich Drag.
47 kommen bereits vor.
Die grösseren urnenförmigen Kochge-
schirre zeigen ausnahmslos die wulstigen
und herzförmig gestalteten Randprofile;
der geradlinig abstehende, mit Rillen ver-
zierte Rand, der, soweit sich jetzt sehen
lässt, weit in das zweite Jahrhundert
hineinreicht, ist überhaupt nicht beobach-
tet worden. Die flacheren napfförmigen
Kochgeschirre und Essnäpfe aus weiss-
lichgelblichem, grauem, graublauem und
schwärzlichem Thon begegnen sehr häufig ;
auch sie haben schon die am stärksten
entwickelten Randprofile von den bei Koe-
nen XV, 8, a—d abgebildeten.
Als Trinkgeschirre scheinen, abgesehen
von den oben erwähnten Sigillatatassen
(Dr. 33), fast ausschliesslich die dünnwan-
digen, schwarzüberzogenen Becher aus
rotem Thon gedient zu haben; auffallend
viel dieser Scherben kamen namentlich in
dem Keller und dem daneben liegenden
Senkloche zum Vorschein. Ob eine oder
die andere der bei Koenen XVI, 10—14
Mitteilungen der Streckenkommissare bei der Reichslimeskommission,
Erscheint jährlich in 5—6 Nrn. zum Preise von 3 Mark.
Jac. Lintz, Verlagsbuchhandlung und Buchdruckerei in Trier.
Nr. 28.
Ausgegeben am 31. März
1898.
180. Niederbieber. [Kastell.] Forts, zu Nr. 175.
Die keramischen Fundstücke bestehen
naturgemäss zum weitaus überwiegenden
Teile aus Scherben; aber in ihren chro-
nologisch einheitlichen Typen der einzel-
nen Formen liefern sie einen wichtigen
Beitrag zur Entscheidung der Fragen nach
der Gründungszeit des Niederbieberer
Kastells. Diese Keramik ist im Verhält-
nis zu der der meisten übrigen Limes-
kastelle als eine spätzeitliche zu bezeichnen.
Um mit den Sigillatagefässen zu be-
ginnen, so begegnen von den Tellern der
Form (Dragendorff 31) nur die letzten
Ausläufer (im Innern ist der Winkel zwi-
schen Boden und schrägstehendem Rand
bereits fast ganz verschwunden), und selbst
diese nicht in vielen Exemplaren; dasselbe
gilt von den Tellern IJragend. 32, die nur
wenig häufiger auftreten. Daraus erklärt
sich auch die sehr geringe Zahl von ge-
fundenen Töpferstempeln: äusser einigen
schwer entzifferbaren sind es nur folgende:
I’RIMITIVS (Drag. 31), BET^ (Drag. 31);
CACVNIV, MIN///FVS • F, NA • TAT.,
VIT/)<LIg (alle Drag. 32). Dagegen be-
gegnet massenhaft der rohe flache Napf
ohne Fuss (Koenen XVIII, 27), der, wie
auch Koenen S. 113 bemerkt, kaum noch
als Sigillata angesehen werden kann. Dass
die mit Relief verzierten Näpfe ausschliess-
lich die Form Drag. 37 = Koenen XVI,
22 zeigen, meist in sehr roher Ausfüh-
rung, ist weniger charakteristisch.
Dagegen ist bemerkenswert, dass die
kleinen Sigillatatässchen mit eingekniffe-
ner Wandung (Drag. 27, Koenen XIV, 10),
welche in den meisten Limeskastellen
nicht selten begegnen, ganz zu fehlen
scheinen. Die Sigillatatassen, welche vor-
kommen, haben ausschliesslich die Form
Drag. 33, Koenen XVI, 30; auch die Form
XVIII, 23 scheint schon vorzukommen.
Die Sigillataschalen und -Schälchen mit
dem in Barbotinetechnik epheublattver-
ziertem Rande (Drag. 35, 36) sind nicht
beobachtet worden. Sehr häufig vertreten
sind die Reibschalen aus Sigillata mit
Löwenkopfverkleidetem Ausguss (Drag. 45,
Koenen XVI, 24), sowie ähnliche For-
men, und scheinen diese zur Zeit, als das
Niederb. Kastell besetzt war, die Reib-
schalen aus gewöhnlichem Thon nahezu
verdrängt zu haben, denn von letzteren
wurden nur wenige Bruchstücke gefunden.
Auch die späten Näpfe, etwa der Form
Drag. 49 mit eingestempelten linearen Ver-
zierungen sowie die Schalen ähnlich Drag.
47 kommen bereits vor.
Die grösseren urnenförmigen Kochge-
schirre zeigen ausnahmslos die wulstigen
und herzförmig gestalteten Randprofile;
der geradlinig abstehende, mit Rillen ver-
zierte Rand, der, soweit sich jetzt sehen
lässt, weit in das zweite Jahrhundert
hineinreicht, ist überhaupt nicht beobach-
tet worden. Die flacheren napfförmigen
Kochgeschirre und Essnäpfe aus weiss-
lichgelblichem, grauem, graublauem und
schwärzlichem Thon begegnen sehr häufig ;
auch sie haben schon die am stärksten
entwickelten Randprofile von den bei Koe-
nen XV, 8, a—d abgebildeten.
Als Trinkgeschirre scheinen, abgesehen
von den oben erwähnten Sigillatatassen
(Dr. 33), fast ausschliesslich die dünnwan-
digen, schwarzüberzogenen Becher aus
rotem Thon gedient zu haben; auffallend
viel dieser Scherben kamen namentlich in
dem Keller und dem daneben liegenden
Senkloche zum Vorschein. Ob eine oder
die andere der bei Koenen XVI, 10—14