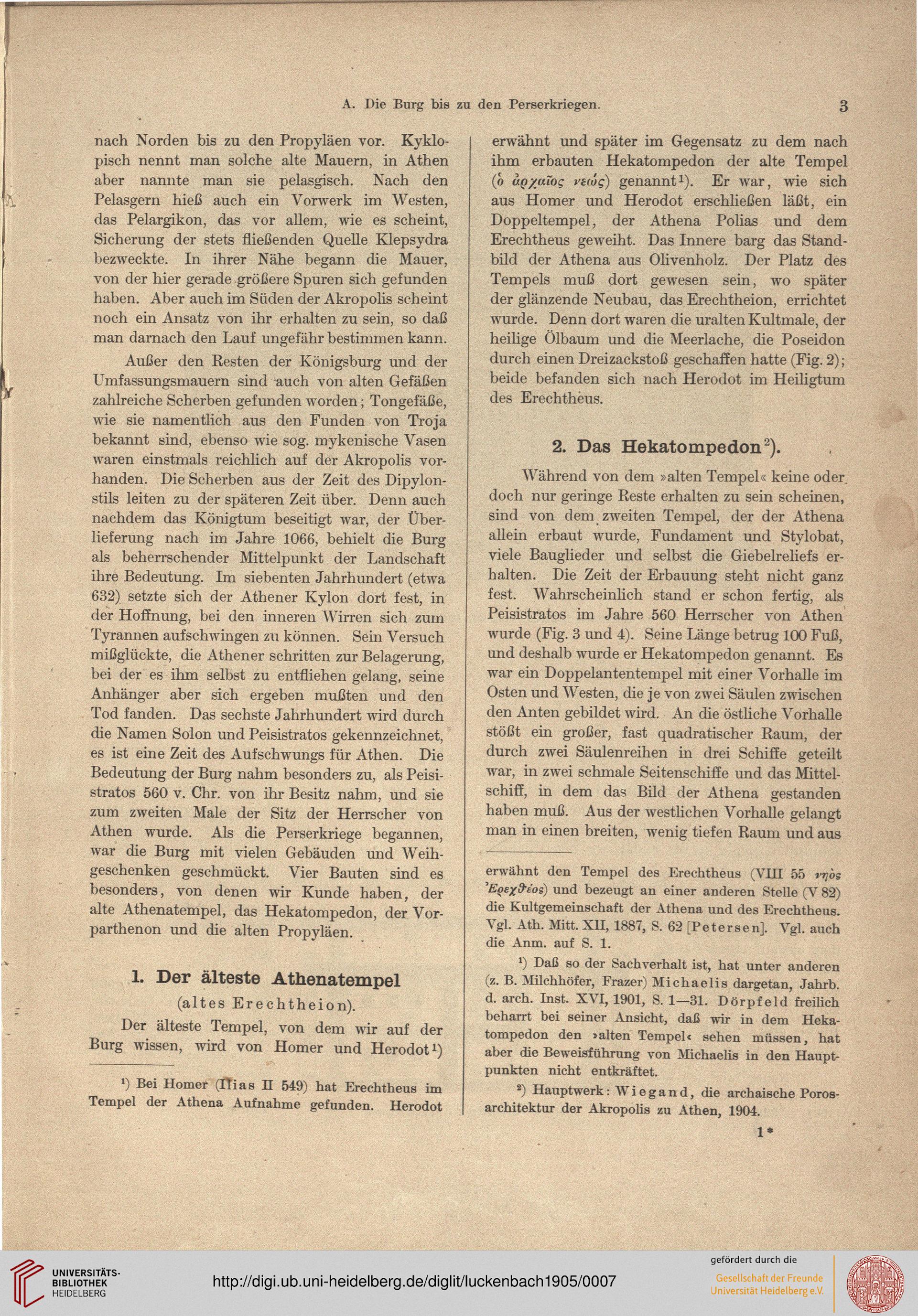A. Die Burg bis zu den Perserkriegen.
nach Norden bis zu den Propyläen vor. Kyklo-
pisch nennt man solche alte Mauern, in Athen
aber nannte man sie pelasgisch. Nach den
Pelasgern hieß auch ein Vorwerk im Westen,
das Pelargikon, das vor allem, wie es scheint,
Sicherung der stets fließenden Quelle Klepsydra
bezweckte. In ihrer Nähe begann die Mauer,
von der hier gerade größere Spuren sich gefunden
haben. Aber auch im Süden der Akropolis scheint
noch ein Ansatz von ihr erhalten zu sein, so daß
man darnach den Lauf ungefähr bestimmen kann.
Außer den Eesten der Königsburg und der
Umfassungsmauern sind auch von alten Gefäßen
zahlreiche Scherben gefunden worden; Tongefäße,
wie sie namentlich aus den Funden von Troja
bekannt sind, ebenso wie sog. mykenische Vasen
waren einstmals reichlich auf der Akropolis vor-
handen. Die Scherben aus der Zeit des Dipylon-
stils leiten zu der späteren Zeit über. Denn auch
nachdem das Königtum beseitigt war, der Über-
lieferung nach im Jahre 1066, behielt die Burg
als beherrschender Mittelpunkt der Landschaft
ihre Bedeutung. Im siebenten Jahrhundert (etwa
632) setzte sich der Athener Kylon dort fest, in
der Hoffnung, bei den inneren Wirren sich zum
Tyrannen aufschwingen zu können. Sein Versuch
mißglückte, die Athener schritten zur Belagerung,
bei der es ihm selbst zu entfliehen gelang, seine
Anhänger aber sich ergeben mußten und den
Tod fanden. Das sechste Jahrhundert wird durch
die Namen Solon und Peisistratos gekennzeichnet,
es ist eine Zeit des Aufschwungs für Athen. Die
Bedeutung der Burg nahm besonders zu, als Peisi-
stratos 560 v. Chr. von ihr Besitz nahm, und sie
zum zweiten Male der Sitz der Herrscher von
Athen wurde. Als die Perserkriege begannen,
war die Burg mit vielen Gebäuden und Weih-
geschenken geschmückt. Vier Bauten sind es
besonders, von denen wir Kunde haben, der
alte Athenatempel, das Hekatompedon, der Vor-
parthenon und die alten Propyläen.
1. Der älteste Athenatempel
(altes Erechtheion).
Der älteste Tempel, von dem wir auf der
Burg wissen, wird von Homer und Herodot1)
*) Bei Homer (Ilias II 549) hat Ereehtheus im
Tempel der Athena Aufnahme gefunden. Herodot
erwähnt und später im Gegensatz zu dem nach
ihm erbauten Hekatompedon der alte Tempel
(b uQ/alog vuig) genannt1). Er war, wie sich
aus Homer und Herodot erschließen läßt, ein
Doppeltempel, der Athena Polias und dem
Ereehtheus geweiht. Das Innere barg das Stand-
bild der Athena aus Olivenholz. Der Platz des
Tempels muß dort gewesen sein, wo später
der glänzende Neubau, das Erechtheion, errichtet
wurde. Denn dort waren die uralten Kultmale, der
heilige Ölbaum und die Meerlache, die Poseidon
durch einen Dreizaekstoß geschaffen hatte (Fig. 2);
beide befanden sich nach Herodot im Heiligtum
des Ereehtheus.
2. Das Hekatompedon2).
Während von dem »alten Tempel« keine oder,
doch nur geringe Beste erhalten zu sein scheinen,
sind von dem zweiten Tempel, der der Athena
allein erbaut wurde, Fundament und Stylobat,
viele Bauglieder und selbst die Giebelreliefs er-
halten. Die Zeit der Erbauung steht nicht ganz
fest. Wahrscheinlich stand er schon fertig, als
Peisistratos im Jahre 560 Herrscher von Athen
wurde (Fig. 3 imd 4). Seine Länge betrug 100 Fuß,
und deshalb wurde er Hekatompedon genannt. Es
war ein Doppelantentempel mit einer Vorhalle im
Osten und Westen, die je von zwei Säulen zwischen
den Anten gebildet wird. An die östliche Vorhalle
stößt ein großer, fast quadratischer Raum, der
durch zwei Säulenreihen in drei Schiffe geteilt
war, in zwei schmale Seitenschiffe und das Mittel-
schiff, in dem das Bild der Athena gestanden
haben muß. Aus der westüchen Vorhalle gelangt
man in einen breiten, wenig tiefen Raum und aus
erwähnt den Tempel des Ereehtheus (VIII 55 njöe
'Edexfre'oo) und bezeugt an einer anderen Stelle (V 82)
die Kultgemeinschaft der Athena und des Ereehtheus.
Vgl. Ath. Mitt. XII, 1887, S. 62 [Petersen]. Vgl. auch
die Anm. auf S. 1.
*) Daß so der Sachverhalt ist, hat unter anderen
(z. B. Milchhöfer, Frazer) Michaelis dargetan, Jahrb.
d. arch. Inst. XVI, 1901, S. 1—31. Dörpfeld freilich
beharrt bei seiner Ansicht, daß wir in dem Heka-
tompedon den >alten Tempel« sehen müssen, hat
aber die Beweisführung von Michaelis in den Haupt-
punkten nicht entkräftet.
s) Hauptwerk: "Wiegand, die archaische Poros-
architektur der Akropolis zu Athen, 1904.
1*
nach Norden bis zu den Propyläen vor. Kyklo-
pisch nennt man solche alte Mauern, in Athen
aber nannte man sie pelasgisch. Nach den
Pelasgern hieß auch ein Vorwerk im Westen,
das Pelargikon, das vor allem, wie es scheint,
Sicherung der stets fließenden Quelle Klepsydra
bezweckte. In ihrer Nähe begann die Mauer,
von der hier gerade größere Spuren sich gefunden
haben. Aber auch im Süden der Akropolis scheint
noch ein Ansatz von ihr erhalten zu sein, so daß
man darnach den Lauf ungefähr bestimmen kann.
Außer den Eesten der Königsburg und der
Umfassungsmauern sind auch von alten Gefäßen
zahlreiche Scherben gefunden worden; Tongefäße,
wie sie namentlich aus den Funden von Troja
bekannt sind, ebenso wie sog. mykenische Vasen
waren einstmals reichlich auf der Akropolis vor-
handen. Die Scherben aus der Zeit des Dipylon-
stils leiten zu der späteren Zeit über. Denn auch
nachdem das Königtum beseitigt war, der Über-
lieferung nach im Jahre 1066, behielt die Burg
als beherrschender Mittelpunkt der Landschaft
ihre Bedeutung. Im siebenten Jahrhundert (etwa
632) setzte sich der Athener Kylon dort fest, in
der Hoffnung, bei den inneren Wirren sich zum
Tyrannen aufschwingen zu können. Sein Versuch
mißglückte, die Athener schritten zur Belagerung,
bei der es ihm selbst zu entfliehen gelang, seine
Anhänger aber sich ergeben mußten und den
Tod fanden. Das sechste Jahrhundert wird durch
die Namen Solon und Peisistratos gekennzeichnet,
es ist eine Zeit des Aufschwungs für Athen. Die
Bedeutung der Burg nahm besonders zu, als Peisi-
stratos 560 v. Chr. von ihr Besitz nahm, und sie
zum zweiten Male der Sitz der Herrscher von
Athen wurde. Als die Perserkriege begannen,
war die Burg mit vielen Gebäuden und Weih-
geschenken geschmückt. Vier Bauten sind es
besonders, von denen wir Kunde haben, der
alte Athenatempel, das Hekatompedon, der Vor-
parthenon und die alten Propyläen.
1. Der älteste Athenatempel
(altes Erechtheion).
Der älteste Tempel, von dem wir auf der
Burg wissen, wird von Homer und Herodot1)
*) Bei Homer (Ilias II 549) hat Ereehtheus im
Tempel der Athena Aufnahme gefunden. Herodot
erwähnt und später im Gegensatz zu dem nach
ihm erbauten Hekatompedon der alte Tempel
(b uQ/alog vuig) genannt1). Er war, wie sich
aus Homer und Herodot erschließen läßt, ein
Doppeltempel, der Athena Polias und dem
Ereehtheus geweiht. Das Innere barg das Stand-
bild der Athena aus Olivenholz. Der Platz des
Tempels muß dort gewesen sein, wo später
der glänzende Neubau, das Erechtheion, errichtet
wurde. Denn dort waren die uralten Kultmale, der
heilige Ölbaum und die Meerlache, die Poseidon
durch einen Dreizaekstoß geschaffen hatte (Fig. 2);
beide befanden sich nach Herodot im Heiligtum
des Ereehtheus.
2. Das Hekatompedon2).
Während von dem »alten Tempel« keine oder,
doch nur geringe Beste erhalten zu sein scheinen,
sind von dem zweiten Tempel, der der Athena
allein erbaut wurde, Fundament und Stylobat,
viele Bauglieder und selbst die Giebelreliefs er-
halten. Die Zeit der Erbauung steht nicht ganz
fest. Wahrscheinlich stand er schon fertig, als
Peisistratos im Jahre 560 Herrscher von Athen
wurde (Fig. 3 imd 4). Seine Länge betrug 100 Fuß,
und deshalb wurde er Hekatompedon genannt. Es
war ein Doppelantentempel mit einer Vorhalle im
Osten und Westen, die je von zwei Säulen zwischen
den Anten gebildet wird. An die östliche Vorhalle
stößt ein großer, fast quadratischer Raum, der
durch zwei Säulenreihen in drei Schiffe geteilt
war, in zwei schmale Seitenschiffe und das Mittel-
schiff, in dem das Bild der Athena gestanden
haben muß. Aus der westüchen Vorhalle gelangt
man in einen breiten, wenig tiefen Raum und aus
erwähnt den Tempel des Ereehtheus (VIII 55 njöe
'Edexfre'oo) und bezeugt an einer anderen Stelle (V 82)
die Kultgemeinschaft der Athena und des Ereehtheus.
Vgl. Ath. Mitt. XII, 1887, S. 62 [Petersen]. Vgl. auch
die Anm. auf S. 1.
*) Daß so der Sachverhalt ist, hat unter anderen
(z. B. Milchhöfer, Frazer) Michaelis dargetan, Jahrb.
d. arch. Inst. XVI, 1901, S. 1—31. Dörpfeld freilich
beharrt bei seiner Ansicht, daß wir in dem Heka-
tompedon den >alten Tempel« sehen müssen, hat
aber die Beweisführung von Michaelis in den Haupt-
punkten nicht entkräftet.
s) Hauptwerk: "Wiegand, die archaische Poros-
architektur der Akropolis zu Athen, 1904.
1*