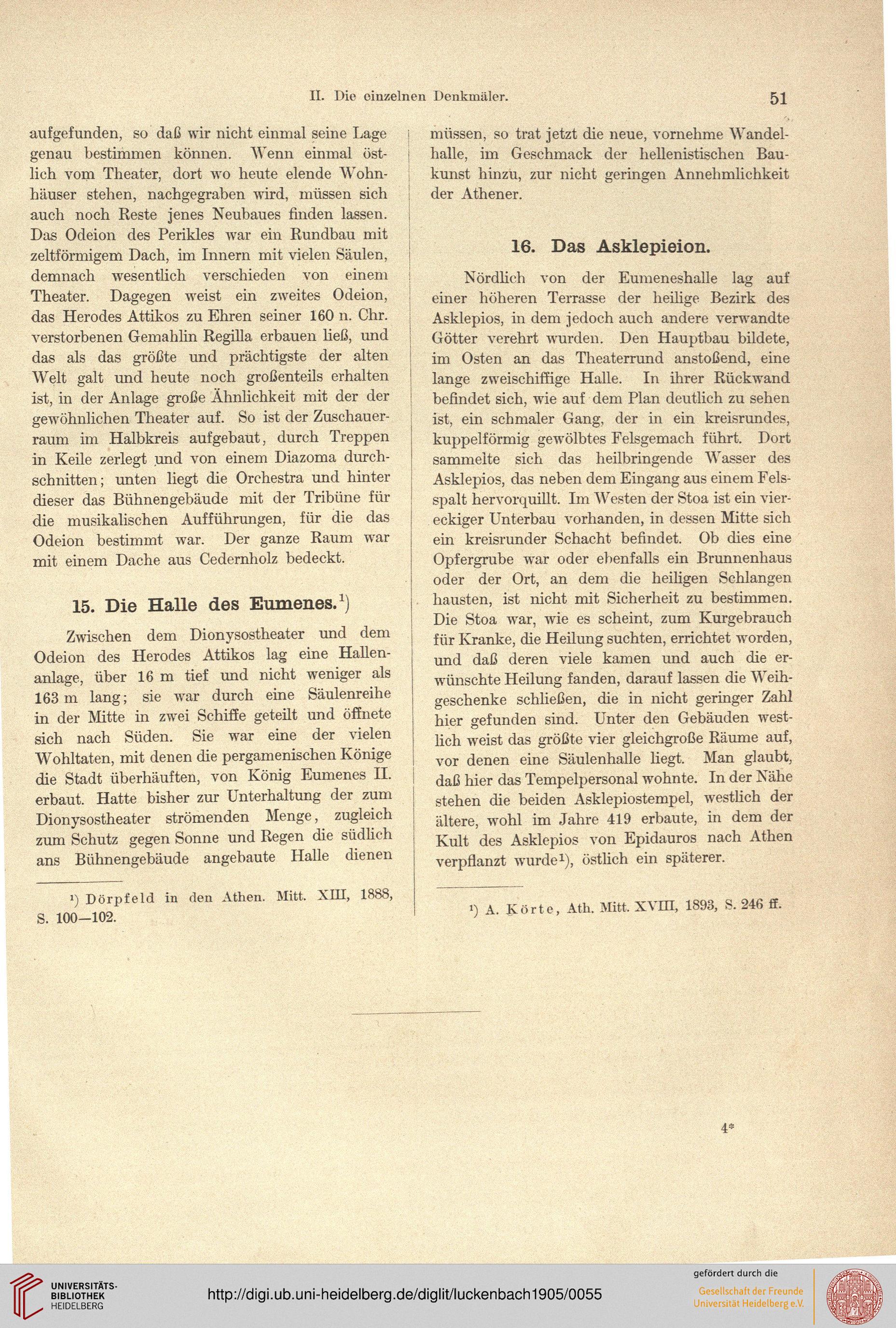II. Die einzelnen Denkmäler.
51
aufgefunden, so daß wir nicht einmal seine Lage
genau bestimmen können. Wenn einmal öst-
lich vom Theater, dort wo heute elende Wohn-
häuser stehen, nachgegraben wird, müssen sich
auch noch Reste jenes Neubaues finden lassen.
Das Odeion des Perikles war ein Rundbau mit
zeltförmigem Dach, im Innern mit vielen Säulen,
demnach wesentlich verschieden von einem
Theater. Dagegen weist ein zweites Odeion,
das Herodes Attikos zu Ehren seiner 160 n. Chr.
verstorbenen Gemahlin Regula erbauen ließ, und
das als das größte und prächtigste der alten
Welt galt und heute noch großenteils erhalten
ist, in der Anlage große Ähnlichkeit mit der der
gewöhnlichen Theater auf. So ist der Zuschauer-
raum im Halbkreis aufgebaut, durch Treppen
in Keile zerlegt und von einem Diazoma durch-
schnitten; unten liegt die Orchestra und hinter
dieser das Bühnengebäude mit der Tribüne für
die musikalischen Aufführungen, für die das
Odeion bestimmt war. Der ganze Raum war
mit einem Dache aus Cedernholz bedeckt.
15. Die Halle des Eumenes.1)
Zwischen dem Dionysostheater und dem
Odeion des Herodes Attikos lag eine Hallen-
anlage, über 16 m tief und nicht weniger als
163 m lang; sie war durch eine Säulenreihe
in der Mitte in zwei Schiffe geteilt und öffnete
sich nach Süden. Sie war eine der vielen
Wohltaten, mit denen die pergamenischen Könige
die Stadt überhäuften, von König Eumenes IL
erbaut. Hatte bisher zur Unterhaltung der zum
Dionysostheater strömenden Menge, zugleich
zum Schutz gegen Sonne und Regen die südlich
ans Bühnengebäude angebaute Halle dienen
') Dörpfeld in den Athen. Mitt. XIII, 1888,
S. 100-102.
müssen, so trat jetzt die neue, vornehme Wandel-
halle, im Geschmack der hellenistischen Bau-
kunst hinzu, zur nicht geringen Annehmlichkeit
der Athener.
16. Das Asklepieion.
Nördlich von der Eumeneshalle lag auf
einer höheren Terrasse der heilige Bezirk des
Asklepios, in dem jedoch auch andere verwandte
Götter verehrt wurden. Den Hauptbau bildete,
im Osten an das Theaterrund anstoßend, eine
lange zweischiffige Halle. In ihrer Rückwand
befindet sich, wie auf dem Plan deutlich zu sehen
ist, ein schmaler Gang, der in ein kreisrundes,
kuppeiförmig gewölbtes Felsgemach führt. Dort
sammelte sich das heilbringende Wasser des
Asklepios, das neben dem Eingang aus einem Fels-
spalt hervorquillt. Im Westen der Stoa ist ein vier-
eckiger Unterbau vorhanden, in dessen Mitte sich
ein kreisrunder Schacht befindet. Ob dies eine
Opfergrube war oder ebenfalls ein Brunnenhaus
oder der Ort, an dem die heiligen Schlangen
hausten, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen.
Die Stoa war, wie es scheint, zum Kurgebrauch
für Kranke, die Heilung suchten, errichtet worden,
und daß deren viele kamen und auch die er-
wünschte Heilung fanden, darauf lassen die Weih-
geschenke schließen, die in nicht geringer Zahl
hier gefunden sind. Unter den Gebäuden west-
lich weist das größte vier gleichgroße Räume auf,
vor denen eine Säulenhalle liegt. Man glaubt,
daß hier das Tempelpersonal wohnte. In der Nähe
stehen die beiden Asklepiostempel, westlich der
ältere, wohl im Jahre 419 erbaute, in dem der
Kult des Asklepios von Epidauros nach Athen
verpflanzt wurde1), östlich ein späterer.
«) A. Körte, Ath. Mitt. XVffl, 1893, S. 246 ff.
51
aufgefunden, so daß wir nicht einmal seine Lage
genau bestimmen können. Wenn einmal öst-
lich vom Theater, dort wo heute elende Wohn-
häuser stehen, nachgegraben wird, müssen sich
auch noch Reste jenes Neubaues finden lassen.
Das Odeion des Perikles war ein Rundbau mit
zeltförmigem Dach, im Innern mit vielen Säulen,
demnach wesentlich verschieden von einem
Theater. Dagegen weist ein zweites Odeion,
das Herodes Attikos zu Ehren seiner 160 n. Chr.
verstorbenen Gemahlin Regula erbauen ließ, und
das als das größte und prächtigste der alten
Welt galt und heute noch großenteils erhalten
ist, in der Anlage große Ähnlichkeit mit der der
gewöhnlichen Theater auf. So ist der Zuschauer-
raum im Halbkreis aufgebaut, durch Treppen
in Keile zerlegt und von einem Diazoma durch-
schnitten; unten liegt die Orchestra und hinter
dieser das Bühnengebäude mit der Tribüne für
die musikalischen Aufführungen, für die das
Odeion bestimmt war. Der ganze Raum war
mit einem Dache aus Cedernholz bedeckt.
15. Die Halle des Eumenes.1)
Zwischen dem Dionysostheater und dem
Odeion des Herodes Attikos lag eine Hallen-
anlage, über 16 m tief und nicht weniger als
163 m lang; sie war durch eine Säulenreihe
in der Mitte in zwei Schiffe geteilt und öffnete
sich nach Süden. Sie war eine der vielen
Wohltaten, mit denen die pergamenischen Könige
die Stadt überhäuften, von König Eumenes IL
erbaut. Hatte bisher zur Unterhaltung der zum
Dionysostheater strömenden Menge, zugleich
zum Schutz gegen Sonne und Regen die südlich
ans Bühnengebäude angebaute Halle dienen
') Dörpfeld in den Athen. Mitt. XIII, 1888,
S. 100-102.
müssen, so trat jetzt die neue, vornehme Wandel-
halle, im Geschmack der hellenistischen Bau-
kunst hinzu, zur nicht geringen Annehmlichkeit
der Athener.
16. Das Asklepieion.
Nördlich von der Eumeneshalle lag auf
einer höheren Terrasse der heilige Bezirk des
Asklepios, in dem jedoch auch andere verwandte
Götter verehrt wurden. Den Hauptbau bildete,
im Osten an das Theaterrund anstoßend, eine
lange zweischiffige Halle. In ihrer Rückwand
befindet sich, wie auf dem Plan deutlich zu sehen
ist, ein schmaler Gang, der in ein kreisrundes,
kuppeiförmig gewölbtes Felsgemach führt. Dort
sammelte sich das heilbringende Wasser des
Asklepios, das neben dem Eingang aus einem Fels-
spalt hervorquillt. Im Westen der Stoa ist ein vier-
eckiger Unterbau vorhanden, in dessen Mitte sich
ein kreisrunder Schacht befindet. Ob dies eine
Opfergrube war oder ebenfalls ein Brunnenhaus
oder der Ort, an dem die heiligen Schlangen
hausten, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen.
Die Stoa war, wie es scheint, zum Kurgebrauch
für Kranke, die Heilung suchten, errichtet worden,
und daß deren viele kamen und auch die er-
wünschte Heilung fanden, darauf lassen die Weih-
geschenke schließen, die in nicht geringer Zahl
hier gefunden sind. Unter den Gebäuden west-
lich weist das größte vier gleichgroße Räume auf,
vor denen eine Säulenhalle liegt. Man glaubt,
daß hier das Tempelpersonal wohnte. In der Nähe
stehen die beiden Asklepiostempel, westlich der
ältere, wohl im Jahre 419 erbaute, in dem der
Kult des Asklepios von Epidauros nach Athen
verpflanzt wurde1), östlich ein späterer.
«) A. Körte, Ath. Mitt. XVffl, 1893, S. 246 ff.