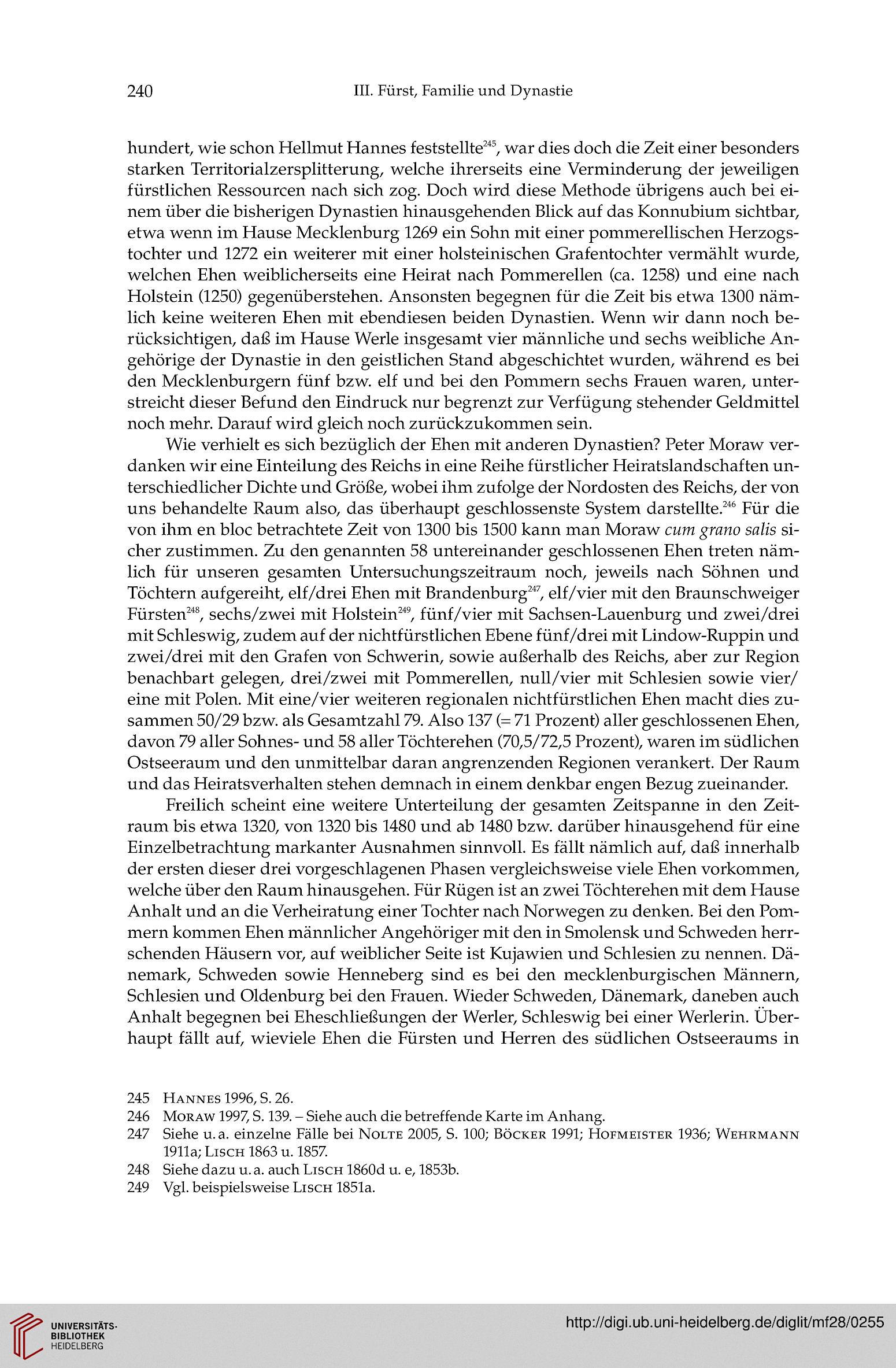240
III. Fürst, Familie und Dynastie
hundert, wie schon Hellmut Hannes feststellte'G war dies doch die Zeit einer besonders
starken Territorialzersplitterung, welche ihrerseits eine Verminderung der jeweiligen
fürstlichen Ressourcen nach sich zog. Doch wird diese Methode übrigens auch bei ei-
nem über die bisherigen Dynastien hinausgehenden Blick auf das Konnubium sichtbar,
etwa wenn im Hause Mecklenburg 1269 ein Sohn mit einer pommerellischen Herzogs-
tochter und 1272 ein weiterer mit einer holsteinischen Grafentochter vermählt wurde,
welchen Ehen weiblicherseits eine Heirat nach Pommerellen (ca. 1258) und eine nach
Holstein (1250) gegenüberstehen. Ansonsten begegnen für die Zeit bis etwa 1300 näm-
lich keine weiteren Ehen mit ebendiesen beiden Dynastien. Wenn wir dann noch be-
rücksichtigen, daß im Hause Werle insgesamt vier männliche und sechs weibliche An-
gehörige der Dynastie in den geistlichen Stand abgeschichtet wurden, während es bei
den Mecklenburgern fünf bzw. elf und bei den Pommern sechs Frauen waren, unter-
streicht dieser Befund den Eindruck nur begrenzt zur Verfügung stehender Geldmittel
noch mehr. Darauf wird gleich noch zurückzukommen sein.
Wie verhielt es sich bezüglich der Ehen mit anderen Dynastien? Peter Moraw ver-
danken wir eine Einteilung des Reichs in eine Reihe fürstlicher Heiratslandschaften un-
terschiedlicher Dichte und Größe, wobei ihm zufolge der Nordosten des Reichs, der von
uns behandelte Raum also, das überhaupt geschlossenste System darstellteV' Für die
von ihm en bloc betrachtete Zeit von 1300 bis 1500 kann man Moraw c;un saü's si-
cher zustimmen. Zu den genannten 58 untereinander geschlossenen Ehen treten näm-
lich für unseren gesamten Untersuchungszeitraum noch, jeweils nach Söhnen und
Töchtern auf gereiht, elf/drei Ehen mit Brandenburg*^, elf/vier mit den Braunschweiger
Fürsten^, sechs/zwei mit Holstein*^, fünf/vier mit Sachsen-Lauenburg und zwei/drei
mit Schleswig, zudem auf der nichtfürstlichen Ebene fünf/drei mit Lindow-Ruppin und
zwei/drei mit den Grafen von Schwerin, sowie außerhalb des Reichs, aber zur Region
benachbart gelegen, drei/zwei mit Pommerellen, null/vier mit Schlesien sowie vier/
eine mit Polen. Mit eine/vier weiteren regionalen nichtfürstlichen Ehen macht dies zu-
sammen 50/29 bzw. als Gesamtzahl 79. Also 137 (= 71 Prozent) aller geschlossenen Ehen,
davon 79 aller Sohnes- und 58 aller Töchterehen (70,5/72,5 Prozent), waren im südlichen
Ostseeraum und den unmittelbar daran angrenzenden Regionen verankert. Der Raum
und das Heiratsverhalten stehen demnach in einem denkbar engen Bezug zueinander.
Freilich scheint eine weitere Unterteilung der gesamten Zeitspanne in den Zeit-
raum bis etwa 1320, von 1320 bis 1480 und ab 1480 bzw. darüber hinausgehend für eine
Einzelbetrachtung markanter Ausnahmen sinnvoll. Es fällt nämlich auf, daß innerhalb
der ersten dieser drei vorgeschlagenen Phasen vergleichsweise viele Ehen Vorkommen,
welche über den Raum hinausgehen. Für Rügen ist an zwei Töchterehen mit dem Hause
Anhalt und an die Verheiratung einer Tochter nach Norwegen zu denken. Bei den Pom-
mern kommen Ehen männlicher Angehöriger mit den in Smolensk und Schweden herr-
schenden Häusern vor, auf weiblicher Seite ist Kujawien und Schlesien zu nennen. Dä-
nemark, Schweden sowie Henneberg sind es bei den mecklenburgischen Männern,
Schlesien und Oldenburg bei den Frauen. Wieder Schweden, Dänemark, daneben auch
Anhalt begegnen bei Eheschließungen der Werler, Schleswig bei einer Werlerin. Über-
haupt fällt auf, wieviele Ehen die Fürsten und Herren des südlichen Ostseeraums in
245 HANNES 1996, S. 26.
246 MoRAw 199/ S. 139. - Siehe auch die betreffende Karte im Anhang.
247 Siehe u. a. einzelne Fälle bei NoLTE 2005, S. 100; BÖCKER 1991; HOFMEISTER 1936; WEHRMANN
1911a; LiscH 1863 u. 1857.
248 Siehe dazu u. a. auch LiscH 1860d u. e, 1853b.
249 Vgl. beispielsweise LiscH 1851a.
III. Fürst, Familie und Dynastie
hundert, wie schon Hellmut Hannes feststellte'G war dies doch die Zeit einer besonders
starken Territorialzersplitterung, welche ihrerseits eine Verminderung der jeweiligen
fürstlichen Ressourcen nach sich zog. Doch wird diese Methode übrigens auch bei ei-
nem über die bisherigen Dynastien hinausgehenden Blick auf das Konnubium sichtbar,
etwa wenn im Hause Mecklenburg 1269 ein Sohn mit einer pommerellischen Herzogs-
tochter und 1272 ein weiterer mit einer holsteinischen Grafentochter vermählt wurde,
welchen Ehen weiblicherseits eine Heirat nach Pommerellen (ca. 1258) und eine nach
Holstein (1250) gegenüberstehen. Ansonsten begegnen für die Zeit bis etwa 1300 näm-
lich keine weiteren Ehen mit ebendiesen beiden Dynastien. Wenn wir dann noch be-
rücksichtigen, daß im Hause Werle insgesamt vier männliche und sechs weibliche An-
gehörige der Dynastie in den geistlichen Stand abgeschichtet wurden, während es bei
den Mecklenburgern fünf bzw. elf und bei den Pommern sechs Frauen waren, unter-
streicht dieser Befund den Eindruck nur begrenzt zur Verfügung stehender Geldmittel
noch mehr. Darauf wird gleich noch zurückzukommen sein.
Wie verhielt es sich bezüglich der Ehen mit anderen Dynastien? Peter Moraw ver-
danken wir eine Einteilung des Reichs in eine Reihe fürstlicher Heiratslandschaften un-
terschiedlicher Dichte und Größe, wobei ihm zufolge der Nordosten des Reichs, der von
uns behandelte Raum also, das überhaupt geschlossenste System darstellteV' Für die
von ihm en bloc betrachtete Zeit von 1300 bis 1500 kann man Moraw c;un saü's si-
cher zustimmen. Zu den genannten 58 untereinander geschlossenen Ehen treten näm-
lich für unseren gesamten Untersuchungszeitraum noch, jeweils nach Söhnen und
Töchtern auf gereiht, elf/drei Ehen mit Brandenburg*^, elf/vier mit den Braunschweiger
Fürsten^, sechs/zwei mit Holstein*^, fünf/vier mit Sachsen-Lauenburg und zwei/drei
mit Schleswig, zudem auf der nichtfürstlichen Ebene fünf/drei mit Lindow-Ruppin und
zwei/drei mit den Grafen von Schwerin, sowie außerhalb des Reichs, aber zur Region
benachbart gelegen, drei/zwei mit Pommerellen, null/vier mit Schlesien sowie vier/
eine mit Polen. Mit eine/vier weiteren regionalen nichtfürstlichen Ehen macht dies zu-
sammen 50/29 bzw. als Gesamtzahl 79. Also 137 (= 71 Prozent) aller geschlossenen Ehen,
davon 79 aller Sohnes- und 58 aller Töchterehen (70,5/72,5 Prozent), waren im südlichen
Ostseeraum und den unmittelbar daran angrenzenden Regionen verankert. Der Raum
und das Heiratsverhalten stehen demnach in einem denkbar engen Bezug zueinander.
Freilich scheint eine weitere Unterteilung der gesamten Zeitspanne in den Zeit-
raum bis etwa 1320, von 1320 bis 1480 und ab 1480 bzw. darüber hinausgehend für eine
Einzelbetrachtung markanter Ausnahmen sinnvoll. Es fällt nämlich auf, daß innerhalb
der ersten dieser drei vorgeschlagenen Phasen vergleichsweise viele Ehen Vorkommen,
welche über den Raum hinausgehen. Für Rügen ist an zwei Töchterehen mit dem Hause
Anhalt und an die Verheiratung einer Tochter nach Norwegen zu denken. Bei den Pom-
mern kommen Ehen männlicher Angehöriger mit den in Smolensk und Schweden herr-
schenden Häusern vor, auf weiblicher Seite ist Kujawien und Schlesien zu nennen. Dä-
nemark, Schweden sowie Henneberg sind es bei den mecklenburgischen Männern,
Schlesien und Oldenburg bei den Frauen. Wieder Schweden, Dänemark, daneben auch
Anhalt begegnen bei Eheschließungen der Werler, Schleswig bei einer Werlerin. Über-
haupt fällt auf, wieviele Ehen die Fürsten und Herren des südlichen Ostseeraums in
245 HANNES 1996, S. 26.
246 MoRAw 199/ S. 139. - Siehe auch die betreffende Karte im Anhang.
247 Siehe u. a. einzelne Fälle bei NoLTE 2005, S. 100; BÖCKER 1991; HOFMEISTER 1936; WEHRMANN
1911a; LiscH 1863 u. 1857.
248 Siehe dazu u. a. auch LiscH 1860d u. e, 1853b.
249 Vgl. beispielsweise LiscH 1851a.