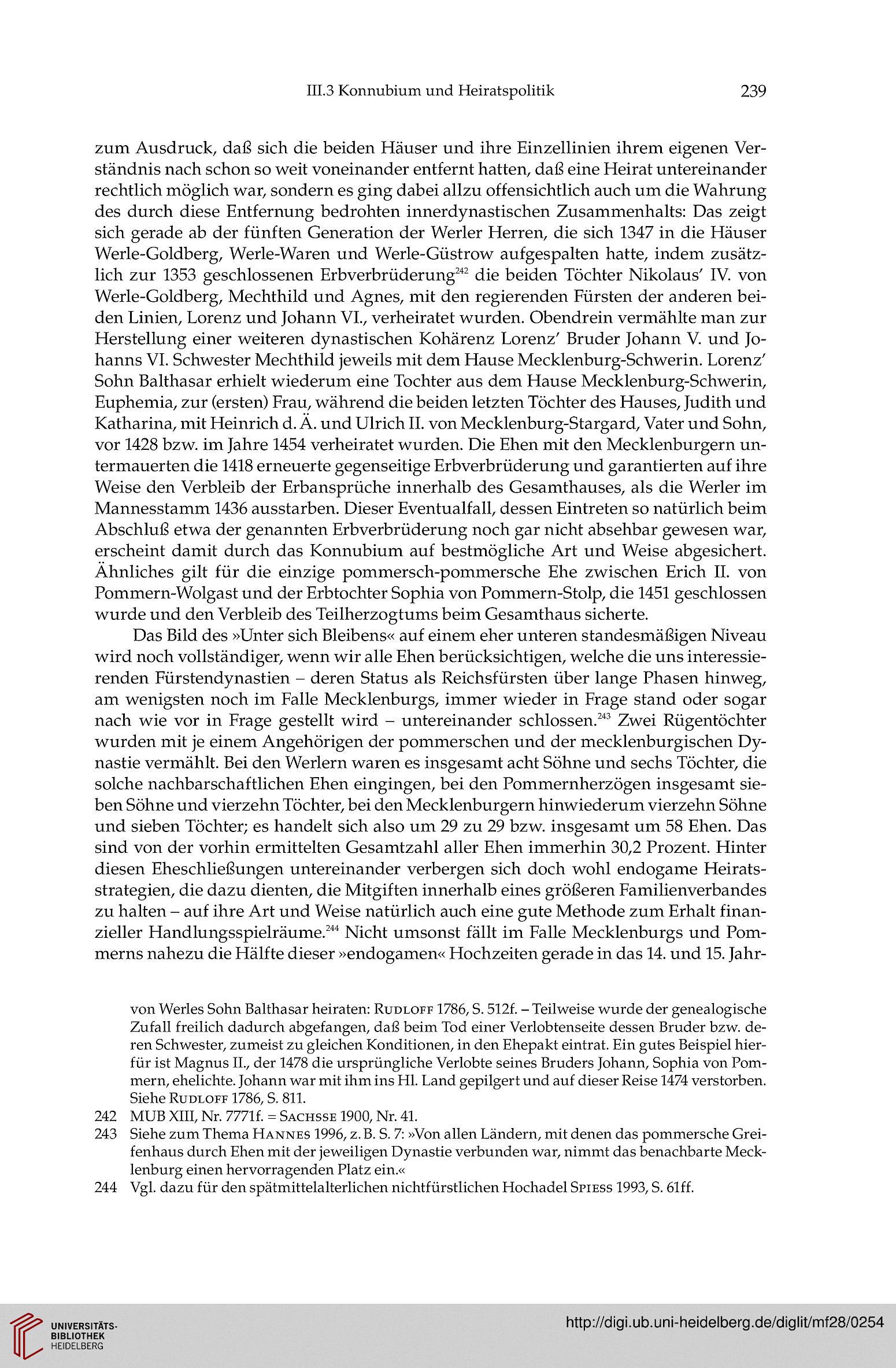111.3 Konnubium und Heiratspolitik
239
zum Ausdruck, daß sich die beiden Häuser und ihre Einzellinien ihrem eigenen Ver-
ständnis nach schon so weit voneinander entfernt hatten, daß eine Heirat untereinander
rechtlich möglich war, sondern es ging dabei allzu offensichtlich auch um die Wahrung
des durch diese Entfernung bedrohten innerdynastischen Zusammenhalts: Das zeigt
sich gerade ab der fünften Generation der Werler Herren, die sich 1347 in die Häuser
Werle-Goldberg, Werle-Waren und Werle-Güstrow aufgespalten hatte, indem zusätz-
lich zur 1353 geschlossenen Erbverbrüderung^ die beiden Töchter Nikolaus' IV. von
Werle-Goldberg, Mechthild und Agnes, mit den regierenden Fürsten der anderen bei-
den Linien, Lorenz und Johann VI., verheiratet wurden. Obendrein vermählte man zur
Herstellung einer weiteren dynastischen Kohärenz Lorenz' Bruder Johann V. und Jo-
hanns VI. Schwester Mechthild jeweils mit dem Hause Mecklenburg-Schwerin. Lorenz'
Sohn Balthasar erhielt wiederum eine Tochter aus dem Hause Mecklenburg-Schwerin,
Euphemia, zur (ersten) Frau, während die beiden letzten Töchter des Hauses, Judith und
Katharina, mit Heinrich d. Ä. und Ulrich II. von Mecklenburg-Stargard, Vater und Sohn,
vor 1428 bzw. im Jahre 1454 verheiratet wurden. Die Ehen mit den Mecklenburgern un-
termauerten die 1418 erneuerte gegenseitige Erbverbrüderung und garantierten auf ihre
Weise den Verbleib der Erbansprüche innerhalb des Gesamthauses, als die Werler im
Mannesstamm 1436 ausstarben. Dieser Eventualfall, dessen Eintreten so natürlich beim
Abschluß etwa der genannten Erbverbrüderung noch gar nicht absehbar gewesen war,
erscheint damit durch das Konnubium auf bestmögliche Art und Weise abgesichert.
Ähnliches gilt für die einzige pommersch-pommersche Ehe zwischen Erich II. von
Pommern-Wolgast und der Erbtochter Sophia von Pommern-Stolp, die 1451 geschlossen
wurde und den Verbleib des Teilherzogtums beim Gesamthaus sicherte.
Das Bild des »Unter sich Bleibens« auf einem eher unteren standesmäßigen Niveau
wird noch vollständiger, wenn wir alle Ehen berücksichtigen, welche die uns interessie-
renden Fürstendynastien - deren Status als Reichsfürsten über lange Phasen hinweg,
am wenigsten noch im Falle Mecklenburgs, immer wieder in Frage stand oder sogar
nach wie vor in Frage gestellt wird - untereinander schlossen.^ Zwei Rügentöchter
wurden mit je einem Angehörigen der pommerschen und der mecklenburgischen Dy-
nastie vermählt. Bei den Werlern waren es insgesamt acht Söhne und sechs Töchter, die
solche nachbarschaftlichen Ehen eingingen, bei den Pommernherzögen insgesamt sie-
ben Söhne und vierzehn Töchter, bei den Mecklenburgern hinwiederum vierzehn Söhne
und sieben Töchter; es handelt sich also um 29 zu 29 bzw. insgesamt um 58 Ehen. Das
sind von der vorhin ermittelten Gesamtzahl aller Ehen immerhin 30,2 Prozent. Hinter
diesen Eheschließungen untereinander verbergen sich doch wohl endogame Heirats-
strategien, die dazu dienten, die Mitgiften innerhalb eines größeren Familienverbandes
zu halten - auf ihre Art und Weise natürlich auch eine gute Methode zum Erhalt finan-
zieller Handlungsspielräume. ^ Nicht umsonst fällt im Falle Mecklenburgs und Pom-
merns nahezu die Hälfte dieser »endogamen« Hochzeiten gerade in das 14. und 15. Jahr-
von Wertes Sohn Balthasar heiraten: RuDLorr 1786, S. 512f. - Teilweise wurde der genealogische
Zufall freilich dadurch abgefangen, daß beim Tod einer Verlobtenseite dessen Bruder bzw. de-
ren Schwester, zumeist zu gleichen Konditionen, in den Ehepakt eintrat. Ein gutes Beispiel hier-
für ist Magnus II., der 1478 die ursprüngliche Verlobte seines Bruders Johann, Sophia von Pom-
mern, ehelichte. Johann war mit ihm ins Hl. Land gepilgert und auf dieser Reise 1474 verstorben.
Siehe RuDLOFF 1786, S. 811.
242 MUB XIII, Nr. 7771f. = SACHSSE 1900, Nr. 41.
243 Siehe zum Thema HANNES 1996, z. B. S. 7: »Von allen Ländern, mit denen das pommersche Grei-
fenhaus durch Ehen mit der jeweiligen Dynastie verbunden war, nimmt das benachbarte Meck-
lenburg einen hervorragenden Platz ein.«
244 Vgl. dazu für den spätmittelalterlichen nichtfürstlichen Hochadel SriESS 1993, S. 61ff.
239
zum Ausdruck, daß sich die beiden Häuser und ihre Einzellinien ihrem eigenen Ver-
ständnis nach schon so weit voneinander entfernt hatten, daß eine Heirat untereinander
rechtlich möglich war, sondern es ging dabei allzu offensichtlich auch um die Wahrung
des durch diese Entfernung bedrohten innerdynastischen Zusammenhalts: Das zeigt
sich gerade ab der fünften Generation der Werler Herren, die sich 1347 in die Häuser
Werle-Goldberg, Werle-Waren und Werle-Güstrow aufgespalten hatte, indem zusätz-
lich zur 1353 geschlossenen Erbverbrüderung^ die beiden Töchter Nikolaus' IV. von
Werle-Goldberg, Mechthild und Agnes, mit den regierenden Fürsten der anderen bei-
den Linien, Lorenz und Johann VI., verheiratet wurden. Obendrein vermählte man zur
Herstellung einer weiteren dynastischen Kohärenz Lorenz' Bruder Johann V. und Jo-
hanns VI. Schwester Mechthild jeweils mit dem Hause Mecklenburg-Schwerin. Lorenz'
Sohn Balthasar erhielt wiederum eine Tochter aus dem Hause Mecklenburg-Schwerin,
Euphemia, zur (ersten) Frau, während die beiden letzten Töchter des Hauses, Judith und
Katharina, mit Heinrich d. Ä. und Ulrich II. von Mecklenburg-Stargard, Vater und Sohn,
vor 1428 bzw. im Jahre 1454 verheiratet wurden. Die Ehen mit den Mecklenburgern un-
termauerten die 1418 erneuerte gegenseitige Erbverbrüderung und garantierten auf ihre
Weise den Verbleib der Erbansprüche innerhalb des Gesamthauses, als die Werler im
Mannesstamm 1436 ausstarben. Dieser Eventualfall, dessen Eintreten so natürlich beim
Abschluß etwa der genannten Erbverbrüderung noch gar nicht absehbar gewesen war,
erscheint damit durch das Konnubium auf bestmögliche Art und Weise abgesichert.
Ähnliches gilt für die einzige pommersch-pommersche Ehe zwischen Erich II. von
Pommern-Wolgast und der Erbtochter Sophia von Pommern-Stolp, die 1451 geschlossen
wurde und den Verbleib des Teilherzogtums beim Gesamthaus sicherte.
Das Bild des »Unter sich Bleibens« auf einem eher unteren standesmäßigen Niveau
wird noch vollständiger, wenn wir alle Ehen berücksichtigen, welche die uns interessie-
renden Fürstendynastien - deren Status als Reichsfürsten über lange Phasen hinweg,
am wenigsten noch im Falle Mecklenburgs, immer wieder in Frage stand oder sogar
nach wie vor in Frage gestellt wird - untereinander schlossen.^ Zwei Rügentöchter
wurden mit je einem Angehörigen der pommerschen und der mecklenburgischen Dy-
nastie vermählt. Bei den Werlern waren es insgesamt acht Söhne und sechs Töchter, die
solche nachbarschaftlichen Ehen eingingen, bei den Pommernherzögen insgesamt sie-
ben Söhne und vierzehn Töchter, bei den Mecklenburgern hinwiederum vierzehn Söhne
und sieben Töchter; es handelt sich also um 29 zu 29 bzw. insgesamt um 58 Ehen. Das
sind von der vorhin ermittelten Gesamtzahl aller Ehen immerhin 30,2 Prozent. Hinter
diesen Eheschließungen untereinander verbergen sich doch wohl endogame Heirats-
strategien, die dazu dienten, die Mitgiften innerhalb eines größeren Familienverbandes
zu halten - auf ihre Art und Weise natürlich auch eine gute Methode zum Erhalt finan-
zieller Handlungsspielräume. ^ Nicht umsonst fällt im Falle Mecklenburgs und Pom-
merns nahezu die Hälfte dieser »endogamen« Hochzeiten gerade in das 14. und 15. Jahr-
von Wertes Sohn Balthasar heiraten: RuDLorr 1786, S. 512f. - Teilweise wurde der genealogische
Zufall freilich dadurch abgefangen, daß beim Tod einer Verlobtenseite dessen Bruder bzw. de-
ren Schwester, zumeist zu gleichen Konditionen, in den Ehepakt eintrat. Ein gutes Beispiel hier-
für ist Magnus II., der 1478 die ursprüngliche Verlobte seines Bruders Johann, Sophia von Pom-
mern, ehelichte. Johann war mit ihm ins Hl. Land gepilgert und auf dieser Reise 1474 verstorben.
Siehe RuDLOFF 1786, S. 811.
242 MUB XIII, Nr. 7771f. = SACHSSE 1900, Nr. 41.
243 Siehe zum Thema HANNES 1996, z. B. S. 7: »Von allen Ländern, mit denen das pommersche Grei-
fenhaus durch Ehen mit der jeweiligen Dynastie verbunden war, nimmt das benachbarte Meck-
lenburg einen hervorragenden Platz ein.«
244 Vgl. dazu für den spätmittelalterlichen nichtfürstlichen Hochadel SriESS 1993, S. 61ff.