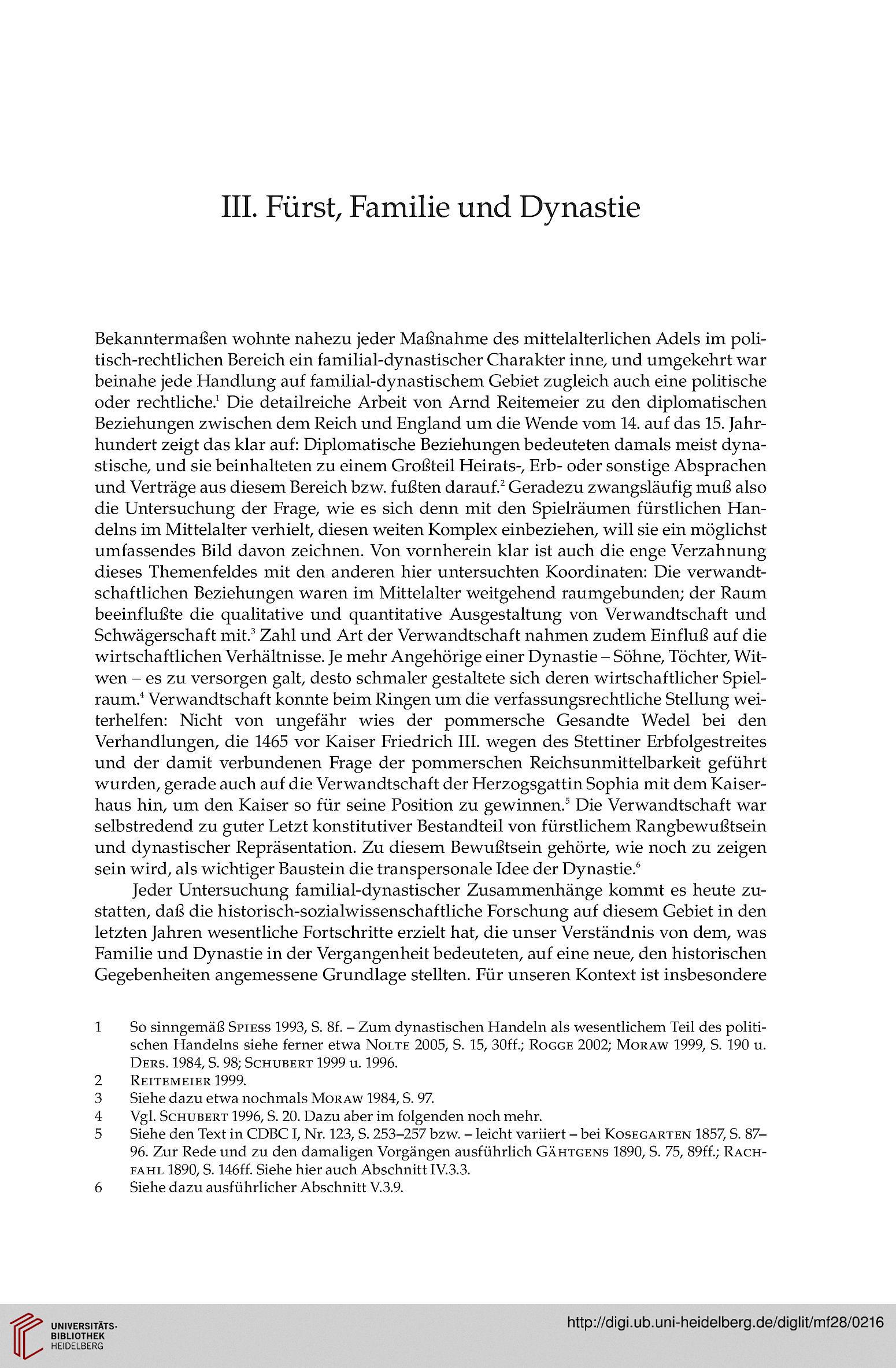III. Fürst, Familie und Dynastie
Bekanntermaßen wohnte nahezu jeder Maßnahme des mittelalterlichen Adels im poli-
tisch-rechtlichen Bereich ein familial-dynastischer Charakter inne, und umgekehrt war
beinahe jede Handlung auf familial-dynastischem Gebiet zugleich auch eine politische
oder rechtliche/ Die detailreiche Arbeit von Arnd Reitemeier zu den diplomatischen
Beziehungen zwischen dem Reich und England um die Wende vom 14. auf das 15. Jahr-
hundert zeigt das klar auf: Diplomatische Beziehungen bedeuteten damals meist dyna-
stische, und sie beinhalteten zu einem Großteil Heirats-, Erb- oder sonstige Absprachen
und Verträge aus diesem Bereich bzw. fußten darauf.' Geradezu zwangsläufig muß also
die Untersuchung der Frage, wie es sich denn mit den Spielräumen fürstlichen Han-
delns im Mittelalter verhielt, diesen weiten Komplex einbeziehen, will sie ein möglichst
umfassendes Bild davon zeichnen. Von vornherein klar ist auch die enge Verzahnung
dieses Themenfeldes mit den anderen hier untersuchten Koordinaten: Die verwandt-
schaftlichen Beziehungen waren im Mittelalter weitgehend raumgebunden; der Raum
beeinflußte die qualitative und quantitative Ausgestaltung von Verwandtschaft und
Schwägerschaft mit. Zahl und Art der Verwandtschaft nahmen zudem Einfluß auf die
wirtschaftlichen Verhältnisse. Je mehr Angehörige einer Dynastie - Söhne, Töchter, Wit-
wen - es zu versorgen galt, desto schmaler gestaltete sich deren wirtschaftlicher Spiel-
raum/ Verwandtschaft konnte beim Ringen um die verfassungsrechtliche Stellung wei-
terhelfen: Nicht von ungefähr wies der pommersche Gesandte Wedel bei den
Verhandlungen, die 1465 vor Kaiser Friedrich III. wegen des Stettiner Erbfolgestreites
und der damit verbundenen Frage der pommerschen Reichsunmittelbarkeit geführt
wurden, gerade auch auf die Verwandtschaft der Herzogsgattin Sophia mit dem Kaiser-
haus hin, um den Kaiser so für seine Position zu gewinnen/ Die Verwandtschaft war
selbstredend zu guter Letzt konstitutiver Bestandteil von fürstlichem Rangbewußtsein
und dynastischer Repräsentation. Zu diesem Bewußtsein gehörte, wie noch zu zeigen
sein wird, als wichtiger Baustein die transpersonale Idee der Dynastie/
Jeder Untersuchung familial-dynastischer Zusammenhänge kommt es heute zu-
statten, daß die historisch-sozialwissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet in den
letzten Jahren wesentliche Fortschritte erzielt hat, die unser Verständnis von dem, was
Familie und Dynastie in der Vergangenheit bedeuteten, auf eine neue, den historischen
Gegebenheiten angemessene Grundlage stellten. Für unseren Kontext ist insbesondere
1 So sinngemäß SriESS 1993, S. 8f. - Zum dynastischen Handeln als wesentlichem Teil des politi-
schen Handelns siehe ferner etwa NoLTE 2005, S. 15, 30ff.; RoGGE 2002; MoRAw 1999, S. 190 u.
DERS. 1984, S. 98; SCHUBERT 1999 u. 1996.
2 REITEMEIER 1999.
3 Siehe dazu etwa nochmals MoRAw 1984, S. 97.
4 Vgl. SCHUBERT 1996, S. 20. Dazu aber im folgenden noch mehr.
5 Siehe den Text in CDBC I, Nr. 123, S. 253-257 bzw. - leicht variiert - bei KosEGARTEN 1857, S. 87-
96. Zur Rede und zu den damaligen Vorgängen ausführlich GÄHTGENS 1890, S. 75, 89ff.; RACH-
FAHL 1890, S. 146ff. Siehe hier auch Abschnitt IV.3.3.
6 Siehe dazu ausführlicher Abschnitt V.3.9.
Bekanntermaßen wohnte nahezu jeder Maßnahme des mittelalterlichen Adels im poli-
tisch-rechtlichen Bereich ein familial-dynastischer Charakter inne, und umgekehrt war
beinahe jede Handlung auf familial-dynastischem Gebiet zugleich auch eine politische
oder rechtliche/ Die detailreiche Arbeit von Arnd Reitemeier zu den diplomatischen
Beziehungen zwischen dem Reich und England um die Wende vom 14. auf das 15. Jahr-
hundert zeigt das klar auf: Diplomatische Beziehungen bedeuteten damals meist dyna-
stische, und sie beinhalteten zu einem Großteil Heirats-, Erb- oder sonstige Absprachen
und Verträge aus diesem Bereich bzw. fußten darauf.' Geradezu zwangsläufig muß also
die Untersuchung der Frage, wie es sich denn mit den Spielräumen fürstlichen Han-
delns im Mittelalter verhielt, diesen weiten Komplex einbeziehen, will sie ein möglichst
umfassendes Bild davon zeichnen. Von vornherein klar ist auch die enge Verzahnung
dieses Themenfeldes mit den anderen hier untersuchten Koordinaten: Die verwandt-
schaftlichen Beziehungen waren im Mittelalter weitgehend raumgebunden; der Raum
beeinflußte die qualitative und quantitative Ausgestaltung von Verwandtschaft und
Schwägerschaft mit. Zahl und Art der Verwandtschaft nahmen zudem Einfluß auf die
wirtschaftlichen Verhältnisse. Je mehr Angehörige einer Dynastie - Söhne, Töchter, Wit-
wen - es zu versorgen galt, desto schmaler gestaltete sich deren wirtschaftlicher Spiel-
raum/ Verwandtschaft konnte beim Ringen um die verfassungsrechtliche Stellung wei-
terhelfen: Nicht von ungefähr wies der pommersche Gesandte Wedel bei den
Verhandlungen, die 1465 vor Kaiser Friedrich III. wegen des Stettiner Erbfolgestreites
und der damit verbundenen Frage der pommerschen Reichsunmittelbarkeit geführt
wurden, gerade auch auf die Verwandtschaft der Herzogsgattin Sophia mit dem Kaiser-
haus hin, um den Kaiser so für seine Position zu gewinnen/ Die Verwandtschaft war
selbstredend zu guter Letzt konstitutiver Bestandteil von fürstlichem Rangbewußtsein
und dynastischer Repräsentation. Zu diesem Bewußtsein gehörte, wie noch zu zeigen
sein wird, als wichtiger Baustein die transpersonale Idee der Dynastie/
Jeder Untersuchung familial-dynastischer Zusammenhänge kommt es heute zu-
statten, daß die historisch-sozialwissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet in den
letzten Jahren wesentliche Fortschritte erzielt hat, die unser Verständnis von dem, was
Familie und Dynastie in der Vergangenheit bedeuteten, auf eine neue, den historischen
Gegebenheiten angemessene Grundlage stellten. Für unseren Kontext ist insbesondere
1 So sinngemäß SriESS 1993, S. 8f. - Zum dynastischen Handeln als wesentlichem Teil des politi-
schen Handelns siehe ferner etwa NoLTE 2005, S. 15, 30ff.; RoGGE 2002; MoRAw 1999, S. 190 u.
DERS. 1984, S. 98; SCHUBERT 1999 u. 1996.
2 REITEMEIER 1999.
3 Siehe dazu etwa nochmals MoRAw 1984, S. 97.
4 Vgl. SCHUBERT 1996, S. 20. Dazu aber im folgenden noch mehr.
5 Siehe den Text in CDBC I, Nr. 123, S. 253-257 bzw. - leicht variiert - bei KosEGARTEN 1857, S. 87-
96. Zur Rede und zu den damaligen Vorgängen ausführlich GÄHTGENS 1890, S. 75, 89ff.; RACH-
FAHL 1890, S. 146ff. Siehe hier auch Abschnitt IV.3.3.
6 Siehe dazu ausführlicher Abschnitt V.3.9.