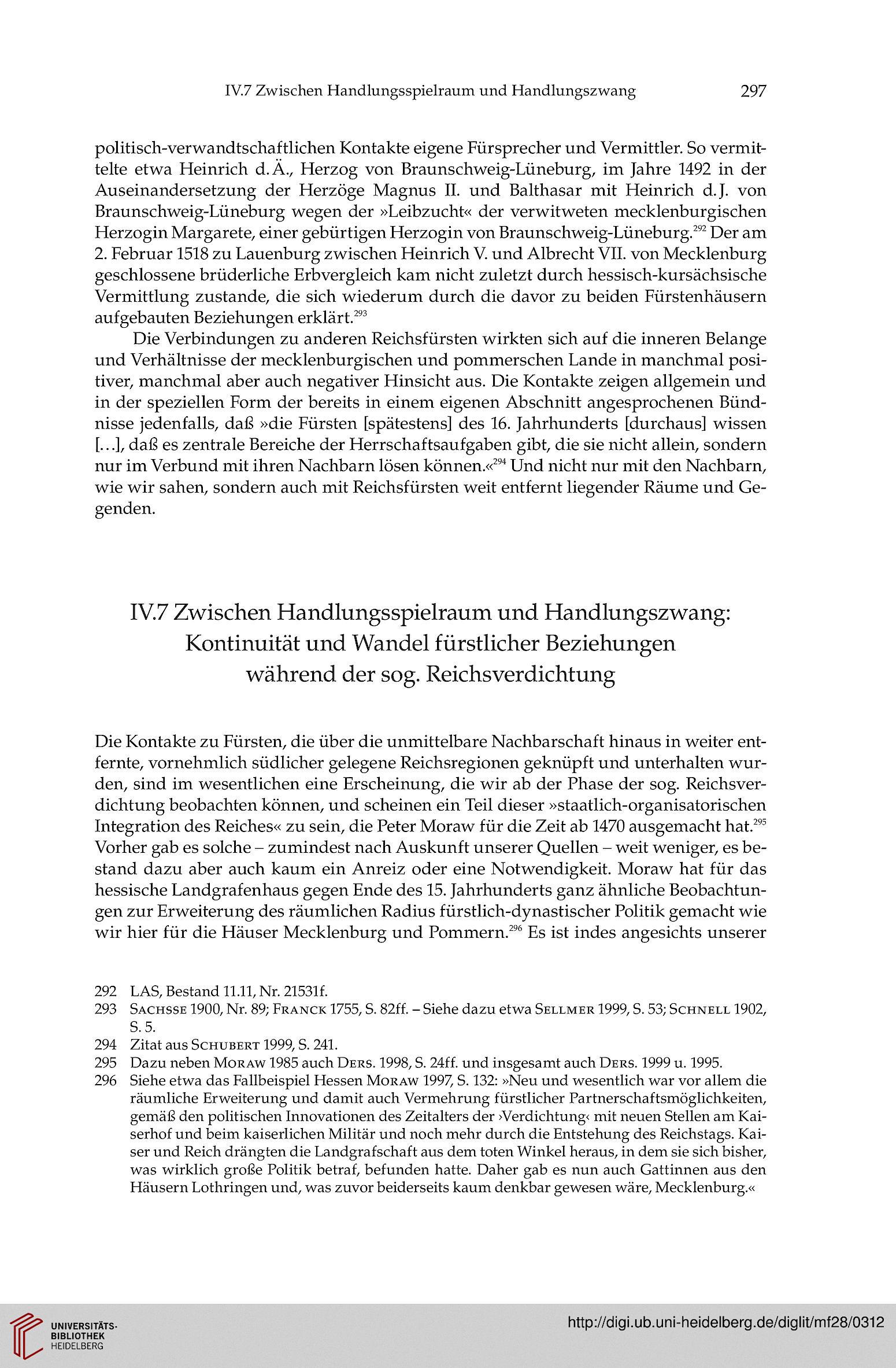IV.7 Zwischen Handlungsspielraum und Handlungszwang
297
politisch-verwandtschaftlichen Kontakte eigene Fürsprecher und Vermittler. So vermit-
telte etwa Heinrich d.Ä., Herzog von Braunschweig-Lüneburg, im Jahre 1492 in der
Auseinandersetzung der Herzoge Magnus II. und Balthasar mit Heinrich d.J. von
Braunschweig-Lüneburg wegen der »Leibzucht« der verwitweten mecklenburgischen
Herzogin Margarete, einer gebürtigen Herzogin von Braunschweig-Lüneburg.'*" Der am
2. Februar 1518 zu Lauenburg zwischen Heinrich V. und Albrecht VII. von Mecklenburg
geschlossene brüderliche Erbvergleich kam nicht zuletzt durch hessisch-kursächsische
Vermittlung zustande, die sich wiederum durch die davor zu beiden Fürstenhäusern
auf gebauten Beziehungen erklärt.'*"
Die Verbindungen zu anderen Reichsfürsten wirkten sich auf die inneren Belange
und Verhältnisse der mecklenburgischen und pommerschen Lande in manchmal posi-
tiver, manchmal aber auch negativer Hinsicht aus. Die Kontakte zeigen allgemein und
in der speziellen Form der bereits in einem eigenen Abschnitt angesprochenen Bünd-
nisse jedenfalls, daß »die Fürsten [spätestens] des 16. Jahrhunderts [durchaus] wissen
[...], daß es zentrale Bereiche der Herrschaftsaufgaben gibt, die sie nicht allein, sondern
nur im Verbund mit ihren Nachbarn lösen können.«'*" Und nicht nur mit den Nachbarn,
wie wir sahen, sondern auch mit Reichsfürsten weit entfernt liegender Räume und Ge-
genden.
IV.7 Zwischen Handlungsspielraum und Handlungszwang:
Kontinuität und Wandel fürstlicher Beziehungen
während der sog. Reichsverdichtung
Die Kontakte zu Fürsten, die über die unmittelbare Nachbarschaft hinaus in weiter ent-
fernte, vornehmlich südlicher gelegene Reichsregionen geknüpft und unterhalten wur-
den, sind im wesentlichen eine Erscheinung, die wir ab der Phase der sog. Reichsver-
dichtung beobachten können, und scheinen ein Teil dieser »staatlich-organisatorischen
Integration des Reiches« zu sein, die Peter Moraw für die Zeit ab 1470 ausgemacht hat.'"
Vorher gab es solche - zumindest nach Auskunft unserer Quellen - weit weniger, es be-
stand dazu aber auch kaum ein Anreiz oder eine Notwendigkeit. Moraw hat für das
hessische Landgrafenhaus gegen Ende des 15. Jahrhunderts ganz ähnliche Beobachtun-
gen zur Erweiterung des räumlichen Radius fürstlich-dynastischer Politik gemacht wie
wir hier für die Häuser Mecklenburg und Pommern.'*" Es ist indes angesichts unserer
292 LAS, Bestand 11.11, Nr. 21531h
293 SACHSSE 1900, Nr. 89; FRANCK1755, S. 82ff. - Siehe dazu etwa SELLMER1999, S. 53; SCHNELL 1902,
S. 5.
294 Zitat aus SCHUBERT 1999, S. 241.
295 Dazu neben MoRAw 1985 auch DERS. 1998, S. 24ff. und insgesamt auch DERS. 1999 u. 1995.
296 Siehe etwa das Fallbeispiel Hessen MoRAw 1997 S. 132: »Neu und wesentlich war vor allem die
räumliche Erweiterung und damit auch Vermehrung fürstlicher Partnerschaftsmöglichkeiten,
gemäß den politischen Innovationen des Zeitalters der >Verdichtung< mit neuen Stellen am Kai-
serhof und beim kaiserlichen Militär und noch mehr durch die Entstehung des Reichstags. Kai-
ser und Reich drängten die Landgrafschaft aus dem toten Winkel heraus, in dem sie sich bisher,
was wirklich große Politik betraf, befunden hatte. Daher gab es nun auch Gattinnen aus den
Häusern Lothringen und, was zuvor beiderseits kaum denkbar gewesen wäre, Mecklenburg.«
297
politisch-verwandtschaftlichen Kontakte eigene Fürsprecher und Vermittler. So vermit-
telte etwa Heinrich d.Ä., Herzog von Braunschweig-Lüneburg, im Jahre 1492 in der
Auseinandersetzung der Herzoge Magnus II. und Balthasar mit Heinrich d.J. von
Braunschweig-Lüneburg wegen der »Leibzucht« der verwitweten mecklenburgischen
Herzogin Margarete, einer gebürtigen Herzogin von Braunschweig-Lüneburg.'*" Der am
2. Februar 1518 zu Lauenburg zwischen Heinrich V. und Albrecht VII. von Mecklenburg
geschlossene brüderliche Erbvergleich kam nicht zuletzt durch hessisch-kursächsische
Vermittlung zustande, die sich wiederum durch die davor zu beiden Fürstenhäusern
auf gebauten Beziehungen erklärt.'*"
Die Verbindungen zu anderen Reichsfürsten wirkten sich auf die inneren Belange
und Verhältnisse der mecklenburgischen und pommerschen Lande in manchmal posi-
tiver, manchmal aber auch negativer Hinsicht aus. Die Kontakte zeigen allgemein und
in der speziellen Form der bereits in einem eigenen Abschnitt angesprochenen Bünd-
nisse jedenfalls, daß »die Fürsten [spätestens] des 16. Jahrhunderts [durchaus] wissen
[...], daß es zentrale Bereiche der Herrschaftsaufgaben gibt, die sie nicht allein, sondern
nur im Verbund mit ihren Nachbarn lösen können.«'*" Und nicht nur mit den Nachbarn,
wie wir sahen, sondern auch mit Reichsfürsten weit entfernt liegender Räume und Ge-
genden.
IV.7 Zwischen Handlungsspielraum und Handlungszwang:
Kontinuität und Wandel fürstlicher Beziehungen
während der sog. Reichsverdichtung
Die Kontakte zu Fürsten, die über die unmittelbare Nachbarschaft hinaus in weiter ent-
fernte, vornehmlich südlicher gelegene Reichsregionen geknüpft und unterhalten wur-
den, sind im wesentlichen eine Erscheinung, die wir ab der Phase der sog. Reichsver-
dichtung beobachten können, und scheinen ein Teil dieser »staatlich-organisatorischen
Integration des Reiches« zu sein, die Peter Moraw für die Zeit ab 1470 ausgemacht hat.'"
Vorher gab es solche - zumindest nach Auskunft unserer Quellen - weit weniger, es be-
stand dazu aber auch kaum ein Anreiz oder eine Notwendigkeit. Moraw hat für das
hessische Landgrafenhaus gegen Ende des 15. Jahrhunderts ganz ähnliche Beobachtun-
gen zur Erweiterung des räumlichen Radius fürstlich-dynastischer Politik gemacht wie
wir hier für die Häuser Mecklenburg und Pommern.'*" Es ist indes angesichts unserer
292 LAS, Bestand 11.11, Nr. 21531h
293 SACHSSE 1900, Nr. 89; FRANCK1755, S. 82ff. - Siehe dazu etwa SELLMER1999, S. 53; SCHNELL 1902,
S. 5.
294 Zitat aus SCHUBERT 1999, S. 241.
295 Dazu neben MoRAw 1985 auch DERS. 1998, S. 24ff. und insgesamt auch DERS. 1999 u. 1995.
296 Siehe etwa das Fallbeispiel Hessen MoRAw 1997 S. 132: »Neu und wesentlich war vor allem die
räumliche Erweiterung und damit auch Vermehrung fürstlicher Partnerschaftsmöglichkeiten,
gemäß den politischen Innovationen des Zeitalters der >Verdichtung< mit neuen Stellen am Kai-
serhof und beim kaiserlichen Militär und noch mehr durch die Entstehung des Reichstags. Kai-
ser und Reich drängten die Landgrafschaft aus dem toten Winkel heraus, in dem sie sich bisher,
was wirklich große Politik betraf, befunden hatte. Daher gab es nun auch Gattinnen aus den
Häusern Lothringen und, was zuvor beiderseits kaum denkbar gewesen wäre, Mecklenburg.«