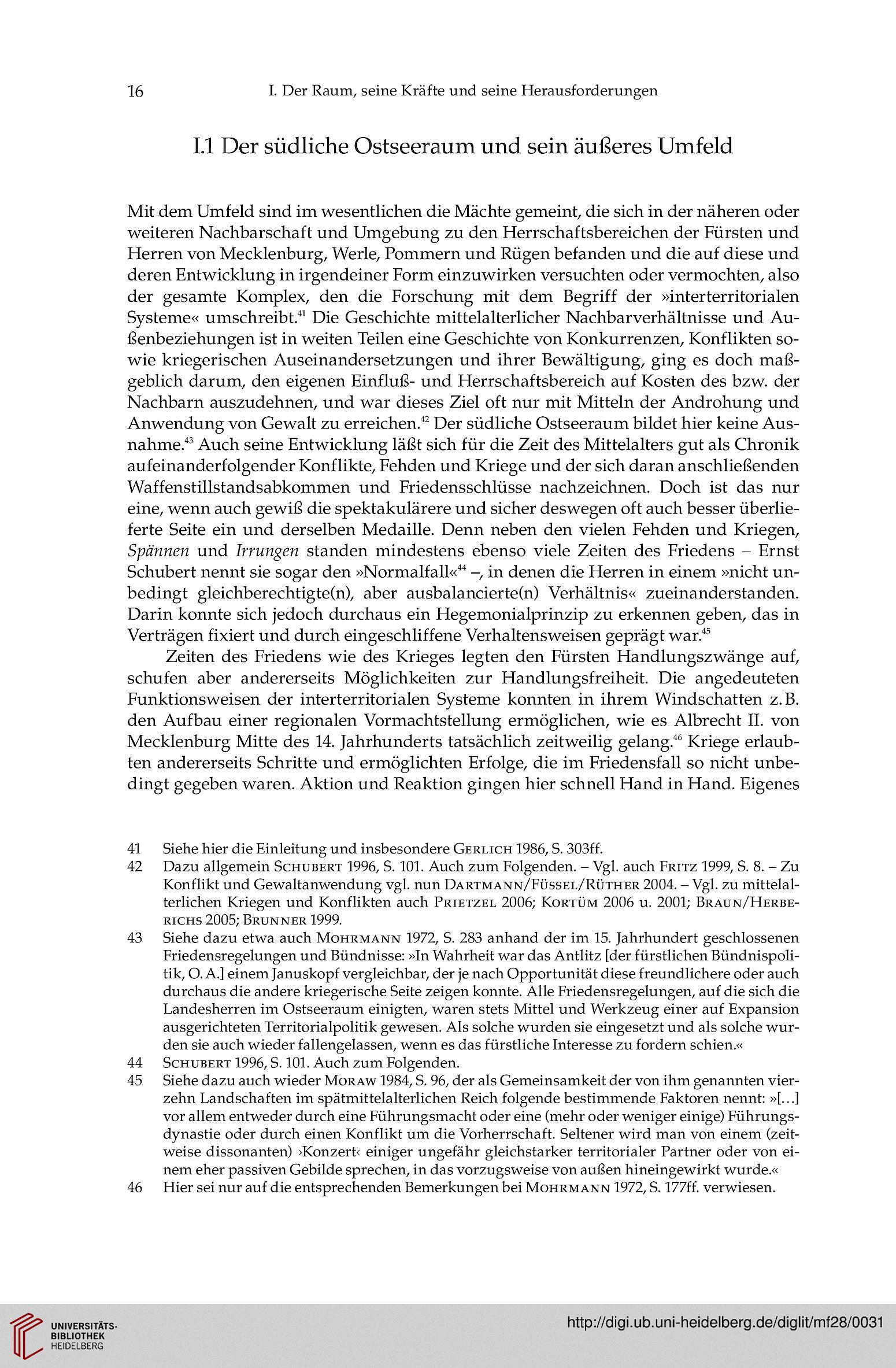16
I. Der Raum, seine Kräfte und seine Herausforderungen
1.1 Der südliche Ostseeraum und sein äußeres Umleid
Mit dem Umfeld sind im wesentlichen die Mächte gemeint, die sich in der näheren oder
weiteren Nachbarschaft und Umgebung zu den Herrschaftsbereichen der Fürsten und
Herren von Mecklenburg, Werle, Pommern und Rügen befanden und die auf diese und
deren Entwicklung in irgendeiner Form einzuwirken versuchten oder vermochten, also
der gesamte Komplex, den die Forschung mit dem Begriff der »interterritorialen
Systeme« umschreibt/* Die Geschichte mittelalterlicher Nachbarverhältnisse und Au-
ßenbeziehungen ist in weiten Teilen eine Geschichte von Konkurrenzen, Konflikten so-
wie kriegerischen Auseinandersetzungen und ihrer Bewältigung, ging es doch maß-
geblich darum, den eigenen Einfluß- und Herrschaftsbereich auf Kosten des bzw. der
Nachbarn auszudehnen, und war dieses Ziel oft nur mit Mitteln der Androhung und
Anwendung von Gewalt zu erreichen/' Der südliche Ostseeraum bildet hier keine Aus-
nahme/^ Auch seine Entwicklung läßt sich für die Zeit des Mittelalters gut als Chronik
aufeinanderfolgender Konflikte, Fehden und Kriege und der sich daran anschließenden
Waffenstillstandsabkommen und Friedensschlüsse nachzeichnen. Doch ist das nur
eine, wenn auch gewiß die spektakulärere und sicher deswegen oft auch besser überlie-
ferte Seite ein und derselben Medaille. Denn neben den vielen Fehden und Kriegen,
Spännen und hvnngen standen mindestens ebenso viele Zeiten des Friedens - Ernst
Schubert nennt sie sogar den »Normalfall«^ -, in denen die Herren in einem »nicht un-
bedingt gleichberechtigte(n), aber ausbalancierte(n) Verhältnis« zueinanderstanden.
Darin konnte sich jedoch durchaus ein Hegemonialprinzip zu erkennen geben, das in
Verträgen fixiert und durch eingeschliffene Verhaltensweisen geprägt war/'
Zeiten des Friedens wie des Krieges legten den Fürsten Handlungszwänge auf,
schufen aber andererseits Möglichkeiten zur Handlungsfreiheit. Die angedeuteten
Funktionsweisen der interterritorialen Systeme konnten in ihrem Windschatten z.B.
den Aufbau einer regionalen Vormachtstellung ermöglichen, wie es Albrecht II. von
Mecklenburg Mitte des 14. Jahrhunderts tatsächlich zeitweilig gelang/" Kriege erlaub-
ten andererseits Schritte und ermöglichten Erfolge, die im Friedensfall so nicht unbe-
dingt gegeben waren. Aktion und Reaktion gingen hier schnell Hand in Hand. Eigenes
41 Siehe hier die Einleitung und insbesondere GERLiCH 1986, S. 303ff.
42 Dazu allgemein SCHUBERT 1996, S. 101. Auch zum Folgenden. - Vgl. auch FRITZ 1999, S. 8. - Zu
Konflikt und Gewaltanwendung vgl. nun DARTMANN/FÜSSEL/RÜTHER 2004. - Vgl. zu mittelal-
terlichen Kriegen und Konflikten auch PRiETZEL 2006; KoRTÜM 2006 u. 2001; BRAUN/HERBE-
RiCHS 2005; BRUNNER 1999.
43 Siehe dazu etwa auch MoHRMANN 1972, S. 283 anhand der im 15. Jahrhundert geschlossenen
Friedensregelungen und Bündnisse: »In Wahrheit war das Antlitz [der fürstlichen Bündnispoli-
tik, O. A.] einem Januskopf vergleichbar, der je nach Opportunität diese freundlichere oder auch
durchaus die andere kriegerische Seite zeigen konnte. Alle Friedensregelungen, auf die sich die
Landesherren im Ostseeraum einigten, waren stets Mittel und Werkzeug einer auf Expansion
ausgerichteten Territorialpolitik gewesen. Als solche wurden sie eingesetzt und als solche wur-
den sie auch wieder fallengelassen, wenn es das fürstliche Interesse zu fordern schien.«
44 SCHUBERT 1996, S. 101. Auch zum Folgenden.
45 Siehe dazu auch wieder MoRAw 1984, S. 96, der als Gemeinsamkeit der von ihm genannten vier-
zehn Landschaften im spätmittelalterlichen Reich folgende bestimmende Faktoren nennt: »[...]
vor allem entweder durch eine Führungsmacht oder eine (mehr oder weniger einige) Führungs-
dynastie oder durch einen Konflikt um die Vorherrschaft. Seltener wird man von einem (zeit-
weise dissonanten) >Konzert< einiger ungefähr gleichstarker territorialer Partner oder von ei-
nem eher passiven Gebilde sprechen, in das vorzugsweise von außen hineingewirkt wurde.«
46 Hier sei nur auf die entsprechenden Bemerkungen bei MoHRMANN 1972, S. 177ff. verwiesen.
I. Der Raum, seine Kräfte und seine Herausforderungen
1.1 Der südliche Ostseeraum und sein äußeres Umleid
Mit dem Umfeld sind im wesentlichen die Mächte gemeint, die sich in der näheren oder
weiteren Nachbarschaft und Umgebung zu den Herrschaftsbereichen der Fürsten und
Herren von Mecklenburg, Werle, Pommern und Rügen befanden und die auf diese und
deren Entwicklung in irgendeiner Form einzuwirken versuchten oder vermochten, also
der gesamte Komplex, den die Forschung mit dem Begriff der »interterritorialen
Systeme« umschreibt/* Die Geschichte mittelalterlicher Nachbarverhältnisse und Au-
ßenbeziehungen ist in weiten Teilen eine Geschichte von Konkurrenzen, Konflikten so-
wie kriegerischen Auseinandersetzungen und ihrer Bewältigung, ging es doch maß-
geblich darum, den eigenen Einfluß- und Herrschaftsbereich auf Kosten des bzw. der
Nachbarn auszudehnen, und war dieses Ziel oft nur mit Mitteln der Androhung und
Anwendung von Gewalt zu erreichen/' Der südliche Ostseeraum bildet hier keine Aus-
nahme/^ Auch seine Entwicklung läßt sich für die Zeit des Mittelalters gut als Chronik
aufeinanderfolgender Konflikte, Fehden und Kriege und der sich daran anschließenden
Waffenstillstandsabkommen und Friedensschlüsse nachzeichnen. Doch ist das nur
eine, wenn auch gewiß die spektakulärere und sicher deswegen oft auch besser überlie-
ferte Seite ein und derselben Medaille. Denn neben den vielen Fehden und Kriegen,
Spännen und hvnngen standen mindestens ebenso viele Zeiten des Friedens - Ernst
Schubert nennt sie sogar den »Normalfall«^ -, in denen die Herren in einem »nicht un-
bedingt gleichberechtigte(n), aber ausbalancierte(n) Verhältnis« zueinanderstanden.
Darin konnte sich jedoch durchaus ein Hegemonialprinzip zu erkennen geben, das in
Verträgen fixiert und durch eingeschliffene Verhaltensweisen geprägt war/'
Zeiten des Friedens wie des Krieges legten den Fürsten Handlungszwänge auf,
schufen aber andererseits Möglichkeiten zur Handlungsfreiheit. Die angedeuteten
Funktionsweisen der interterritorialen Systeme konnten in ihrem Windschatten z.B.
den Aufbau einer regionalen Vormachtstellung ermöglichen, wie es Albrecht II. von
Mecklenburg Mitte des 14. Jahrhunderts tatsächlich zeitweilig gelang/" Kriege erlaub-
ten andererseits Schritte und ermöglichten Erfolge, die im Friedensfall so nicht unbe-
dingt gegeben waren. Aktion und Reaktion gingen hier schnell Hand in Hand. Eigenes
41 Siehe hier die Einleitung und insbesondere GERLiCH 1986, S. 303ff.
42 Dazu allgemein SCHUBERT 1996, S. 101. Auch zum Folgenden. - Vgl. auch FRITZ 1999, S. 8. - Zu
Konflikt und Gewaltanwendung vgl. nun DARTMANN/FÜSSEL/RÜTHER 2004. - Vgl. zu mittelal-
terlichen Kriegen und Konflikten auch PRiETZEL 2006; KoRTÜM 2006 u. 2001; BRAUN/HERBE-
RiCHS 2005; BRUNNER 1999.
43 Siehe dazu etwa auch MoHRMANN 1972, S. 283 anhand der im 15. Jahrhundert geschlossenen
Friedensregelungen und Bündnisse: »In Wahrheit war das Antlitz [der fürstlichen Bündnispoli-
tik, O. A.] einem Januskopf vergleichbar, der je nach Opportunität diese freundlichere oder auch
durchaus die andere kriegerische Seite zeigen konnte. Alle Friedensregelungen, auf die sich die
Landesherren im Ostseeraum einigten, waren stets Mittel und Werkzeug einer auf Expansion
ausgerichteten Territorialpolitik gewesen. Als solche wurden sie eingesetzt und als solche wur-
den sie auch wieder fallengelassen, wenn es das fürstliche Interesse zu fordern schien.«
44 SCHUBERT 1996, S. 101. Auch zum Folgenden.
45 Siehe dazu auch wieder MoRAw 1984, S. 96, der als Gemeinsamkeit der von ihm genannten vier-
zehn Landschaften im spätmittelalterlichen Reich folgende bestimmende Faktoren nennt: »[...]
vor allem entweder durch eine Führungsmacht oder eine (mehr oder weniger einige) Führungs-
dynastie oder durch einen Konflikt um die Vorherrschaft. Seltener wird man von einem (zeit-
weise dissonanten) >Konzert< einiger ungefähr gleichstarker territorialer Partner oder von ei-
nem eher passiven Gebilde sprechen, in das vorzugsweise von außen hineingewirkt wurde.«
46 Hier sei nur auf die entsprechenden Bemerkungen bei MoHRMANN 1972, S. 177ff. verwiesen.