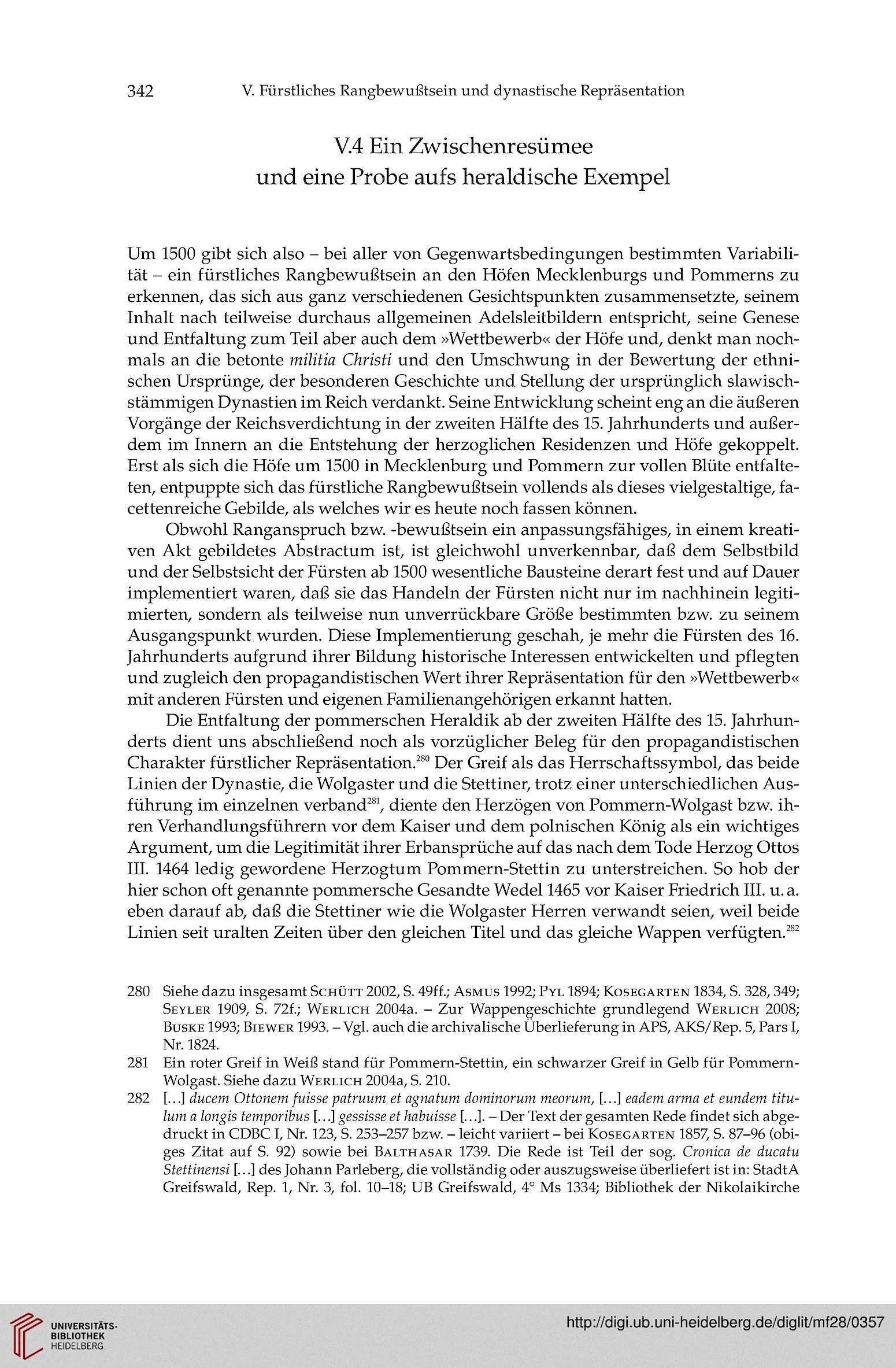342
V. Fürstliches Rangbewußtsein und dynastische Repräsentation
Y4 Ein Zwischenresümee
und eine Probe aufs heraldische Exempel
Um 1500 gibt sich also - bei aller von Gegenwartsbedingungen bestimmten Variabili-
tät - ein fürstliches Rangbewußtsein an den Höfen Mecklenburgs und Pommerns zu
erkennen, das sich aus ganz verschiedenen Gesichtspunkten zusammensetzte, seinem
Inhalt nach teilweise durchaus allgemeinen Adelsleitbildern entspricht, seine Genese
und Entfaltung zum Teil aber auch dem »Wettbewerb« der Höfe und, denkt man noch-
mals an die betonte wih'iM C/zn'sü und den Umschwung in der Bewertung der ethni-
schen Ursprünge, der besonderen Geschichte und Stellung der ursprünglich slawisch-
stämmigen Dynastien im Reich verdankt. Seine Entwicklung scheint eng an die äußeren
Vorgänge der Reichsverdichtung in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und außer-
dem im Innern an die Entstehung der herzoglichen Residenzen und Höfe gekoppelt.
Erst als sich die Höfe um 1500 in Mecklenburg und Pommern zur vollen Blüte entfalte-
ten, entpuppte sich das fürstliche Rangbewußtsein vollends als dieses vielgestaltige, fa-
cettenreiche Gebilde, als welches wir es heute noch fassen können.
Obwohl Ranganspruch bzw. -bewußtsein ein anpassungsfähiges, in einem kreati-
ven Akt gebildetes Abstractum ist, ist gleichwohl unverkennbar, daß dem Selbstbild
und der Selbstsicht der Fürsten ab 1500 wesentliche Bausteine derart fest und auf Dauer
implementiert waren, daß sie das Handeln der Fürsten nicht nur im nachhinein legiti-
mierten, sondern als teilweise nun unverrückbare Größe bestimmten bzw. zu seinem
Ausgangspunkt wurden. Diese Implementierung geschah, je mehr die Fürsten des 16.
Jahrhunderts aufgrund ihrer Bildung historische Interessen entwickelten und pflegten
und zugleich den propagandistischen Wert ihrer Repräsentation für den »Wettbewerb«
mit anderen Fürsten und eigenen Familienangehörigen erkannt hatten.
Die Entfaltung der pommerschen Heraldik ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun-
derts dient uns abschließend noch als vorzüglicher Beleg für den propagandistischen
Charakter fürstlicher Repräsentation.""" Der Greif als das Herrschaftssymbol, das beide
Linien der Dynastie, die Wolgaster und die Stettiner, trotz einer unterschiedlichen Aus-
führung im einzelnen verband""*, diente den Herzogen von Pommern-Wolgast bzw. ih-
ren Verhandlungsführern vor dem Kaiser und dem polnischen König als ein wichtiges
Argument, um die Legitimität ihrer Erbansprüche auf das nach dem Tode Herzog Ottos
III. 1464 ledig gewordene Herzogtum Pommern-Stettin zu unterstreichen. So hob der
hier schon oft genannte pommersche Gesandte Wedel 1465 vor Kaiser Friedrich III. u. a.
eben darauf ab, daß die Stettiner wie die Wolgaster Herren verwandt seien, weil beide
Linien seit uralten Zeiten über den gleichen Titel und das gleiche Wappen verfügten."""
280 Siehe dazu insgesamt ScHÜTT 2002, S. 49ff.; AsMus 1992; PYL 1894; KosEGARTEN 1834, S. 328,349;
SEYLER 1909, S. 72f.; WERLiCH 2004a. - Zur Wappengeschichte grundlegend WERLiCH 2008;
BusKE 1993; BiEWER 1993. - Vgl. auch die archivalische Überlieferung in APS, AKS/Rep. 5, Pars I,
Nr. 1824.
281 Ein roter Greif in Weiß stand für Pommern-Stettin, ein schwarzer Greif in Gelb für Pommern-
Wolgast. Siehe dazu WERLiCH 2004a, S. 210.
282 [...] dMcezn Oüone??z/hisse pnfrMMzn et ng?MfM??z do??hnorM??z ??zeona?z, [...] endezn nn?M et eMwdezn fifM-
ha?z n iongis hwywnüus [...] gessisse et /MÜuisse [...]. - Der Text der gesamten Rede findet sich abge-
druckt in CDBC I, Nr. 123, S. 253-257 bzw. - leicht variiert - bei KosEGARTEN 1857, S. 87-96 (obi-
ges Zitat auf S. 92) sowie bei BALTHASAR 1739. Die Rede ist Teil der sog. Crom'cn de duceiu
Siehinensi [...] des Johann Parleberg, die vollständig oder auszugsweise überliefert ist in: StadtA
Greifswald, Rep. 1, Nr. 3, fol. 10-18; UB Greifswald, 4° Ms 1334; Bibliothek der Nikolaikirche
V. Fürstliches Rangbewußtsein und dynastische Repräsentation
Y4 Ein Zwischenresümee
und eine Probe aufs heraldische Exempel
Um 1500 gibt sich also - bei aller von Gegenwartsbedingungen bestimmten Variabili-
tät - ein fürstliches Rangbewußtsein an den Höfen Mecklenburgs und Pommerns zu
erkennen, das sich aus ganz verschiedenen Gesichtspunkten zusammensetzte, seinem
Inhalt nach teilweise durchaus allgemeinen Adelsleitbildern entspricht, seine Genese
und Entfaltung zum Teil aber auch dem »Wettbewerb« der Höfe und, denkt man noch-
mals an die betonte wih'iM C/zn'sü und den Umschwung in der Bewertung der ethni-
schen Ursprünge, der besonderen Geschichte und Stellung der ursprünglich slawisch-
stämmigen Dynastien im Reich verdankt. Seine Entwicklung scheint eng an die äußeren
Vorgänge der Reichsverdichtung in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und außer-
dem im Innern an die Entstehung der herzoglichen Residenzen und Höfe gekoppelt.
Erst als sich die Höfe um 1500 in Mecklenburg und Pommern zur vollen Blüte entfalte-
ten, entpuppte sich das fürstliche Rangbewußtsein vollends als dieses vielgestaltige, fa-
cettenreiche Gebilde, als welches wir es heute noch fassen können.
Obwohl Ranganspruch bzw. -bewußtsein ein anpassungsfähiges, in einem kreati-
ven Akt gebildetes Abstractum ist, ist gleichwohl unverkennbar, daß dem Selbstbild
und der Selbstsicht der Fürsten ab 1500 wesentliche Bausteine derart fest und auf Dauer
implementiert waren, daß sie das Handeln der Fürsten nicht nur im nachhinein legiti-
mierten, sondern als teilweise nun unverrückbare Größe bestimmten bzw. zu seinem
Ausgangspunkt wurden. Diese Implementierung geschah, je mehr die Fürsten des 16.
Jahrhunderts aufgrund ihrer Bildung historische Interessen entwickelten und pflegten
und zugleich den propagandistischen Wert ihrer Repräsentation für den »Wettbewerb«
mit anderen Fürsten und eigenen Familienangehörigen erkannt hatten.
Die Entfaltung der pommerschen Heraldik ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun-
derts dient uns abschließend noch als vorzüglicher Beleg für den propagandistischen
Charakter fürstlicher Repräsentation.""" Der Greif als das Herrschaftssymbol, das beide
Linien der Dynastie, die Wolgaster und die Stettiner, trotz einer unterschiedlichen Aus-
führung im einzelnen verband""*, diente den Herzogen von Pommern-Wolgast bzw. ih-
ren Verhandlungsführern vor dem Kaiser und dem polnischen König als ein wichtiges
Argument, um die Legitimität ihrer Erbansprüche auf das nach dem Tode Herzog Ottos
III. 1464 ledig gewordene Herzogtum Pommern-Stettin zu unterstreichen. So hob der
hier schon oft genannte pommersche Gesandte Wedel 1465 vor Kaiser Friedrich III. u. a.
eben darauf ab, daß die Stettiner wie die Wolgaster Herren verwandt seien, weil beide
Linien seit uralten Zeiten über den gleichen Titel und das gleiche Wappen verfügten."""
280 Siehe dazu insgesamt ScHÜTT 2002, S. 49ff.; AsMus 1992; PYL 1894; KosEGARTEN 1834, S. 328,349;
SEYLER 1909, S. 72f.; WERLiCH 2004a. - Zur Wappengeschichte grundlegend WERLiCH 2008;
BusKE 1993; BiEWER 1993. - Vgl. auch die archivalische Überlieferung in APS, AKS/Rep. 5, Pars I,
Nr. 1824.
281 Ein roter Greif in Weiß stand für Pommern-Stettin, ein schwarzer Greif in Gelb für Pommern-
Wolgast. Siehe dazu WERLiCH 2004a, S. 210.
282 [...] dMcezn Oüone??z/hisse pnfrMMzn et ng?MfM??z do??hnorM??z ??zeona?z, [...] endezn nn?M et eMwdezn fifM-
ha?z n iongis hwywnüus [...] gessisse et /MÜuisse [...]. - Der Text der gesamten Rede findet sich abge-
druckt in CDBC I, Nr. 123, S. 253-257 bzw. - leicht variiert - bei KosEGARTEN 1857, S. 87-96 (obi-
ges Zitat auf S. 92) sowie bei BALTHASAR 1739. Die Rede ist Teil der sog. Crom'cn de duceiu
Siehinensi [...] des Johann Parleberg, die vollständig oder auszugsweise überliefert ist in: StadtA
Greifswald, Rep. 1, Nr. 3, fol. 10-18; UB Greifswald, 4° Ms 1334; Bibliothek der Nikolaikirche