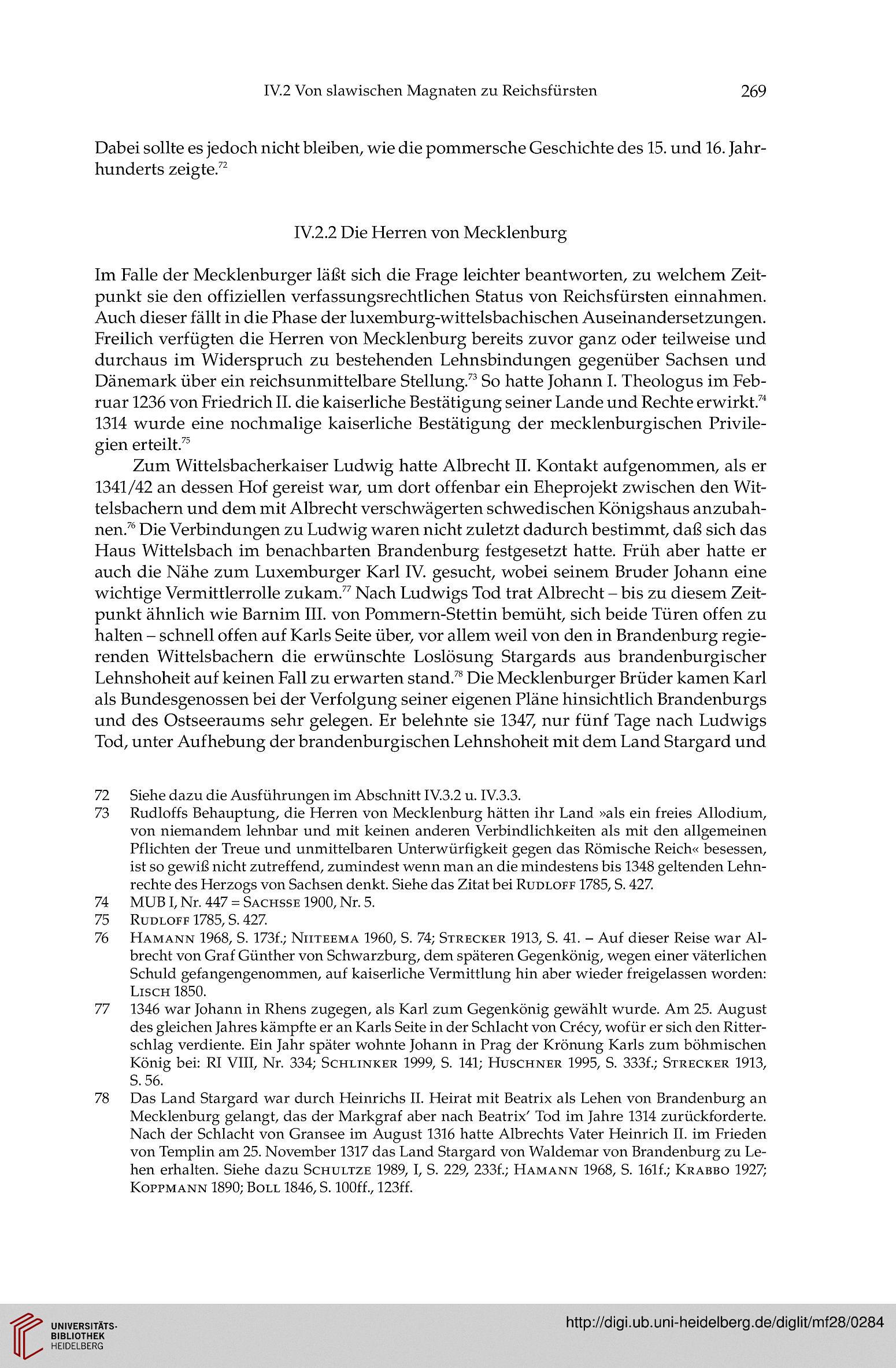IV.2 Von slawischen Magnaten zu Reichsfürsten
269
Dabei sollte es jedoch nicht bleiben, wie die pommersche Geschichte des 15. und 16. Jahr-
hunderts zeigte. *
IV.2.2 Die Herren von Mecklenburg
Im Falle der Mecklenburger läßt sich die Frage leichter beantworten, zu welchem Zeit-
punkt sie den offiziellen verfassungsrechtlichen Status von Reichsfürsten einnahmen.
Auch dieser fällt in die Phase der luxemburg-wittelsbachischen Auseinandersetzungen.
Freilich verfügten die Herren von Mecklenburg bereits zuvor ganz oder teilweise und
durchaus im Widerspruch zu bestehenden Lehnsbindungen gegenüber Sachsen und
Dänemark über ein reichsunmittelbare Stellung.^ So hatte Johann I. Theologus im Feb-
ruar 1236 von Friedrich II. die kaiserliche Bestätigung seiner Lande und Rechte erwirkt.^
1314 wurde eine nochmalige kaiserliche Bestätigung der mecklenburgischen Privile-
gien erteilt.^
Zum Wittelsbacherkaiser Ludwig hatte Albrecht II. Kontakt aufgenommen, als er
1341/42 an dessen Hof gereist war, um dort offenbar ein Eheprojekt zwischen den Wit-
telsbachern und dem mit Albrecht verschwägerten schwedischen Königshaus anzubah-
nen/" Die Verbindungen zu Ludwig waren nicht zuletzt dadurch bestimmt, daß sich das
Haus Wittelsbach im benachbarten Brandenburg festgesetzt hatte. Früh aber hatte er
auch die Nähe zum Luxemburger Karl IV. gesucht, wobei seinem Bruder Johann eine
wichtige Vermittlerrolle zukam. ' Nach Ludwigs Tod trat Albrecht - bis zu diesem Zeit-
punkt ähnlich wie Barnim III. von Pommern-Stettin bemüht, sich beide Türen offen zu
halten - schnell offen auf Karls Seite über, vor allem weil von den in Brandenburg regie-
renden Wittelsbachern die erwünschte Loslösung Stargards aus brandenburgischer
Lehnshoheit auf keinen Fall zu erwarten stand. " Die Mecklenburger Brüder kamen Karl
als Bundesgenossen bei der Verfolgung seiner eigenen Pläne hinsichtlich Brandenburgs
und des Ostseeraums sehr gelegen. Er belehnte sie 134Z nur fünf Tage nach Ludwigs
Tod, unter Aufhebung der brandenburgischen Lehnshoheit mit dem Land Stargard und
72 Siehe dazu die Ausführungen im Abschnitt IV.3.2 u. IV.3.3.
73 Rudioffs Behauptung, die Herren von Mecklenburg hätten ihr Land »als ein freies Allodium,
von niemandem lehnbar und mit keinen anderen Verbindlichkeiten als mit den allgemeinen
Pflichten der Treue und unmittelbaren Unterwürfigkeit gegen das Römische Reich« besessen,
ist so gewiß nicht zutreffend, zumindest wenn man an die mindestens bis 1348 geltenden Lehn-
rechte des Herzogs von Sachsen denkt. Siehe das Zitat bei RuDLOFF 1785, S. 427.
74 MUBI, Nr. 447 = SACHSSE 1900, Nr. 5.
75 RuDLOFF 1785, S. 427.
76 HAMANN 1968, S. 173f.; NiiTEEMA 1960, S. 74; STRECKER 1913, S. 4L - Auf dieser Reise war Al-
brecht von Graf Günther von Schwarzburg, dem späteren Gegenkönig, wegen einer väterlichen
Schuld gefangengenommen, auf kaiserliche Vermittlung hin aber wieder freigelassen worden:
LiscH 1850.
77 1346 war Johann in Rhens zugegen, als Karl zum Gegenkönig gewählt wurde. Am 25. August
des gleichen Jahres kämpfte er an Karls Seite in der Schlacht von Crecy, wofür er sich den Ritter-
schlag verdiente. Ein Jahr später wohnte Johann in Prag der Krönung Karls zum böhmischen
König bei: RI VIII, Nr. 334; ScHLiNKER 1999, S. 141; HuscHNER 1995, S. 333f.; STRECKER 1913,
S. 56.
78 Das Land Stargard war durch Heinrichs II. Heirat mit Beatrix als Lehen von Brandenburg an
Mecklenburg gelangt, das der Markgraf aber nach Beatrix' Tod im Jahre 1314 zurückforderte.
Nach der Schlacht von Gransee im August 1316 hatte Albrechts Vater Heinrich II. im Frieden
von Templin am 25. November 1317 das Land Stargard von Waldemar von Brandenburg zu Le-
hen erhalten. Siehe dazu ScHULTZE 1989, I, S. 229, 233f.; HAMANN 1968, S. 161f.; KRABBO 1927;
KoppMANN 1890; BoLL 1846, S. 100ff., 123ff.
269
Dabei sollte es jedoch nicht bleiben, wie die pommersche Geschichte des 15. und 16. Jahr-
hunderts zeigte. *
IV.2.2 Die Herren von Mecklenburg
Im Falle der Mecklenburger läßt sich die Frage leichter beantworten, zu welchem Zeit-
punkt sie den offiziellen verfassungsrechtlichen Status von Reichsfürsten einnahmen.
Auch dieser fällt in die Phase der luxemburg-wittelsbachischen Auseinandersetzungen.
Freilich verfügten die Herren von Mecklenburg bereits zuvor ganz oder teilweise und
durchaus im Widerspruch zu bestehenden Lehnsbindungen gegenüber Sachsen und
Dänemark über ein reichsunmittelbare Stellung.^ So hatte Johann I. Theologus im Feb-
ruar 1236 von Friedrich II. die kaiserliche Bestätigung seiner Lande und Rechte erwirkt.^
1314 wurde eine nochmalige kaiserliche Bestätigung der mecklenburgischen Privile-
gien erteilt.^
Zum Wittelsbacherkaiser Ludwig hatte Albrecht II. Kontakt aufgenommen, als er
1341/42 an dessen Hof gereist war, um dort offenbar ein Eheprojekt zwischen den Wit-
telsbachern und dem mit Albrecht verschwägerten schwedischen Königshaus anzubah-
nen/" Die Verbindungen zu Ludwig waren nicht zuletzt dadurch bestimmt, daß sich das
Haus Wittelsbach im benachbarten Brandenburg festgesetzt hatte. Früh aber hatte er
auch die Nähe zum Luxemburger Karl IV. gesucht, wobei seinem Bruder Johann eine
wichtige Vermittlerrolle zukam. ' Nach Ludwigs Tod trat Albrecht - bis zu diesem Zeit-
punkt ähnlich wie Barnim III. von Pommern-Stettin bemüht, sich beide Türen offen zu
halten - schnell offen auf Karls Seite über, vor allem weil von den in Brandenburg regie-
renden Wittelsbachern die erwünschte Loslösung Stargards aus brandenburgischer
Lehnshoheit auf keinen Fall zu erwarten stand. " Die Mecklenburger Brüder kamen Karl
als Bundesgenossen bei der Verfolgung seiner eigenen Pläne hinsichtlich Brandenburgs
und des Ostseeraums sehr gelegen. Er belehnte sie 134Z nur fünf Tage nach Ludwigs
Tod, unter Aufhebung der brandenburgischen Lehnshoheit mit dem Land Stargard und
72 Siehe dazu die Ausführungen im Abschnitt IV.3.2 u. IV.3.3.
73 Rudioffs Behauptung, die Herren von Mecklenburg hätten ihr Land »als ein freies Allodium,
von niemandem lehnbar und mit keinen anderen Verbindlichkeiten als mit den allgemeinen
Pflichten der Treue und unmittelbaren Unterwürfigkeit gegen das Römische Reich« besessen,
ist so gewiß nicht zutreffend, zumindest wenn man an die mindestens bis 1348 geltenden Lehn-
rechte des Herzogs von Sachsen denkt. Siehe das Zitat bei RuDLOFF 1785, S. 427.
74 MUBI, Nr. 447 = SACHSSE 1900, Nr. 5.
75 RuDLOFF 1785, S. 427.
76 HAMANN 1968, S. 173f.; NiiTEEMA 1960, S. 74; STRECKER 1913, S. 4L - Auf dieser Reise war Al-
brecht von Graf Günther von Schwarzburg, dem späteren Gegenkönig, wegen einer väterlichen
Schuld gefangengenommen, auf kaiserliche Vermittlung hin aber wieder freigelassen worden:
LiscH 1850.
77 1346 war Johann in Rhens zugegen, als Karl zum Gegenkönig gewählt wurde. Am 25. August
des gleichen Jahres kämpfte er an Karls Seite in der Schlacht von Crecy, wofür er sich den Ritter-
schlag verdiente. Ein Jahr später wohnte Johann in Prag der Krönung Karls zum böhmischen
König bei: RI VIII, Nr. 334; ScHLiNKER 1999, S. 141; HuscHNER 1995, S. 333f.; STRECKER 1913,
S. 56.
78 Das Land Stargard war durch Heinrichs II. Heirat mit Beatrix als Lehen von Brandenburg an
Mecklenburg gelangt, das der Markgraf aber nach Beatrix' Tod im Jahre 1314 zurückforderte.
Nach der Schlacht von Gransee im August 1316 hatte Albrechts Vater Heinrich II. im Frieden
von Templin am 25. November 1317 das Land Stargard von Waldemar von Brandenburg zu Le-
hen erhalten. Siehe dazu ScHULTZE 1989, I, S. 229, 233f.; HAMANN 1968, S. 161f.; KRABBO 1927;
KoppMANN 1890; BoLL 1846, S. 100ff., 123ff.