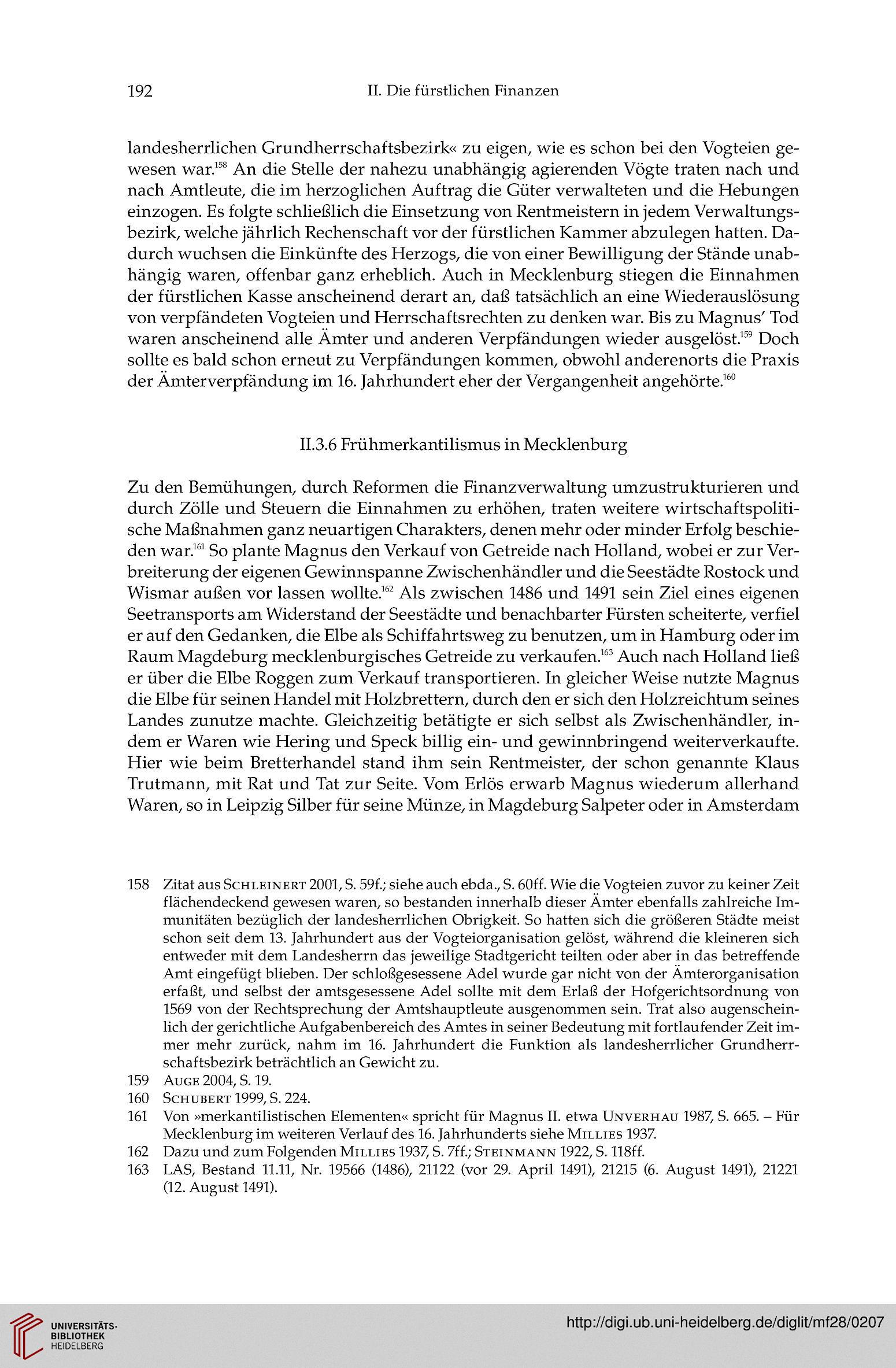192
II. Die fürstlichen Finanzen
landesherrlichen Grundherrschaftsbezirk« zu eigen, wie es schon bei den Vogteien ge-
wesen war.'" An die Stelle der nahezu unabhängig agierenden Vögte traten nach und
nach Amtleute, die im herzoglichen Auftrag die Güter verwalteten und die Hebungen
einzogen. Es folgte schließlich die Einsetzung von Rentmeistern in jedem Verwaltungs-
bezirk, welche jährlich Rechenschaft vor der fürstlichen Kammer abzulegen hatten. Da-
durch wuchsen die Einkünfte des Herzogs, die von einer Bewilligung der Stände unab-
hängig waren, offenbar ganz erheblich. Auch in Mecklenburg stiegen die Einnahmen
der fürstlichen Kasse anscheinend derart an, daß tatsächlich an eine Wiederauslösung
von verpfändeten Vogteien und Herrschaftsrechten zu denken war. Bis zu Magnus' Tod
waren anscheinend alle Ämter und anderen Verpfändungen wieder ausgelöst.'" Doch
sollte es bald schon erneut zu Verpfändungen kommen, obwohl anderenorts die Praxis
der Ämterverpfändung im 16. Jahrhundert eher der Vergangenheit angehörte." '
11.3.6 Frühmerkantilismus in Mecklenburg
Zu den Bemühungen, durch Reformen die Finanzverwaltung umzustrukturieren und
durch Zölle und Steuern die Einnahmen zu erhöhen, traten weitere wirtschaftspoliti-
sche Maßnahmen ganz neuartigen Charakters, denen mehr oder minder Erfolg beschie-
den war!"* So plante Magnus den Verkauf von Getreide nach Holland, wobei er zur Ver-
breiterung der eigenen Gewinnspanne Zwischenhändler und die Seestädte Rostock und
Wismar außen vor lassen wollte.*"' Als zwischen 1486 und 1491 sein Ziel eines eigenen
Seetransports am Widerstand der Seestädte und benachbarter Fürsten scheiterte, verfiel
er auf den Gedanken, die Elbe als Schiffahrtsweg zu benutzen, um in Hamburg oder im
Raum Magdeburg mecklenburgisches Getreide zu verkaufen.*"" Auch nach Holland ließ
er über die Elbe Roggen zum Verkauf transportieren. In gleicher Weise nutzte Magnus
die Elbe für seinen Handel mit Holzbrettern, durch den er sich den Holzreichtum seines
Landes zunutze machte. Gleichzeitig betätigte er sich selbst als Zwischenhändler, in-
dem er Waren wie Hering und Speck billig ein- und gewinnbringend weiterverkaufte.
Hier wie beim Bretterhandel stand ihm sein Rentmeister, der schon genannte Klaus
Trutmann, mit Rat und Tat zur Seite. Vom Erlös erwarb Magnus wiederum allerhand
Waren, so in Leipzig Silber für seine Münze, in Magdeburg Salpeter oder in Amsterdam
158 Zitat aus ScHLEiNERT 2001, S. 59f.; siehe auch ebda., S. 60ff. Wie die Vogteien zuvor zu keiner Zeit
flächendeckend gewesen waren, so bestanden innerhalb dieser Ämter ebenfalls zahlreiche Im-
munitäten bezüglich der landesherrlichen Obrigkeit. So hatten sich die größeren Städte meist
schon seit dem 13. Jahrhundert aus der Vogteiorganisation gelöst, während die kleineren sich
entweder mit dem Landesherrn das jeweilige Stadtgericht teilten oder aber in das betreffende
Amt eingefügt blieben. Der schloßgesessene Adel wurde gar nicht von der Ämterorganisation
erfaßt, und selbst der amtsgesessene Adel sollte mit dem Erlaß der Hofgerichtsordnung von
1569 von der Rechtsprechung der Amtshauptleute ausgenommen sein. Trat also augenschein-
lich der gerichtliche Aufgabenbereich des Amtes in seiner Bedeutung mit fortlaufender Zeit im-
mer mehr zurück, nahm im 16. Jahrhundert die Funktion als landesherrlicher Grundherr-
schaftsbezirk beträchtlich an Gewicht zu.
159 AucE2004,S. 19.
160 SCHUBERT 1999, S. 224.
161 Von »merkantilistischen Elementen« spricht für Magnus II. etwa UNVERHAU 1987, S. 665. - Für
Mecklenburg im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts siehe MiLLiES 1937.
162 Dazu und zum Folgenden MiLLiES 1937, S. 7ff.; STEINMANN 1922, S. 118ff.
163 LAS, Bestand 11.11, Nr. 19566 (1486), 21122 (vor 29. April 1491), 21215 (6. August 1491), 21221
(12. August 1491).
II. Die fürstlichen Finanzen
landesherrlichen Grundherrschaftsbezirk« zu eigen, wie es schon bei den Vogteien ge-
wesen war.'" An die Stelle der nahezu unabhängig agierenden Vögte traten nach und
nach Amtleute, die im herzoglichen Auftrag die Güter verwalteten und die Hebungen
einzogen. Es folgte schließlich die Einsetzung von Rentmeistern in jedem Verwaltungs-
bezirk, welche jährlich Rechenschaft vor der fürstlichen Kammer abzulegen hatten. Da-
durch wuchsen die Einkünfte des Herzogs, die von einer Bewilligung der Stände unab-
hängig waren, offenbar ganz erheblich. Auch in Mecklenburg stiegen die Einnahmen
der fürstlichen Kasse anscheinend derart an, daß tatsächlich an eine Wiederauslösung
von verpfändeten Vogteien und Herrschaftsrechten zu denken war. Bis zu Magnus' Tod
waren anscheinend alle Ämter und anderen Verpfändungen wieder ausgelöst.'" Doch
sollte es bald schon erneut zu Verpfändungen kommen, obwohl anderenorts die Praxis
der Ämterverpfändung im 16. Jahrhundert eher der Vergangenheit angehörte." '
11.3.6 Frühmerkantilismus in Mecklenburg
Zu den Bemühungen, durch Reformen die Finanzverwaltung umzustrukturieren und
durch Zölle und Steuern die Einnahmen zu erhöhen, traten weitere wirtschaftspoliti-
sche Maßnahmen ganz neuartigen Charakters, denen mehr oder minder Erfolg beschie-
den war!"* So plante Magnus den Verkauf von Getreide nach Holland, wobei er zur Ver-
breiterung der eigenen Gewinnspanne Zwischenhändler und die Seestädte Rostock und
Wismar außen vor lassen wollte.*"' Als zwischen 1486 und 1491 sein Ziel eines eigenen
Seetransports am Widerstand der Seestädte und benachbarter Fürsten scheiterte, verfiel
er auf den Gedanken, die Elbe als Schiffahrtsweg zu benutzen, um in Hamburg oder im
Raum Magdeburg mecklenburgisches Getreide zu verkaufen.*"" Auch nach Holland ließ
er über die Elbe Roggen zum Verkauf transportieren. In gleicher Weise nutzte Magnus
die Elbe für seinen Handel mit Holzbrettern, durch den er sich den Holzreichtum seines
Landes zunutze machte. Gleichzeitig betätigte er sich selbst als Zwischenhändler, in-
dem er Waren wie Hering und Speck billig ein- und gewinnbringend weiterverkaufte.
Hier wie beim Bretterhandel stand ihm sein Rentmeister, der schon genannte Klaus
Trutmann, mit Rat und Tat zur Seite. Vom Erlös erwarb Magnus wiederum allerhand
Waren, so in Leipzig Silber für seine Münze, in Magdeburg Salpeter oder in Amsterdam
158 Zitat aus ScHLEiNERT 2001, S. 59f.; siehe auch ebda., S. 60ff. Wie die Vogteien zuvor zu keiner Zeit
flächendeckend gewesen waren, so bestanden innerhalb dieser Ämter ebenfalls zahlreiche Im-
munitäten bezüglich der landesherrlichen Obrigkeit. So hatten sich die größeren Städte meist
schon seit dem 13. Jahrhundert aus der Vogteiorganisation gelöst, während die kleineren sich
entweder mit dem Landesherrn das jeweilige Stadtgericht teilten oder aber in das betreffende
Amt eingefügt blieben. Der schloßgesessene Adel wurde gar nicht von der Ämterorganisation
erfaßt, und selbst der amtsgesessene Adel sollte mit dem Erlaß der Hofgerichtsordnung von
1569 von der Rechtsprechung der Amtshauptleute ausgenommen sein. Trat also augenschein-
lich der gerichtliche Aufgabenbereich des Amtes in seiner Bedeutung mit fortlaufender Zeit im-
mer mehr zurück, nahm im 16. Jahrhundert die Funktion als landesherrlicher Grundherr-
schaftsbezirk beträchtlich an Gewicht zu.
159 AucE2004,S. 19.
160 SCHUBERT 1999, S. 224.
161 Von »merkantilistischen Elementen« spricht für Magnus II. etwa UNVERHAU 1987, S. 665. - Für
Mecklenburg im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts siehe MiLLiES 1937.
162 Dazu und zum Folgenden MiLLiES 1937, S. 7ff.; STEINMANN 1922, S. 118ff.
163 LAS, Bestand 11.11, Nr. 19566 (1486), 21122 (vor 29. April 1491), 21215 (6. August 1491), 21221
(12. August 1491).