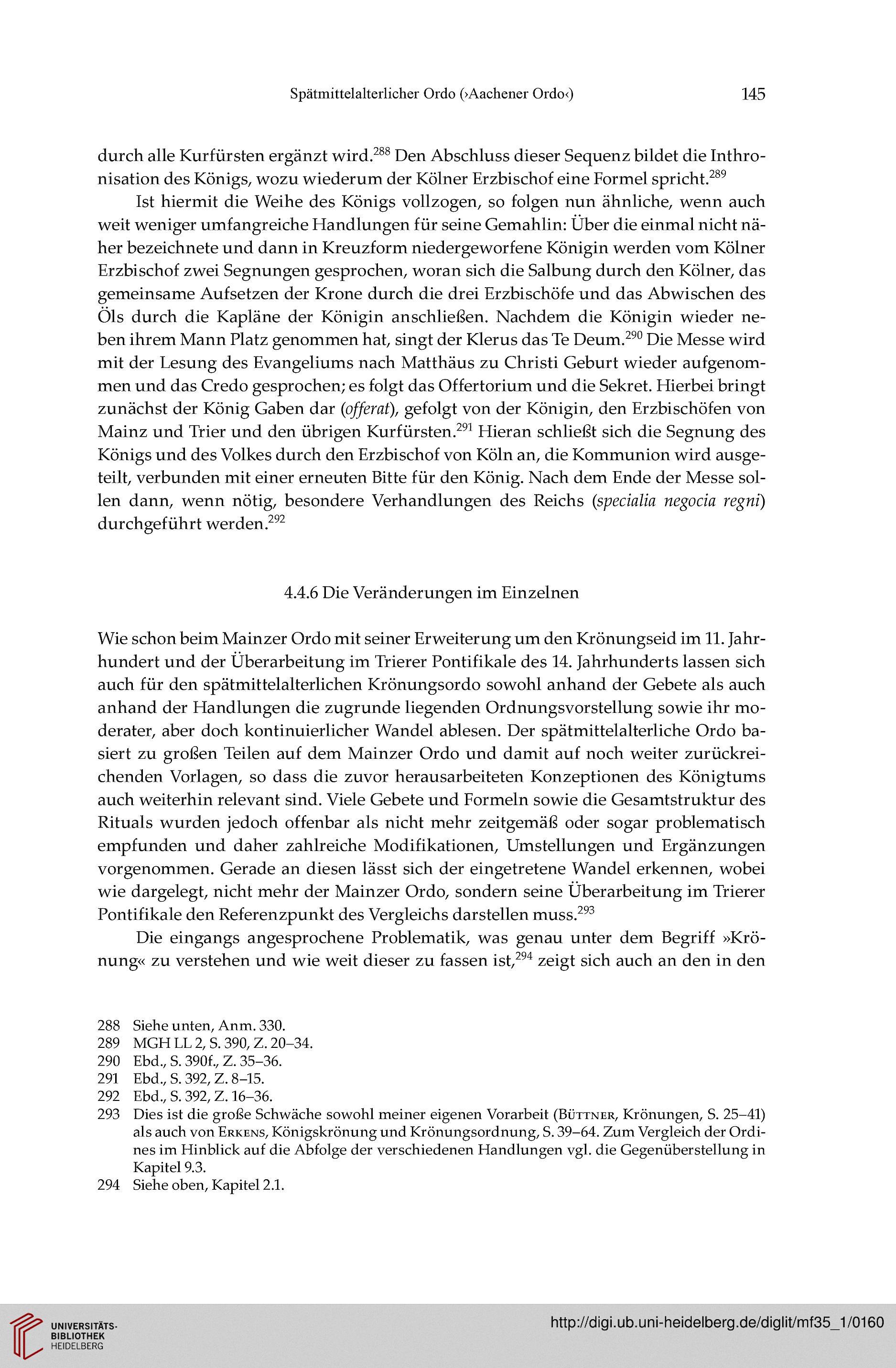Spätmittelalterlicher Ordo (>Aachener Ordo<)
145
durch alle Kurfürsten ergänzt wird?^ Den Abschluss dieser Sequenz bildet die Inthro-
nisation des Königs, wozu wiederum der Kölner Erzbischof eine Formel spricht?^"
Ist hiermit die Weihe des Königs vollzogen, so folgen nun ähnliche, wenn auch
weit weniger umfangreiche Handlungen für seine Gemahlin: Uber die einmal nicht nä-
her bezeichnete und dann in Kreuzform niedergeworfene Königin werden vom Kölner
Erzbischof zwei Segnungen gesprochen, woran sich die Salbung durch den Kölner, das
gemeinsame Aufsetzen der Krone durch die drei Erzbischöfe und das Abwischen des
Öls durch die Kapläne der Königin anschließen. Nachdem die Königin wieder ne-
ben ihrem Mann Platz genommen hat, singt der Klerus das Te Deum?"" Die Messe wird
mit der Lesung des Evangeliums nach Matthäus zu Christi Geburt wieder aufgenom-
men und das Credo gesprochen; es folgt das Offertorium und die Sekret. Hierbei bringt
zunächst der König Gaben dar (o^crat), gefolgt von der Königin, den Erzbischöfen von
Mainz und Trier und den übrigen Kurfürsten?" Hieran schließt sich die Segnung des
Königs und des Volkes durch den Erzbischof von Köln an, die Kommunion wird ausge-
teilt, verbunden mit einer erneuten Bitte für den König. Nach dem Ende der Messe sol-
len dann, wenn nötig, besondere Verhandlungen des Reichs (speczaEa negocza regtiz)
durchgeführt werden?""
4.4.6 Die Veränderungen im Einzelnen
Wie schon beim Mainzer Ordo mit seiner Erweiterung um den Krönungseid im 11. Jahr-
hundert und der Überarbeitung im Trierer Pontifikale des 14. Jahrhunderts lassen sich
auch für den spätmittelalterlichen Krönungsordo sowohl anhand der Gebete als auch
anhand der Handlungen die zugrunde liegenden Ordnungsvorstellung sowie ihr mo-
derater, aber doch kontinuierlicher Wandel ablesen. Der spätmittelalterliche Ordo ba-
siert zu großen Teilen auf dem Mainzer Ordo und damit auf noch weiter zurückrei-
chenden Vorlagen, so dass die zuvor herausarbeiteten Konzeptionen des Königtums
auch weiterhin relevant sind. Viele Gebete und Formeln sowie die Gesamtstruktur des
Rituals wurden jedoch offenbar als nicht mehr zeitgemäß oder sogar problematisch
empfunden und daher zahlreiche Modifikationen, Umstellungen und Ergänzungen
vorgenommen. Gerade an diesen lässt sich der eingetretene Wandel erkennen, wobei
wie dargelegt, nicht mehr der Mainzer Ordo, sondern seine Überarbeitung im Trierer
Pontifikale den Referenzpunkt des Vergleichs darstellen muss?""
Die eingangs angesprochene Problematik, was genau unter dem Begriff »Krö-
nung« zu verstehen und wie weit dieser zu fassen ist?"" zeigt sich auch an den in den
288 Siehe unten, Anm. 330.
289 MGH LL 2, S. 390, Z. 20-34.
290 Ebd., S. 390f., Z. 35-36.
291 Ebd., S. 392, Z. 8-15.
292 Ebd., S. 392, Z. 16-36.
293 Dies ist die große Schwäche sowohl meiner eigenen Vorarbeit (BÜTTNER, Krönungen, S. 25-41)
als auch von ERKENS, Königskrönung und Krönungsordnung, S. 39-64. Zum Vergleich der Ordi-
nes im Hinblick auf die Abfolge der verschiedenen Handlungen vgl. die Gegenüberstellung in
Kapitel 9.3.
294 Siehe oben, Kapitel 2.1.
145
durch alle Kurfürsten ergänzt wird?^ Den Abschluss dieser Sequenz bildet die Inthro-
nisation des Königs, wozu wiederum der Kölner Erzbischof eine Formel spricht?^"
Ist hiermit die Weihe des Königs vollzogen, so folgen nun ähnliche, wenn auch
weit weniger umfangreiche Handlungen für seine Gemahlin: Uber die einmal nicht nä-
her bezeichnete und dann in Kreuzform niedergeworfene Königin werden vom Kölner
Erzbischof zwei Segnungen gesprochen, woran sich die Salbung durch den Kölner, das
gemeinsame Aufsetzen der Krone durch die drei Erzbischöfe und das Abwischen des
Öls durch die Kapläne der Königin anschließen. Nachdem die Königin wieder ne-
ben ihrem Mann Platz genommen hat, singt der Klerus das Te Deum?"" Die Messe wird
mit der Lesung des Evangeliums nach Matthäus zu Christi Geburt wieder aufgenom-
men und das Credo gesprochen; es folgt das Offertorium und die Sekret. Hierbei bringt
zunächst der König Gaben dar (o^crat), gefolgt von der Königin, den Erzbischöfen von
Mainz und Trier und den übrigen Kurfürsten?" Hieran schließt sich die Segnung des
Königs und des Volkes durch den Erzbischof von Köln an, die Kommunion wird ausge-
teilt, verbunden mit einer erneuten Bitte für den König. Nach dem Ende der Messe sol-
len dann, wenn nötig, besondere Verhandlungen des Reichs (speczaEa negocza regtiz)
durchgeführt werden?""
4.4.6 Die Veränderungen im Einzelnen
Wie schon beim Mainzer Ordo mit seiner Erweiterung um den Krönungseid im 11. Jahr-
hundert und der Überarbeitung im Trierer Pontifikale des 14. Jahrhunderts lassen sich
auch für den spätmittelalterlichen Krönungsordo sowohl anhand der Gebete als auch
anhand der Handlungen die zugrunde liegenden Ordnungsvorstellung sowie ihr mo-
derater, aber doch kontinuierlicher Wandel ablesen. Der spätmittelalterliche Ordo ba-
siert zu großen Teilen auf dem Mainzer Ordo und damit auf noch weiter zurückrei-
chenden Vorlagen, so dass die zuvor herausarbeiteten Konzeptionen des Königtums
auch weiterhin relevant sind. Viele Gebete und Formeln sowie die Gesamtstruktur des
Rituals wurden jedoch offenbar als nicht mehr zeitgemäß oder sogar problematisch
empfunden und daher zahlreiche Modifikationen, Umstellungen und Ergänzungen
vorgenommen. Gerade an diesen lässt sich der eingetretene Wandel erkennen, wobei
wie dargelegt, nicht mehr der Mainzer Ordo, sondern seine Überarbeitung im Trierer
Pontifikale den Referenzpunkt des Vergleichs darstellen muss?""
Die eingangs angesprochene Problematik, was genau unter dem Begriff »Krö-
nung« zu verstehen und wie weit dieser zu fassen ist?"" zeigt sich auch an den in den
288 Siehe unten, Anm. 330.
289 MGH LL 2, S. 390, Z. 20-34.
290 Ebd., S. 390f., Z. 35-36.
291 Ebd., S. 392, Z. 8-15.
292 Ebd., S. 392, Z. 16-36.
293 Dies ist die große Schwäche sowohl meiner eigenen Vorarbeit (BÜTTNER, Krönungen, S. 25-41)
als auch von ERKENS, Königskrönung und Krönungsordnung, S. 39-64. Zum Vergleich der Ordi-
nes im Hinblick auf die Abfolge der verschiedenen Handlungen vgl. die Gegenüberstellung in
Kapitel 9.3.
294 Siehe oben, Kapitel 2.1.