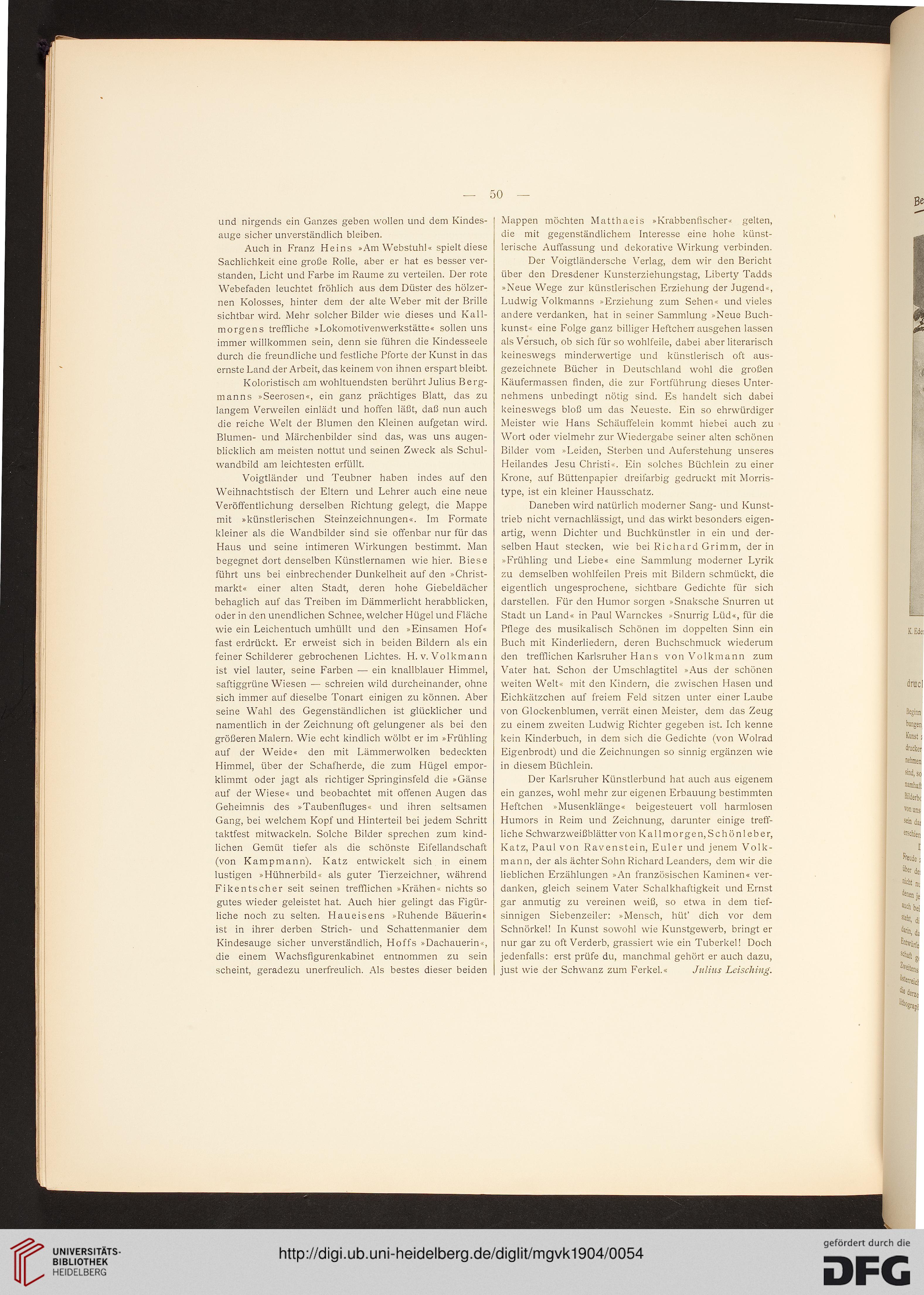und nirgends ein Ganzes geben wollen und dem Kindes-
auge sicher unverständlich bleiben.
Auch in Franz Heins »Am Webstuhl« spielt diese
Sachlichkeit eine große Rolle, aber er hat es besser ver-
standen, Licht und Farbe im Räume zu verteilen. Der rote
Webefaden leuchtet fröhlich aus dem Düster des hölzer-
nen Kolosses, hinter dem der alte Weber mit der Brille
sichtbar wird. Mehr solcher Bilder wie dieses und Kall-
morgens treffliche »Lokomotivenwerkstätte« sollen uns
immer willkommen sein, denn sie führen die Kindesseele
durch die freundliche und festliche Pforte der Kunst in das
ernste Land der Arbeit, das keinem von ihnen erspart bleibt.
Koloristisch am wohltuendsten berührt Julius Berg-
manns »Seerosen«, ein ganz prächtiges Blatt, das zu
langem Verweilen einlädt und hoffen läßt, daß nun auch
die reiche Welt der Blumen den Kleinen aufgetan wird.
Blumen- und Märchenbilder sind das, was uns augen-
blicklich am meisten nottut und seinen Zweck als Schul-
wandbild am leichtesten erfüllt.
Voigtländer und Teubner haben indes auf den
Weihnachtstisch der Eltern und Lehrer auch eine neue
Veröffentlichung derselben Richtung gelegt, die Mappe
mit »künstlerischen Steinzeichnungen«. Im Formate
kleiner als die Wandbilder sind sie offenbar nur für das
Haus und seine intimeren Wirkungen bestimmt. Man
begegnet dort denselben Künstlernamen wie hier. Biese
führt uns bei einbrechender Dunkelheit auf den »Christ-
markt« einer alten Stadt, deren hohe Giebeldächer
behaglich auf das Treiben im Dämmerlicht herabblicken,
oder in den unendlichen Schnee, welcher Hügel und Fläche
wie ein Leichentuch umhüllt und den »Einsamen Hof«
fast erdrückt. Er erweist sich in beiden Bildern als ein
feiner Schilderer gebrochenen Lichtes. H. v. Volkmann
ist viel lauter, seine Farben — ein knallblauer Himmel,
saftiggrüne Wiesen — schreien wild durcheinander, ohne
sich immer auf dieselbe Tonart einigen zu können. Aber
seine Wahl des Gegenständlichen ist glücklicher und
namentlich in der Zeichnung oft gelungener als bei den
größeren Malern. Wie echt kindlich wölbt er im »Frühling
auf der Weide« den mit Lämmerwolken bedeckten
Himmel, über der Schafherde, die zum Hügel empor-
klimmt oder jagt als richtiger Springinsfeld die »Gänse
auf der Wiese« und beobachtet mit offenen Augen das
Geheimnis des »Taubenfluges« und ihren seltsamen
Gang, bei welchem Kopf und Hinterteil bei jedem Schritt
taktfest mitwackeln. Solche Bilder sprechen zum kind-
lichen Gemüt tiefer als die schönste Eifellandschaft
(von Kampmann). Katz entwickelt sich in einem
lustigen »Hühnerbild« als guter Tierzeichner, während
Fikentscher seit seinen trefflichen »Krähen« nichts so
gutes wieder geleistet hat. Auch hier gelingt das Figür-
liche noch zu selten. Haueisens »Ruhende Bäuerin«
ist in ihrer derben Strich- und Schattenmanier dem
Kindesauge sicher unverständlich, Hoffs »Dachauerin«,
die einem Wachsfigurenkabinet entnommen zu sein
scheint, geradezu unerfreulich. Als bestes dieser beiden
Mappen möchten Matthaeis »Krabbenfischer« gelten,
die mit gegenständlichem Interesse eine hohe künst-
lerische Auffassung und dekorative Wirkung verbinden.
Der Voigtländersche Verlag, dem wir den Bericht
über den Dresdener Kunsterziehungstag, Liberty Tadds
»Neue Wege zur künstlerischen Erziehung der Jugend«,
Ludwig Volkmanns »Erziehung zum Sehen« und vieles
andere verdanken, hat in seiner Sammlung »Neue Buch-
kunst« eine Folge ganz billiger Heftcherr ausgehen lassen
als Versuch, ob sich für so wohlfeile, dabei aber literarisch
keineswegs minderwertige und künstlerisch oft aus-
gezeichnete Bücher in Deutschland wohl die großen
Käufermassen finden, die zur Fortführung dieses Unter-
nehmens unbedingt nötig sind. Es handelt sich dabei
keineswegs bloß um das Neueste. Ein so ehrwürdiger
Meister wie Hans Schäuffelein kommt hiebei auch zu
Wort oder vielmehr zur Wiedergabe seiner alten schönen
Bilder vom »Leiden, Sterben und Auferstehung unseres
Heilandes Jesu Christi«. Ein solches Büchlein zu einer
Krone, auf Büttenpapier dreifarbig gedruckt mit Morris-
type, ist ein kleiner Hausschatz.
Daneben wird natürlich moderner Sang- und Kunst-
trieb nicht vernachlässigt, und das wirkt besonders eigen-
artig, wenn Dichter und Buchkünstler in ein und der-
selben Haut stecken, wie bei Richard Grimm, der in
»Frühling und Liebe« eine Sammlung moderner Lyrik
zu demselben wohlfeilen Preis mit Bildern schmückt, die
eigentlich ungesprochene, sichtbare Gedichte für sich
darstellen. Für den Humor sorgen »Snaksche Snurren ut
Stadt un Land« in Paul Warnckes »Snurrig Lüd«, für die
Pflege des musikalisch Schönen im doppelten Sinn ein
Buch mit Kinderliedern, deren Buchschmuck wiederum
den trefflichen Karlsruher Hans von Volkmann zum
Vater hat. Schon der Umschlagtitel »Aus der schönen
weiten Welt« mit den Kindern, die zwischen Hasen und
Eichkätzchen auf freiem Feld sitzen unter einer Laube
von Glockenblumen, verrät einen Meister, dem das Zeug
zu einem zweiten Ludwig Richter gegeben ist. Ich kenne
kein Kinderbuch, in dem sich die Gedichte (von Wolrad
Eigenbrodt) und die Zeichnungen so sinnig ergänzen wie
in diesem Büchlein.
Der Karlsruher Künstlerbund hat auch aus eigenem
ein ganzes, wohl mehr zur eigenen Erbauung bestimmten
Heftchen »Musenklänge« beigesteuert voll harmlosen
Humors in Reim und Zeichnung, darunter einige treff-
liche Schwarzweißblätter von Kallmorgen, Schönleber,
Katz, Paul von Ravenstein, Euler und jenem Volk-
mann, der als ächter Sohn Richard Leanders, dem wir die
lieblichen Erzählungen »An französischen Kaminen« ver-
danken, gleich seinem Vater Schalkhaftigkeit und Ernst
gar anmutig zu vereinen weiß, so etwa in dem tief-
sinnigen Siebenzeiler: »Mensch, hüt' dich vor dem
Schnörkel! In Kunst sowohl wie Kunstgewerb, bringt er
nur gar zu oft Verderb, grassiert wie ein Tuberkel! Doch
jedenfalls: erst prüfe du, manchmal gehört er auch dazu,
just wie der Schwanz zum Ferkel.« Julius Leischiug.
auge sicher unverständlich bleiben.
Auch in Franz Heins »Am Webstuhl« spielt diese
Sachlichkeit eine große Rolle, aber er hat es besser ver-
standen, Licht und Farbe im Räume zu verteilen. Der rote
Webefaden leuchtet fröhlich aus dem Düster des hölzer-
nen Kolosses, hinter dem der alte Weber mit der Brille
sichtbar wird. Mehr solcher Bilder wie dieses und Kall-
morgens treffliche »Lokomotivenwerkstätte« sollen uns
immer willkommen sein, denn sie führen die Kindesseele
durch die freundliche und festliche Pforte der Kunst in das
ernste Land der Arbeit, das keinem von ihnen erspart bleibt.
Koloristisch am wohltuendsten berührt Julius Berg-
manns »Seerosen«, ein ganz prächtiges Blatt, das zu
langem Verweilen einlädt und hoffen läßt, daß nun auch
die reiche Welt der Blumen den Kleinen aufgetan wird.
Blumen- und Märchenbilder sind das, was uns augen-
blicklich am meisten nottut und seinen Zweck als Schul-
wandbild am leichtesten erfüllt.
Voigtländer und Teubner haben indes auf den
Weihnachtstisch der Eltern und Lehrer auch eine neue
Veröffentlichung derselben Richtung gelegt, die Mappe
mit »künstlerischen Steinzeichnungen«. Im Formate
kleiner als die Wandbilder sind sie offenbar nur für das
Haus und seine intimeren Wirkungen bestimmt. Man
begegnet dort denselben Künstlernamen wie hier. Biese
führt uns bei einbrechender Dunkelheit auf den »Christ-
markt« einer alten Stadt, deren hohe Giebeldächer
behaglich auf das Treiben im Dämmerlicht herabblicken,
oder in den unendlichen Schnee, welcher Hügel und Fläche
wie ein Leichentuch umhüllt und den »Einsamen Hof«
fast erdrückt. Er erweist sich in beiden Bildern als ein
feiner Schilderer gebrochenen Lichtes. H. v. Volkmann
ist viel lauter, seine Farben — ein knallblauer Himmel,
saftiggrüne Wiesen — schreien wild durcheinander, ohne
sich immer auf dieselbe Tonart einigen zu können. Aber
seine Wahl des Gegenständlichen ist glücklicher und
namentlich in der Zeichnung oft gelungener als bei den
größeren Malern. Wie echt kindlich wölbt er im »Frühling
auf der Weide« den mit Lämmerwolken bedeckten
Himmel, über der Schafherde, die zum Hügel empor-
klimmt oder jagt als richtiger Springinsfeld die »Gänse
auf der Wiese« und beobachtet mit offenen Augen das
Geheimnis des »Taubenfluges« und ihren seltsamen
Gang, bei welchem Kopf und Hinterteil bei jedem Schritt
taktfest mitwackeln. Solche Bilder sprechen zum kind-
lichen Gemüt tiefer als die schönste Eifellandschaft
(von Kampmann). Katz entwickelt sich in einem
lustigen »Hühnerbild« als guter Tierzeichner, während
Fikentscher seit seinen trefflichen »Krähen« nichts so
gutes wieder geleistet hat. Auch hier gelingt das Figür-
liche noch zu selten. Haueisens »Ruhende Bäuerin«
ist in ihrer derben Strich- und Schattenmanier dem
Kindesauge sicher unverständlich, Hoffs »Dachauerin«,
die einem Wachsfigurenkabinet entnommen zu sein
scheint, geradezu unerfreulich. Als bestes dieser beiden
Mappen möchten Matthaeis »Krabbenfischer« gelten,
die mit gegenständlichem Interesse eine hohe künst-
lerische Auffassung und dekorative Wirkung verbinden.
Der Voigtländersche Verlag, dem wir den Bericht
über den Dresdener Kunsterziehungstag, Liberty Tadds
»Neue Wege zur künstlerischen Erziehung der Jugend«,
Ludwig Volkmanns »Erziehung zum Sehen« und vieles
andere verdanken, hat in seiner Sammlung »Neue Buch-
kunst« eine Folge ganz billiger Heftcherr ausgehen lassen
als Versuch, ob sich für so wohlfeile, dabei aber literarisch
keineswegs minderwertige und künstlerisch oft aus-
gezeichnete Bücher in Deutschland wohl die großen
Käufermassen finden, die zur Fortführung dieses Unter-
nehmens unbedingt nötig sind. Es handelt sich dabei
keineswegs bloß um das Neueste. Ein so ehrwürdiger
Meister wie Hans Schäuffelein kommt hiebei auch zu
Wort oder vielmehr zur Wiedergabe seiner alten schönen
Bilder vom »Leiden, Sterben und Auferstehung unseres
Heilandes Jesu Christi«. Ein solches Büchlein zu einer
Krone, auf Büttenpapier dreifarbig gedruckt mit Morris-
type, ist ein kleiner Hausschatz.
Daneben wird natürlich moderner Sang- und Kunst-
trieb nicht vernachlässigt, und das wirkt besonders eigen-
artig, wenn Dichter und Buchkünstler in ein und der-
selben Haut stecken, wie bei Richard Grimm, der in
»Frühling und Liebe« eine Sammlung moderner Lyrik
zu demselben wohlfeilen Preis mit Bildern schmückt, die
eigentlich ungesprochene, sichtbare Gedichte für sich
darstellen. Für den Humor sorgen »Snaksche Snurren ut
Stadt un Land« in Paul Warnckes »Snurrig Lüd«, für die
Pflege des musikalisch Schönen im doppelten Sinn ein
Buch mit Kinderliedern, deren Buchschmuck wiederum
den trefflichen Karlsruher Hans von Volkmann zum
Vater hat. Schon der Umschlagtitel »Aus der schönen
weiten Welt« mit den Kindern, die zwischen Hasen und
Eichkätzchen auf freiem Feld sitzen unter einer Laube
von Glockenblumen, verrät einen Meister, dem das Zeug
zu einem zweiten Ludwig Richter gegeben ist. Ich kenne
kein Kinderbuch, in dem sich die Gedichte (von Wolrad
Eigenbrodt) und die Zeichnungen so sinnig ergänzen wie
in diesem Büchlein.
Der Karlsruher Künstlerbund hat auch aus eigenem
ein ganzes, wohl mehr zur eigenen Erbauung bestimmten
Heftchen »Musenklänge« beigesteuert voll harmlosen
Humors in Reim und Zeichnung, darunter einige treff-
liche Schwarzweißblätter von Kallmorgen, Schönleber,
Katz, Paul von Ravenstein, Euler und jenem Volk-
mann, der als ächter Sohn Richard Leanders, dem wir die
lieblichen Erzählungen »An französischen Kaminen« ver-
danken, gleich seinem Vater Schalkhaftigkeit und Ernst
gar anmutig zu vereinen weiß, so etwa in dem tief-
sinnigen Siebenzeiler: »Mensch, hüt' dich vor dem
Schnörkel! In Kunst sowohl wie Kunstgewerb, bringt er
nur gar zu oft Verderb, grassiert wie ein Tuberkel! Doch
jedenfalls: erst prüfe du, manchmal gehört er auch dazu,
just wie der Schwanz zum Ferkel.« Julius Leischiug.