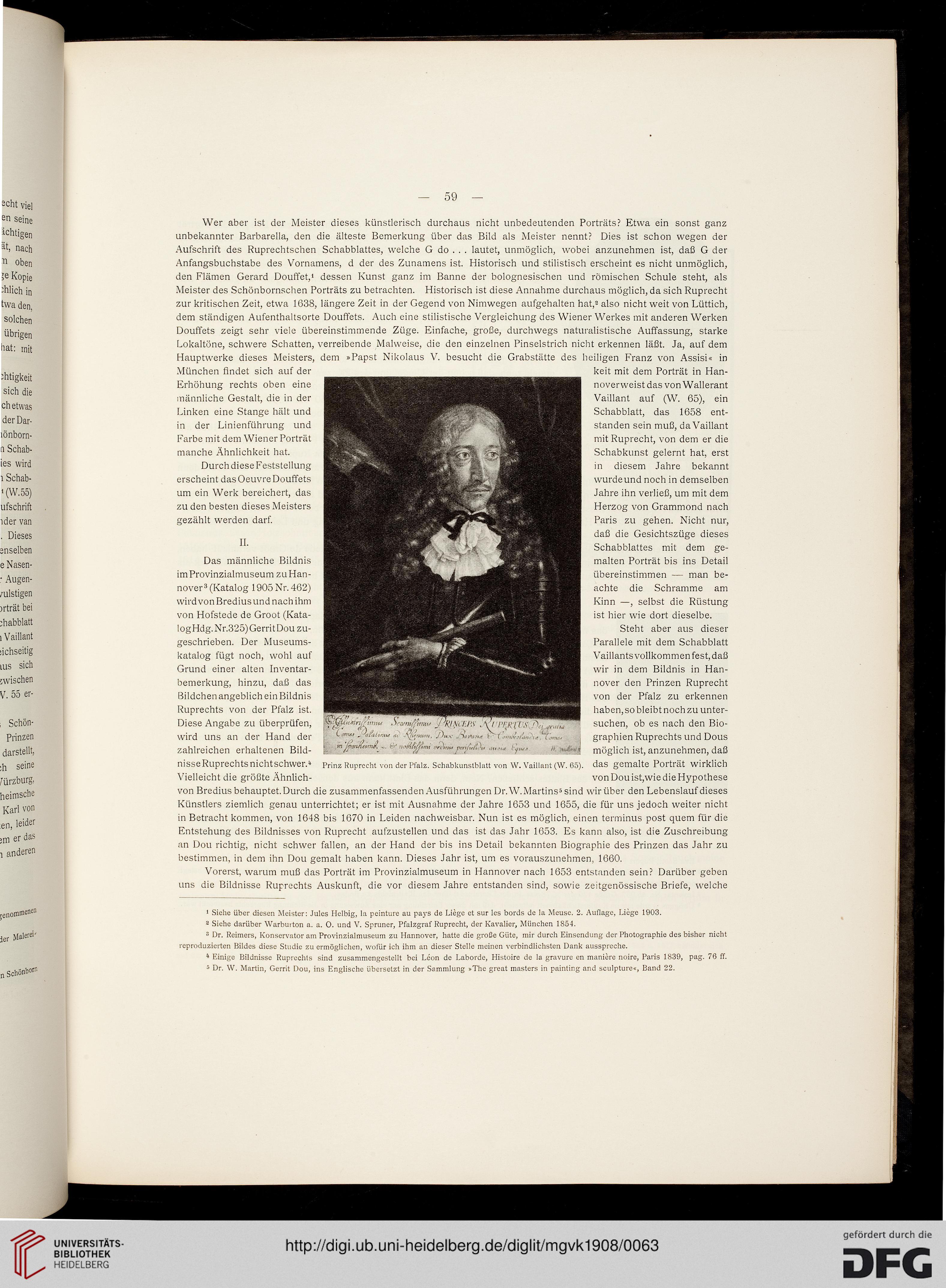Wer aber ist der Meister dieses künstlerisch durchaus nicht unbedeutenden Porträts? Etwa ein sonst ganz
unbekannter Barbarella, den die älteste Bemerkung über das Bild als Meister nennt? Dies ist schon wegen der
Aufschrift des Ruprechtschen Schabblattes, welche G do . . . lautet, unmöglich, wobei anzunehmen ist, daß G der
Anfangsbuchstabe des Vornamens, d der des Zunamens ist. Historisch und stilistisch erscheint es nicht unmöglich,
den Flämen Gerard Douffet,1 dessen Kunst ganz im Banne der bolognesischen und römischen Schule steht, als
Meister des Schönbornschen Porträts zu betrachten. Historisch ist diese Annahme durchaus möglich, da sich Ruprecht
zur kritischen Zeit, etwa 1G38, längere Zeit in der Gegend von Nimwegen aufgehalten hat,3 also nicht weit von Lüttich,
dem ständigen Aufenthaltsorte Douffets. Auch eine stilistische Vergleichung des Wiener Werkes mit anderen Werken
Douffets zeigt sehr viele übereinstimmende Züge. Einfache, große, durchwegs naturalistische Auffassung, starke
Lokaltöne, schwere Schatten, verreibende Malweise, die den einzelnen Pinselstrich nicht erkennen läßt. Ja, auf dem
Hauptwerke dieses Meisters, dem »Papst Nikolaus V. besucht die Grabstätte des heiligen Franz von Assisi« in
München findet sich auf der
Erhöhung rechts oben eine
männliche Gestalt, die in der
Linken eine Stange hält und
in der Linienführung und
Farbe mit dem Wiener Porträt
manche Ähnlichkeit hat.
Durch diese Feststellung
erscheint das Oeuvre Douffets
um ein Werk bereichert, das
zu den besten dieses Meisters
gezählt werden darf.
II.
Das männliche Bildnis
imProvinzialmuseum zu Han-
nover 3 (Katalog 1905 Nr. 462)
wird von Bredius und nach ihm
von Hofstede de Groot (Kata-
logHdg.Nr.325)GerritDou zu-
geschrieben. Der Museums-
katalog fügt noch, wohl auf
Grund einer alten Inventar-
bemerkung, hinzu, daß das
Bildchen angeblich ein Bildnis
Ruprechts von der Pfalz ist.
Diese Angabe zu überprüfen,
wird uns an der Hand der
zahlreichen erhaltenen Bild-
nisse Ruprechts nicht schwer.*
Vielleicht die größte Ahnlich-
von Bredius behauptet. Durch die zusammenfassenden Ausführungen Dr. W.Martins5 sind wir über den Lebenslauf dieses
Künstlers ziemlich genau unterrichtet; er ist mit Ausnahme der Jahre 1653 und 1655, die für uns jedoch weiter nicht
in Betracht kommen, von 1648 bis 1670 in Leiden nachweisbar. Nun ist es möglich, einen terminus post quem für die
Entstehung des Bildnisses von Ruprecht aufzustellen und das ist das Jahr 1653. Es kann also, ist die Zuschreibung
an Doli richtig, nicht schwer fallen, an der Hand der bis ins Detail bekannten Biographie des Prinzen das Jahr zu
bestimmen, in dem ihn Dou gemalt haben kann. Dieses Jahr ist, um es vorauszunehmen, 1660.
Vorerst, warum muß das Porträt im Provinzialmuseum in Hannover nach 1653 entstanden sein? Darüber geben
uns die Bildnisse Ruprechts Auskunft, die vor diesem Jahre entstanden sind, sowie zeitgenössische Briefe, welche
IIP .'.«« SevnMmu JhiISi WS ,'\7 l'KK fl ,\ '\,^~,
Prinz Ruprecht von der Pfalz. Schabkunstblatt von W. Vaillant (W. 65).
keit mit dem Porträt in Han-
noverweist das vonWallerant
Vaillant auf (W. 65), ein
Schabblatt, das 1658 ent-
standen sein muß, da Vaillant
mit Ruprecht, von dem er die
Schabkunst gelernt hat, erst
in diesem Jahre bekannt
wurdeund noch in demselben
Jahre ihn verließ, um mit dem
Herzog von Grammond nach
Paris zu gehen. Nicht nur,
daß die Gesichtszüge dieses
Schabblattes mit dem ge-
malten Porträt bis ins Detail
übereinstimmen — man be-
achte die Schramme am
Kinn —, selbst die Rüstung
ist hier wie dort dieselbe.
Steht aber aus dieser
Parallele mit dem Schabblatt
Vaillants vollkommen fest, daß
wir in dem Bildnis in Han-
nover den Prinzen Ruprecht
von der Pfalz zu erkennen
haben, so bleibt noch zu unter-
suchen, ob es nach den Bio-
graphien Ruprechts und Dous
möglich ist, anzunehmen, daß
das gemalte Porträt wirklich
von Dou ist,wie die Hypothese
1 Siehe über diesen Meister: Jules Heibig, la peinture au pays de Liege et sur les bords de la Meuse. 2. Auflage, Liege 1903.
2 Siehe darüber Warburton a. a. 0. und V. Spruner, Pfalzgraf Ruprecht, der Kavalier, München 1854.
• Dr. Reimers, Konservator am Provinzialmuseum zu Hannover, hatte die große Güte, mir durch Einsendung der Photographie des bisher nicht
reproduzierten Bildes diese Studie zu ermöglichen, wofür ich ihm an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank ausspreche.
* Einige Bildnisse Ruprechts sind zusammengestellt bei Leon de Laborde, Histoire de la gravure en maniere noire, Paris 1839, pag. 76 ff.
■r> Dr. W. Martin, Gerrit Dou, ins Englische übersetzt in der Sammlung »The great masters in painting and sculpture«, Band 22.
unbekannter Barbarella, den die älteste Bemerkung über das Bild als Meister nennt? Dies ist schon wegen der
Aufschrift des Ruprechtschen Schabblattes, welche G do . . . lautet, unmöglich, wobei anzunehmen ist, daß G der
Anfangsbuchstabe des Vornamens, d der des Zunamens ist. Historisch und stilistisch erscheint es nicht unmöglich,
den Flämen Gerard Douffet,1 dessen Kunst ganz im Banne der bolognesischen und römischen Schule steht, als
Meister des Schönbornschen Porträts zu betrachten. Historisch ist diese Annahme durchaus möglich, da sich Ruprecht
zur kritischen Zeit, etwa 1G38, längere Zeit in der Gegend von Nimwegen aufgehalten hat,3 also nicht weit von Lüttich,
dem ständigen Aufenthaltsorte Douffets. Auch eine stilistische Vergleichung des Wiener Werkes mit anderen Werken
Douffets zeigt sehr viele übereinstimmende Züge. Einfache, große, durchwegs naturalistische Auffassung, starke
Lokaltöne, schwere Schatten, verreibende Malweise, die den einzelnen Pinselstrich nicht erkennen läßt. Ja, auf dem
Hauptwerke dieses Meisters, dem »Papst Nikolaus V. besucht die Grabstätte des heiligen Franz von Assisi« in
München findet sich auf der
Erhöhung rechts oben eine
männliche Gestalt, die in der
Linken eine Stange hält und
in der Linienführung und
Farbe mit dem Wiener Porträt
manche Ähnlichkeit hat.
Durch diese Feststellung
erscheint das Oeuvre Douffets
um ein Werk bereichert, das
zu den besten dieses Meisters
gezählt werden darf.
II.
Das männliche Bildnis
imProvinzialmuseum zu Han-
nover 3 (Katalog 1905 Nr. 462)
wird von Bredius und nach ihm
von Hofstede de Groot (Kata-
logHdg.Nr.325)GerritDou zu-
geschrieben. Der Museums-
katalog fügt noch, wohl auf
Grund einer alten Inventar-
bemerkung, hinzu, daß das
Bildchen angeblich ein Bildnis
Ruprechts von der Pfalz ist.
Diese Angabe zu überprüfen,
wird uns an der Hand der
zahlreichen erhaltenen Bild-
nisse Ruprechts nicht schwer.*
Vielleicht die größte Ahnlich-
von Bredius behauptet. Durch die zusammenfassenden Ausführungen Dr. W.Martins5 sind wir über den Lebenslauf dieses
Künstlers ziemlich genau unterrichtet; er ist mit Ausnahme der Jahre 1653 und 1655, die für uns jedoch weiter nicht
in Betracht kommen, von 1648 bis 1670 in Leiden nachweisbar. Nun ist es möglich, einen terminus post quem für die
Entstehung des Bildnisses von Ruprecht aufzustellen und das ist das Jahr 1653. Es kann also, ist die Zuschreibung
an Doli richtig, nicht schwer fallen, an der Hand der bis ins Detail bekannten Biographie des Prinzen das Jahr zu
bestimmen, in dem ihn Dou gemalt haben kann. Dieses Jahr ist, um es vorauszunehmen, 1660.
Vorerst, warum muß das Porträt im Provinzialmuseum in Hannover nach 1653 entstanden sein? Darüber geben
uns die Bildnisse Ruprechts Auskunft, die vor diesem Jahre entstanden sind, sowie zeitgenössische Briefe, welche
IIP .'.«« SevnMmu JhiISi WS ,'\7 l'KK fl ,\ '\,^~,
Prinz Ruprecht von der Pfalz. Schabkunstblatt von W. Vaillant (W. 65).
keit mit dem Porträt in Han-
noverweist das vonWallerant
Vaillant auf (W. 65), ein
Schabblatt, das 1658 ent-
standen sein muß, da Vaillant
mit Ruprecht, von dem er die
Schabkunst gelernt hat, erst
in diesem Jahre bekannt
wurdeund noch in demselben
Jahre ihn verließ, um mit dem
Herzog von Grammond nach
Paris zu gehen. Nicht nur,
daß die Gesichtszüge dieses
Schabblattes mit dem ge-
malten Porträt bis ins Detail
übereinstimmen — man be-
achte die Schramme am
Kinn —, selbst die Rüstung
ist hier wie dort dieselbe.
Steht aber aus dieser
Parallele mit dem Schabblatt
Vaillants vollkommen fest, daß
wir in dem Bildnis in Han-
nover den Prinzen Ruprecht
von der Pfalz zu erkennen
haben, so bleibt noch zu unter-
suchen, ob es nach den Bio-
graphien Ruprechts und Dous
möglich ist, anzunehmen, daß
das gemalte Porträt wirklich
von Dou ist,wie die Hypothese
1 Siehe über diesen Meister: Jules Heibig, la peinture au pays de Liege et sur les bords de la Meuse. 2. Auflage, Liege 1903.
2 Siehe darüber Warburton a. a. 0. und V. Spruner, Pfalzgraf Ruprecht, der Kavalier, München 1854.
• Dr. Reimers, Konservator am Provinzialmuseum zu Hannover, hatte die große Güte, mir durch Einsendung der Photographie des bisher nicht
reproduzierten Bildes diese Studie zu ermöglichen, wofür ich ihm an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank ausspreche.
* Einige Bildnisse Ruprechts sind zusammengestellt bei Leon de Laborde, Histoire de la gravure en maniere noire, Paris 1839, pag. 76 ff.
■r> Dr. W. Martin, Gerrit Dou, ins Englische übersetzt in der Sammlung »The great masters in painting and sculpture«, Band 22.