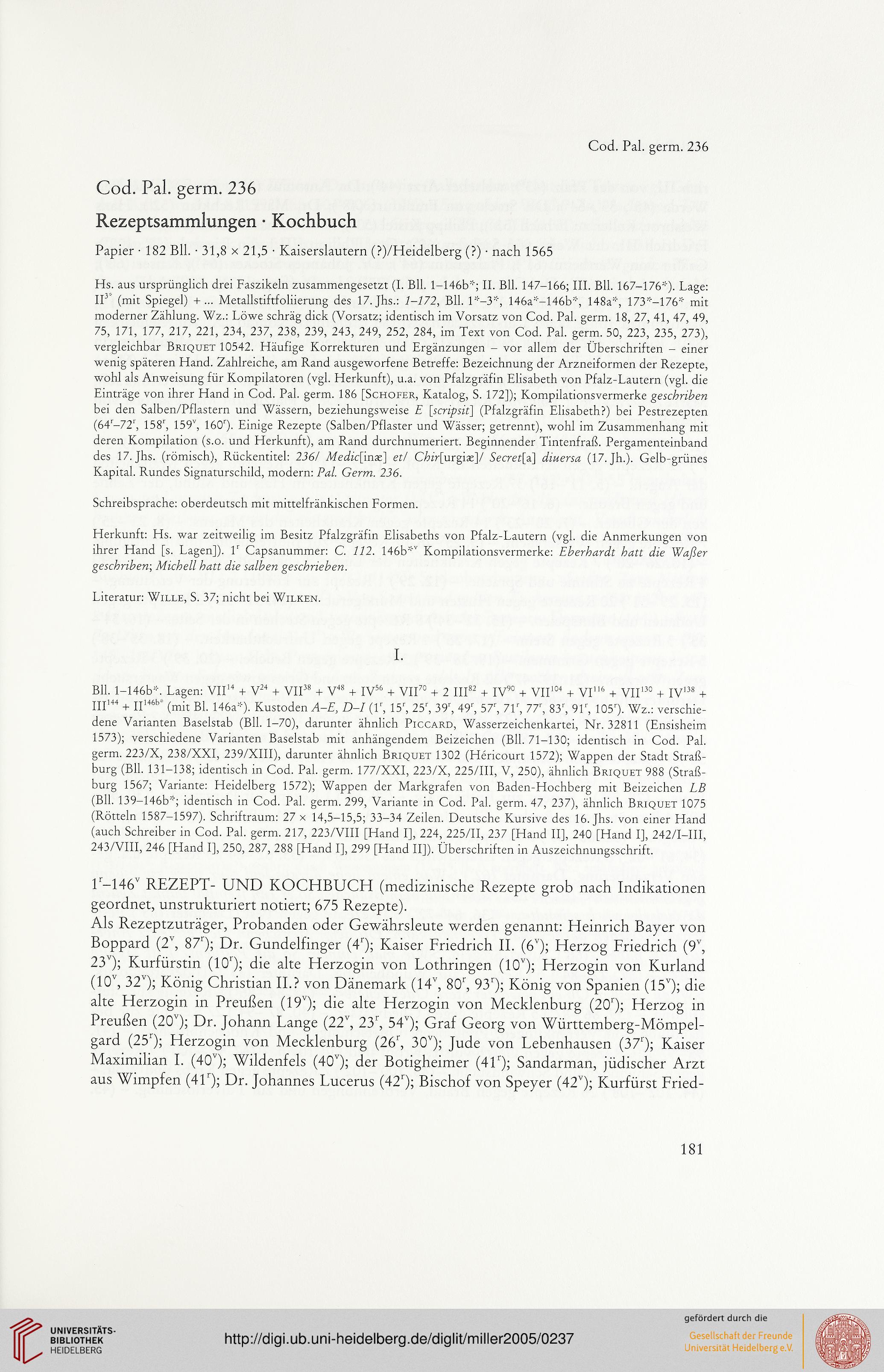Cod. Pal. germ. 236
Rezeptsammlungen • Kochbuch
Papier • 182 Bll. ■ 31,8 x 21,5 • Kaiserslautern (?)/Heidelberg (?) • nach 1565
Cod. Pal. germ. 236
Hs. aus ursprünglich drei Faszikeln zusammengesetzt (I. Bll. l-146b::"; II. Bll. 147-166; III. Bll. 167-176"'). Lage:
II3' (mit Spiegel) + ... Metallstiftfoliierung des 17. Jhs.: 1-172, Bll. l*-3*, 146a:'-146b::', 148a*, 173*-176* mit
moderner Zählung. Wz.: Löwe schräg dick (Vorsatz; identisch im Vorsatz von Cod. Pal. germ. 18, 27, 41, 47, 49,
75, 171, 177, 217, 221, 234, 237, 238, 239, 243, 249, 252, 284, im Text von Cod. Pal. germ. 50, 223, 235, 273),
vergleichbar Briquet 10542. Häufige Korrekturen und Ergänzungen - vor allem der Überschriften - einer
wenig späteren Hand. Zahlreiche, am Rand ausgeworfene Betreffe: Bezeichnung der Arzneiformen der Rezepte,
wohl als Anweisung für Kompilatoren (vgl. Herkunft), u.a. von Pfalzgräfin Elisabeth von Pfalz-Lautern (vgl. die
Einträge von ihrer Hand in Cod. Pal. germ. 186 [Schofer, Katalog, S. 172]); Kompilationsvermerke geschriben
bei den Salben/Pflastern und Wässern, beziehungsweise E [scripsit] (Pfalzgräfin Elisabeth?) bei Pestrezepten
(64r-72r, 158r, 159v, 160r). Einige Rezepte (Salben/Pflaster und Wässer; getrennt), wohl im Zusammenhang mit
deren Kompilation (s.o. und Herkunft), am Rand durchnumeriert. Beginnender Tintenfraß. Pergamenteinband
des 17. Jhs. (römisch), Rückentitel: 236/ Medic[inte] et/ Chir\urgiae]/ Secret\a] diuersa (17. Jh.). Gelb-grünes
Kapital. Rundes Signaturschild, modern: Pal. Germ. 236.
Schreibsprache: oberdeutsch mit mittelfränkischen Formen.
Herkunft: Hs. war zeitweilig im Besitz Pfalzgräfin Elisabeths von Pfalz-Lautern (vgl. die Anmerkungen von
ihrer Hand [s. Lagen]). lr Capsanummer: C. 112. 146b*v Kompilationsvermerke: Eberhardt hatt die Waßer
geschriben; Michell hatt die salben geschrieben.
Literatur: Wille, S. 37; nicht bei Wilken.
I.
Bll. l-146b*. Lagen: VII14 + V24 + VII38 + V48 + IV56 + VII70 + 2 III82 + IV90 + VII104 + VI116 + VII130 + IV138 +
III144 + II146b* (mit Bl. 146a;:'). Kustoden A-E, D-I (lr, 15r, 25r, 39r, 49r, 57r, 71r, 77r, 83r, 91r, 105r). Wz.: verschie-
dene Varianten Baselstab (Bll. 1-70), darunter ähnlich Piccard, Wasserzeichenkartei, Nr. 32811 (Ensisheim
1573); verschiedene Varianten Baselstab mit anhängendem Beizeichen (Bll. 71-130; identisch in Cod. Pal.
germ. 223/X, 238/XXI, 239/XIII), darunter ähnlich Briquet 1302 (Hericourt 1572); Wappen der Stadt Straß-
burg (Bll. 131-138; identisch in Cod. Pal. germ. 177/XXI, 223/X, 225/III, V, 250), ähnlich Briquet 988 (Straß-
burg 1567; Variante: Heidelberg 1572); Wappen der Markgrafen von Baden-Hochberg mit Beizeichen LB
(Bll. 139-146b'"‘; identisch in Cod. Pal. germ. 299, Variante in Cod. Pal. germ. 47, 237), ähnlich Briquet 1075
(Rotteln 1587-1597). Schriftraum: 27 x 14,5-15,5; 33-34 Zeilen. Deutsche Kursive des 16. Jhs. von einer Hand
(auch Schreiber in Cod. Pal. germ. 217, 223/VIII [Hand I], 224, 225/11, 237 [Hand II], 240 [Hand I], 242/I-III,
243/VIII, 246 [Hand I], 250, 287, 288 [Hand I], 299 [Hand II]). Überschriften in Auszeichnungsschrift.
lr--146v REZEPT- UND KOCHBUCH (medizinische Rezepte grob nach Indikationen
geordnet, unstrukturiert notiert; 675 Rezepte).
Als Rezeptzuträger, Probanden oder Gewährsleute werden genannt: Heinrich Bayer von
Boppard (2V, 87r); Dr. Gundelfinger (4r); Kaiser Friedrich II. (6V); Herzog Friedrich (9V,
23v); Kurfürstin (10r); die alte Herzogin von Lothringen (10v); Herzogin von Kurland
(10v, 32v); König Christian II.? von Dänemark (14v, 80r, 93r); König von Spanien (15v); die
alte Herzogin in Preußen (19v); die alte Herzogin von Mecklenburg (20r); Herzog in
Preußen (20v); Dr. Johann Lange (22v, 23r, 54'); Graf Georg von Württemberg-Mömpel-
gard (25r); Herzogin von Mecklenburg (26r, 30v); Jude von Lebenhausen (37r); Kaiser
Maximilian I. (40v); Wildenfels (4(T); der Botigheimer (41r); Sandarman, jüdischer Arzt
aus Wimpfen (41r); Dr. Johannes Lucerus (42r); Bischof von Speyer (42v); Kurfürst Fried-
181
Rezeptsammlungen • Kochbuch
Papier • 182 Bll. ■ 31,8 x 21,5 • Kaiserslautern (?)/Heidelberg (?) • nach 1565
Cod. Pal. germ. 236
Hs. aus ursprünglich drei Faszikeln zusammengesetzt (I. Bll. l-146b::"; II. Bll. 147-166; III. Bll. 167-176"'). Lage:
II3' (mit Spiegel) + ... Metallstiftfoliierung des 17. Jhs.: 1-172, Bll. l*-3*, 146a:'-146b::', 148a*, 173*-176* mit
moderner Zählung. Wz.: Löwe schräg dick (Vorsatz; identisch im Vorsatz von Cod. Pal. germ. 18, 27, 41, 47, 49,
75, 171, 177, 217, 221, 234, 237, 238, 239, 243, 249, 252, 284, im Text von Cod. Pal. germ. 50, 223, 235, 273),
vergleichbar Briquet 10542. Häufige Korrekturen und Ergänzungen - vor allem der Überschriften - einer
wenig späteren Hand. Zahlreiche, am Rand ausgeworfene Betreffe: Bezeichnung der Arzneiformen der Rezepte,
wohl als Anweisung für Kompilatoren (vgl. Herkunft), u.a. von Pfalzgräfin Elisabeth von Pfalz-Lautern (vgl. die
Einträge von ihrer Hand in Cod. Pal. germ. 186 [Schofer, Katalog, S. 172]); Kompilationsvermerke geschriben
bei den Salben/Pflastern und Wässern, beziehungsweise E [scripsit] (Pfalzgräfin Elisabeth?) bei Pestrezepten
(64r-72r, 158r, 159v, 160r). Einige Rezepte (Salben/Pflaster und Wässer; getrennt), wohl im Zusammenhang mit
deren Kompilation (s.o. und Herkunft), am Rand durchnumeriert. Beginnender Tintenfraß. Pergamenteinband
des 17. Jhs. (römisch), Rückentitel: 236/ Medic[inte] et/ Chir\urgiae]/ Secret\a] diuersa (17. Jh.). Gelb-grünes
Kapital. Rundes Signaturschild, modern: Pal. Germ. 236.
Schreibsprache: oberdeutsch mit mittelfränkischen Formen.
Herkunft: Hs. war zeitweilig im Besitz Pfalzgräfin Elisabeths von Pfalz-Lautern (vgl. die Anmerkungen von
ihrer Hand [s. Lagen]). lr Capsanummer: C. 112. 146b*v Kompilationsvermerke: Eberhardt hatt die Waßer
geschriben; Michell hatt die salben geschrieben.
Literatur: Wille, S. 37; nicht bei Wilken.
I.
Bll. l-146b*. Lagen: VII14 + V24 + VII38 + V48 + IV56 + VII70 + 2 III82 + IV90 + VII104 + VI116 + VII130 + IV138 +
III144 + II146b* (mit Bl. 146a;:'). Kustoden A-E, D-I (lr, 15r, 25r, 39r, 49r, 57r, 71r, 77r, 83r, 91r, 105r). Wz.: verschie-
dene Varianten Baselstab (Bll. 1-70), darunter ähnlich Piccard, Wasserzeichenkartei, Nr. 32811 (Ensisheim
1573); verschiedene Varianten Baselstab mit anhängendem Beizeichen (Bll. 71-130; identisch in Cod. Pal.
germ. 223/X, 238/XXI, 239/XIII), darunter ähnlich Briquet 1302 (Hericourt 1572); Wappen der Stadt Straß-
burg (Bll. 131-138; identisch in Cod. Pal. germ. 177/XXI, 223/X, 225/III, V, 250), ähnlich Briquet 988 (Straß-
burg 1567; Variante: Heidelberg 1572); Wappen der Markgrafen von Baden-Hochberg mit Beizeichen LB
(Bll. 139-146b'"‘; identisch in Cod. Pal. germ. 299, Variante in Cod. Pal. germ. 47, 237), ähnlich Briquet 1075
(Rotteln 1587-1597). Schriftraum: 27 x 14,5-15,5; 33-34 Zeilen. Deutsche Kursive des 16. Jhs. von einer Hand
(auch Schreiber in Cod. Pal. germ. 217, 223/VIII [Hand I], 224, 225/11, 237 [Hand II], 240 [Hand I], 242/I-III,
243/VIII, 246 [Hand I], 250, 287, 288 [Hand I], 299 [Hand II]). Überschriften in Auszeichnungsschrift.
lr--146v REZEPT- UND KOCHBUCH (medizinische Rezepte grob nach Indikationen
geordnet, unstrukturiert notiert; 675 Rezepte).
Als Rezeptzuträger, Probanden oder Gewährsleute werden genannt: Heinrich Bayer von
Boppard (2V, 87r); Dr. Gundelfinger (4r); Kaiser Friedrich II. (6V); Herzog Friedrich (9V,
23v); Kurfürstin (10r); die alte Herzogin von Lothringen (10v); Herzogin von Kurland
(10v, 32v); König Christian II.? von Dänemark (14v, 80r, 93r); König von Spanien (15v); die
alte Herzogin in Preußen (19v); die alte Herzogin von Mecklenburg (20r); Herzog in
Preußen (20v); Dr. Johann Lange (22v, 23r, 54'); Graf Georg von Württemberg-Mömpel-
gard (25r); Herzogin von Mecklenburg (26r, 30v); Jude von Lebenhausen (37r); Kaiser
Maximilian I. (40v); Wildenfels (4(T); der Botigheimer (41r); Sandarman, jüdischer Arzt
aus Wimpfen (41r); Dr. Johannes Lucerus (42r); Bischof von Speyer (42v); Kurfürst Fried-
181