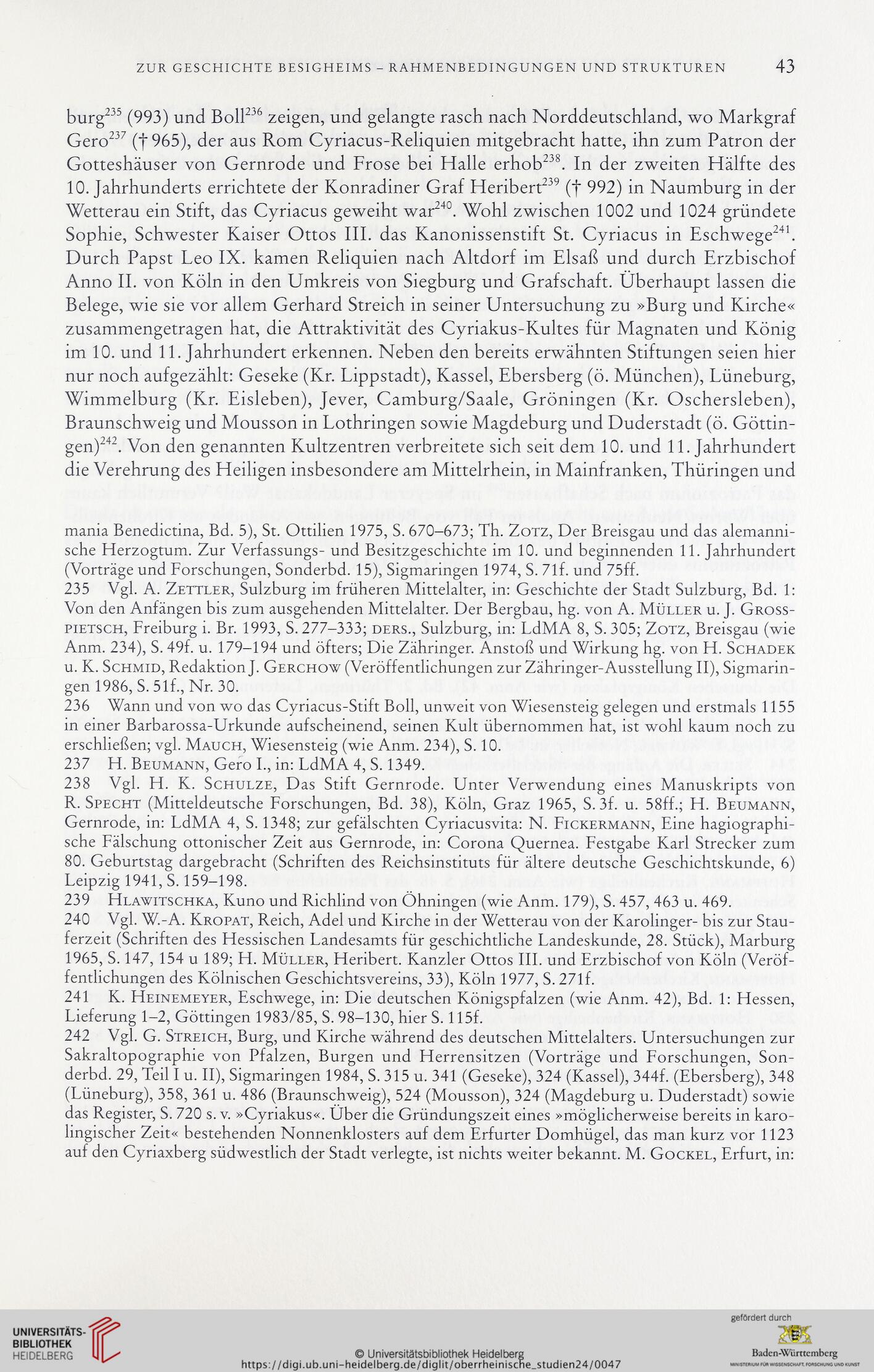ZUR GESCHICHTE BESIGHEIMS - RAHMENBEDINGUNGEN UND STRUKTUREN
43
bürg235 ( 9 9 3) und Boll236 zeigen, und gelangte rasch nach Norddeutschland, wo Markgraf
Gero237 (f965), der aus Rom Cyriacus-Reliquien mitgebracht hatte, ihn zum Patron der
Gotteshäuser von Gernrode und Frose bei Halle erhob238. In der zweiten Hälfte des
10. Jahrhunderts errichtete der Konradiner Graf Heribert239 (f 992) in Naumburg in der
Wetterau ein Stift, das Cyriacus geweiht war240. Wohl zwischen 1002 und 1024 gründete
Sophie, Schwester Kaiser Ottos III. das Kanonissenstift St. Cyriacus in Eschwege241.
Durch Papst Leo IX. kamen Reliquien nach Altdorf im Elsaß und durch Erzbischof
Anno II. von Köln in den Umkreis von Siegburg und Grafschaft. Überhaupt lassen die
Belege, wie sie vor allem Gerhard Streich in seiner Untersuchung zu »Burg und Kirche«
zusammengetragen hat, die Attraktivität des Cyriakus-Kultes für Magnaten und König
im 10. und 11. Jahrhundert erkennen. Neben den bereits erwähnten Stiftungen seien hier
nur noch aufgezählt: Geseke (Kr. Lippstadt), Kassel, Ebersberg (ö. München), Lüneburg,
Wimmelburg (Kr. Eisleben), Jever, Camburg/Saale, Gröningen (Kr. Oschersleben),
Braunschweig und Mousson in Lothringen sowie Magdeburg und Duderstadt (ö. Göttin-
gen)242. Von den genannten Kultzentren verbreitete sich seit dem 10. und 11. Jahrhundert
die Verehrung des Heiligen insbesondere am Mittelrhein, in Mainfranken, Thüringen und
mania Benedictina, Bd. 5), St. Ottilien 1975, S. 670-673; Th. Zotz, Der Breisgau und das alemanni-
sche Herzogtum. Zur Verfassungs- und Besitzgeschichte im 10. und beginnenden 11. Jahrhundert
(Vorträge und Forschungen, Sonderbd. 15), Sigmaringen 1974, S. 71f. und 75ff.
235 Vgl. A. Zettler, Sulzburg im früheren Mittelalter, in: Geschichte der Stadt Sulzburg, Bd. 1:
Von den Anfängen bis zum ausgehenden Mittelalter. Der Bergbau, hg. von A. Müller u. J. Gross-
pietsch, Freiburg i. Br. 1993, S. 277-333; ders., Sulzburg, in: LdMA 8, S. 305; Zotz, Breisgau (wie
Anm. 234), S. 49f. u. 179-194 und öfters; Die Zähringer. Anstoß und Wirkung hg. von H. Schadek
u. K. Schmid, Redaktion J. Gerchow (Veröffentlichungen zur Zähringer-Ausstellung II), Sigmarin-
gen 1986, S. 51f., Nr. 30.
236 Wann und von wo das Cyriacus-Stift Boll, unweit von Wiesensteig gelegen und erstmals 1155
in einer Barbarossa-Urkunde aufscheinend, seinen Kult übernommen hat, ist wohl kaum noch zu
erschließen; vgl. Mauch, Wiesensteig (wie Anm. 234), S. 10.
237 H. Beumann, Gero I., in: LdMA 4, S. 1349.
238 Vgl. H. K. Schulze, Das Stift Gernrode. Unter Verwendung eines Manuskripts von
R. Specht (Mitteldeutsche Forschungen, Bd. 38), Köln, Graz 1965, S. 3f. u. 58ff.; H. Beumann,
Gernrode, in: LdMA 4, S. 1348; zur gefälschten Cyriacusvita: N. Fickermann, Eine hagiographi-
sche Fälschung ottonischer Zeit aus Gernrode, in: Corona Quernea. Festgabe Karl Strecker zum
80. Geburtstag dargebracht (Schriften des Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde, 6)
Leipzig 1941, S. 159-198.
239 Hlawitschka, Kuno und Richlind von Öhningen (wie Anm. 179), S. 457, 463 u. 469.
240 Vgl. W.-A. Kropat, Reich, Adel und Kirche in der Wetterau von der Karolinger- bis zur Stau-
ferzeit (Schriften des Hessischen Landesamts für geschichtliche Landeskunde, 28. Stück), Marburg
1965, S. 147, 154 u 189; H. Müller, Heribert. Kanzler Ottos III. und Erzbischof von Köln (Veröf-
fentlichungen des Kölnischen Geschichtsvereins, 33), Köln 1977, S. 271 f.
241 K. Heinemeyer, Eschwege, in: Die deutschen Königspfalzen (wie Anm. 42), Bd. 1: Hessen,
Lieferung 1-2, Göttingen 1983/85, S. 98-130, hier S. 115f.
242 Vgl. G. Streich, Burg, und Kirche während des deutschen Mittelalters. Untersuchungen zur
Sakraltopographie von Pfalzen, Burgen und Herrensitzen (Vorträge und Forschungen, Son-
derbd. 29, Teil I u. II), Sigmaringen 1984, S. 315 u. 341 (Geseke), 324 (Kassel), 344f. (Ebersberg), 348
(Lüneburg), 358, 361 u. 486 (Braunschweig), 524 (Mousson), 324 (Magdeburg u. Duderstadt) sowie
das Register, S. 720 s. v. »Cyriakus«. Über die Gründungszeit eines »möglicherweise bereits in karo-
lingischer Zeit« bestehenden Nonnenklosters auf dem Erfurter Domhügel, das man kurz vor 1123
auf den Cyriaxberg südwestlich der Stadt verlegte, ist nichts weiter bekannt. M. Gockel, Erfurt, in:
43
bürg235 ( 9 9 3) und Boll236 zeigen, und gelangte rasch nach Norddeutschland, wo Markgraf
Gero237 (f965), der aus Rom Cyriacus-Reliquien mitgebracht hatte, ihn zum Patron der
Gotteshäuser von Gernrode und Frose bei Halle erhob238. In der zweiten Hälfte des
10. Jahrhunderts errichtete der Konradiner Graf Heribert239 (f 992) in Naumburg in der
Wetterau ein Stift, das Cyriacus geweiht war240. Wohl zwischen 1002 und 1024 gründete
Sophie, Schwester Kaiser Ottos III. das Kanonissenstift St. Cyriacus in Eschwege241.
Durch Papst Leo IX. kamen Reliquien nach Altdorf im Elsaß und durch Erzbischof
Anno II. von Köln in den Umkreis von Siegburg und Grafschaft. Überhaupt lassen die
Belege, wie sie vor allem Gerhard Streich in seiner Untersuchung zu »Burg und Kirche«
zusammengetragen hat, die Attraktivität des Cyriakus-Kultes für Magnaten und König
im 10. und 11. Jahrhundert erkennen. Neben den bereits erwähnten Stiftungen seien hier
nur noch aufgezählt: Geseke (Kr. Lippstadt), Kassel, Ebersberg (ö. München), Lüneburg,
Wimmelburg (Kr. Eisleben), Jever, Camburg/Saale, Gröningen (Kr. Oschersleben),
Braunschweig und Mousson in Lothringen sowie Magdeburg und Duderstadt (ö. Göttin-
gen)242. Von den genannten Kultzentren verbreitete sich seit dem 10. und 11. Jahrhundert
die Verehrung des Heiligen insbesondere am Mittelrhein, in Mainfranken, Thüringen und
mania Benedictina, Bd. 5), St. Ottilien 1975, S. 670-673; Th. Zotz, Der Breisgau und das alemanni-
sche Herzogtum. Zur Verfassungs- und Besitzgeschichte im 10. und beginnenden 11. Jahrhundert
(Vorträge und Forschungen, Sonderbd. 15), Sigmaringen 1974, S. 71f. und 75ff.
235 Vgl. A. Zettler, Sulzburg im früheren Mittelalter, in: Geschichte der Stadt Sulzburg, Bd. 1:
Von den Anfängen bis zum ausgehenden Mittelalter. Der Bergbau, hg. von A. Müller u. J. Gross-
pietsch, Freiburg i. Br. 1993, S. 277-333; ders., Sulzburg, in: LdMA 8, S. 305; Zotz, Breisgau (wie
Anm. 234), S. 49f. u. 179-194 und öfters; Die Zähringer. Anstoß und Wirkung hg. von H. Schadek
u. K. Schmid, Redaktion J. Gerchow (Veröffentlichungen zur Zähringer-Ausstellung II), Sigmarin-
gen 1986, S. 51f., Nr. 30.
236 Wann und von wo das Cyriacus-Stift Boll, unweit von Wiesensteig gelegen und erstmals 1155
in einer Barbarossa-Urkunde aufscheinend, seinen Kult übernommen hat, ist wohl kaum noch zu
erschließen; vgl. Mauch, Wiesensteig (wie Anm. 234), S. 10.
237 H. Beumann, Gero I., in: LdMA 4, S. 1349.
238 Vgl. H. K. Schulze, Das Stift Gernrode. Unter Verwendung eines Manuskripts von
R. Specht (Mitteldeutsche Forschungen, Bd. 38), Köln, Graz 1965, S. 3f. u. 58ff.; H. Beumann,
Gernrode, in: LdMA 4, S. 1348; zur gefälschten Cyriacusvita: N. Fickermann, Eine hagiographi-
sche Fälschung ottonischer Zeit aus Gernrode, in: Corona Quernea. Festgabe Karl Strecker zum
80. Geburtstag dargebracht (Schriften des Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde, 6)
Leipzig 1941, S. 159-198.
239 Hlawitschka, Kuno und Richlind von Öhningen (wie Anm. 179), S. 457, 463 u. 469.
240 Vgl. W.-A. Kropat, Reich, Adel und Kirche in der Wetterau von der Karolinger- bis zur Stau-
ferzeit (Schriften des Hessischen Landesamts für geschichtliche Landeskunde, 28. Stück), Marburg
1965, S. 147, 154 u 189; H. Müller, Heribert. Kanzler Ottos III. und Erzbischof von Köln (Veröf-
fentlichungen des Kölnischen Geschichtsvereins, 33), Köln 1977, S. 271 f.
241 K. Heinemeyer, Eschwege, in: Die deutschen Königspfalzen (wie Anm. 42), Bd. 1: Hessen,
Lieferung 1-2, Göttingen 1983/85, S. 98-130, hier S. 115f.
242 Vgl. G. Streich, Burg, und Kirche während des deutschen Mittelalters. Untersuchungen zur
Sakraltopographie von Pfalzen, Burgen und Herrensitzen (Vorträge und Forschungen, Son-
derbd. 29, Teil I u. II), Sigmaringen 1984, S. 315 u. 341 (Geseke), 324 (Kassel), 344f. (Ebersberg), 348
(Lüneburg), 358, 361 u. 486 (Braunschweig), 524 (Mousson), 324 (Magdeburg u. Duderstadt) sowie
das Register, S. 720 s. v. »Cyriakus«. Über die Gründungszeit eines »möglicherweise bereits in karo-
lingischer Zeit« bestehenden Nonnenklosters auf dem Erfurter Domhügel, das man kurz vor 1123
auf den Cyriaxberg südwestlich der Stadt verlegte, ist nichts weiter bekannt. M. Gockel, Erfurt, in: