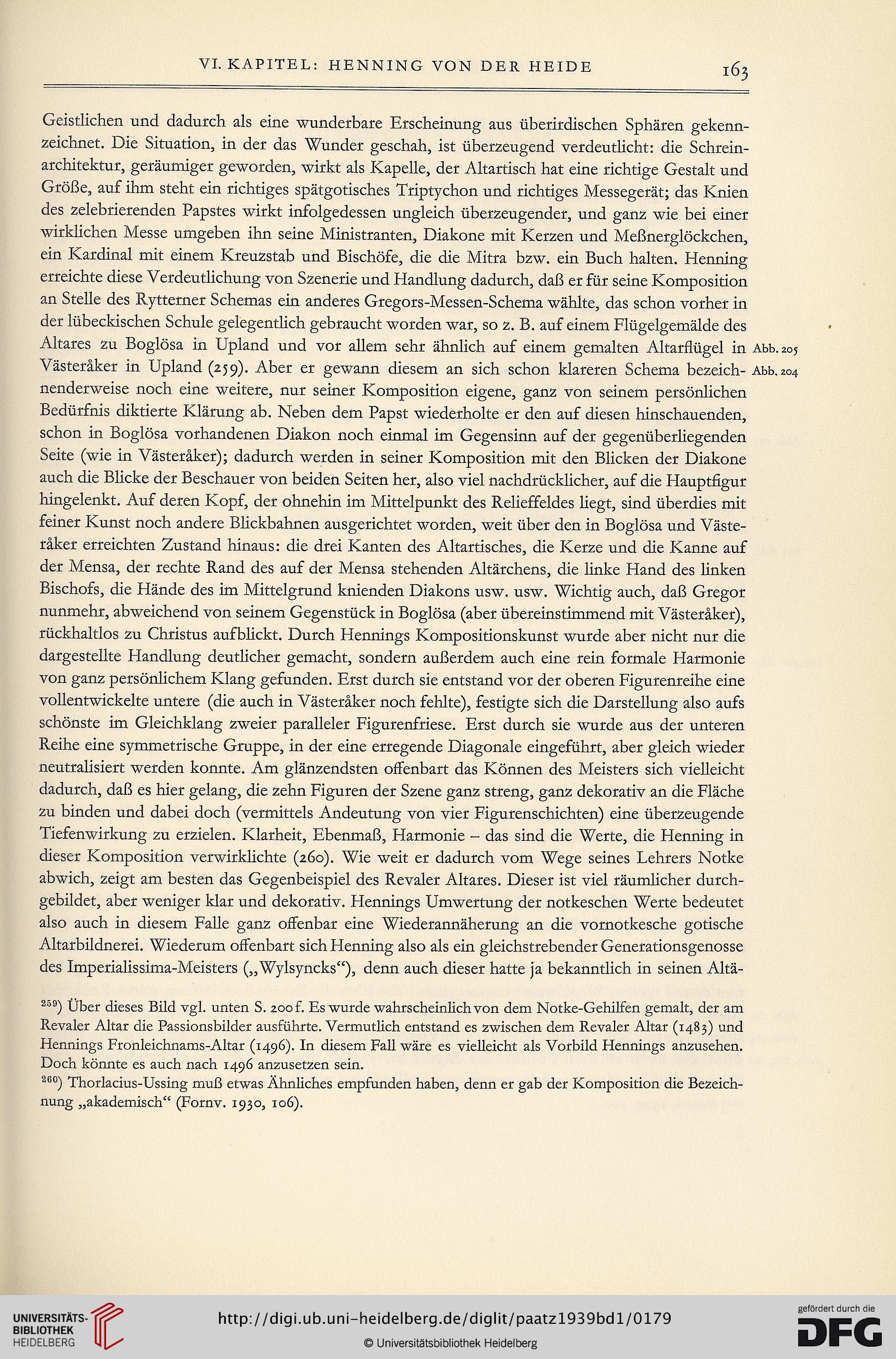VI. KAPITEL: HENNING VON DER HEIDE
l6ß
Geistlichen und dadurch als eine wunderbare Erscheinung aus überirdischen Sphären gekenn-
zeichnet. Die Situation, in der das Wunder geschah, ist überzeugend verdeutlicht: die Schrein-
architektur, geräumiger geworden, wirkt als Kapelle, der Altartisch hat eine richtige Gestalt und
Größe, auf ihm steht ein richtiges spätgotisches Triptychon und richtiges Messegerät; das Knien
des zelebrierenden Papstes wirkt infolgedessen ungleich überzeugender, und ganz wie bei einer
wirklichen Messe umgeben ihn seine Ministranten, Diakone mit Kerzen und Meßnerglöckchen,
ein Kardinal mit einem Kreuzstab und Bischöfe, die die Mitra bzw. ein Buch halten. Henning
erreichte diese Verdeutlichung von Szenerie und Handlung dadurch, daß er für seine Komposition
an Stelle des Rytterner Schemas ein anderes Gregors-Messen-Schema wählte, das schon vorher in
der lübeckischen Schule gelegentlich gebraucht worden war, so z. B. auf einem Flügelgemälde des
Altares zu Boglösa in Upland und vor allem sehr ähnlich auf einem gemalten Altarflügel in Abb.205
Västeräker in Upland (239). Aber er gewann diesem an sich schon klareren Schema bezeich- Abb.204
nenderweise noch eine weitere, nur seiner Komposition eigene, ganz von seinem persönlichen
Bedürfnis diktierte Klärung ab. Neben dem Papst wiederholte er den auf diesen hinschauenden,
schon in Boglösa vorhandenen Diakon noch einmal im Gegensinn auf der gegenüberliegenden
Seite (wie in Västeräker); dadurch werden in seiner Komposition mit den Blicken der Diakone
auch die Blicke der Beschauer von beiden Seiten her, also viel nachdrücklicher, auf die Hauptfigur
hingelenkt. Auf deren Kopf, der ohnehin im Mittelpunkt des Relieffeldes liegt, sind überdies mit
feiner Kunst noch andere Blickbahnen ausgerichtet worden, weit über den in Boglösa und Väste-
räker erreichten Zustand hinaus: die drei Kanten des Altartisches, die Kerze und die Kanne auf
der Mensa, der rechte Rand des auf der Mensa stehenden Altärchens, die linke Hand des linken
Bischofs, die Hände des im Mittelgrund knienden Diakons usw. usw. Wichtig auch, daß Gregor
nunmehr, abweichend von seinem Gegenstück in Boglösa (aber übereinstimmend mit Västeräker),
rückhaltlos zu Christus aufblickt. Durch Hennings Kompositionskunst wurde aber nicht nur die
dargestellte Handlung deutlicher gemacht, sondern außerdem auch eine rein formale Harmonie
von ganz persönlichem Klang gefunden. Erst durch sie entstand vor der oberen Figurenreihe eine
vollentwickelte untere (die auch in Västeräker noch fehlte), festigte sich die Darstellung also aufs
schönste im Gleichklang zweier paralleler Figurenfriese. Erst durch sie wurde aus der unteren
Reihe eine symmetrische Gruppe, in der eine erregende Diagonale eingeführt, aber gleich wieder
neutralisiert werden konnte. Am glänzendsten olfenbart das Können des Meisters sich vielleicht
dadurch, daß es hier gelang, die zehn Figuren der Szene ganz streng, ganz dekorativ an die Fläche
zu binden und dabei doch (vermittels Andeutung von vier Figurenschichten) eine überzeugende
Tiefenwirkung zu erzielen. Klarheit, Ebenmaß, Harmonie - das sind die Werte, die Henning in
dieser Komposition verwirklichte (260). Wie weit er dadurch vom Wege seines Lehrers Notke
ab wich, zeigt am besten das Gegenbeispiel des Revaler Altares. Dieser ist viel räumlicher durch-
gebildet, aber weniger klar und dekorativ. Hennings Umwertung der notkeschen Werte bedeutet
also auch in diesem Falle ganz offenbar eine Wiederannäherung an die vornotkesche gotische
Altarbildnerei. Wiederum offenbart sich Henning also als ein gleichstrebender Generationsgenosse
des Imperialissima-Meisters („Wylsyncks"), denn auch dieser hatte ja bekanntlich in seinen Altä-
2"9) Über dieses Bild vgl. unten S. 200 f. Es wurde wahrscheinlich von dem Notke-Gehilfen gemalt, der am
Revaler Altar die Passionsbilder ausführte. Vermutlich entstand es zwischen dem Revaler Altar (1483) und
Hennings Fronleichnams-Altar (1496). In diesem Fall wäre es vielleicht als Vorbild Hennings anzusehen.
Doch könnte es auch nach 1496 anzusetzen sein.
26(9 Thorlacius-Ussing muß etwas Ähnliches empfunden haben, denn er gab der Komposition die Bezeich-
nung „akademisch" (Fornv. 1930, 106).
l6ß
Geistlichen und dadurch als eine wunderbare Erscheinung aus überirdischen Sphären gekenn-
zeichnet. Die Situation, in der das Wunder geschah, ist überzeugend verdeutlicht: die Schrein-
architektur, geräumiger geworden, wirkt als Kapelle, der Altartisch hat eine richtige Gestalt und
Größe, auf ihm steht ein richtiges spätgotisches Triptychon und richtiges Messegerät; das Knien
des zelebrierenden Papstes wirkt infolgedessen ungleich überzeugender, und ganz wie bei einer
wirklichen Messe umgeben ihn seine Ministranten, Diakone mit Kerzen und Meßnerglöckchen,
ein Kardinal mit einem Kreuzstab und Bischöfe, die die Mitra bzw. ein Buch halten. Henning
erreichte diese Verdeutlichung von Szenerie und Handlung dadurch, daß er für seine Komposition
an Stelle des Rytterner Schemas ein anderes Gregors-Messen-Schema wählte, das schon vorher in
der lübeckischen Schule gelegentlich gebraucht worden war, so z. B. auf einem Flügelgemälde des
Altares zu Boglösa in Upland und vor allem sehr ähnlich auf einem gemalten Altarflügel in Abb.205
Västeräker in Upland (239). Aber er gewann diesem an sich schon klareren Schema bezeich- Abb.204
nenderweise noch eine weitere, nur seiner Komposition eigene, ganz von seinem persönlichen
Bedürfnis diktierte Klärung ab. Neben dem Papst wiederholte er den auf diesen hinschauenden,
schon in Boglösa vorhandenen Diakon noch einmal im Gegensinn auf der gegenüberliegenden
Seite (wie in Västeräker); dadurch werden in seiner Komposition mit den Blicken der Diakone
auch die Blicke der Beschauer von beiden Seiten her, also viel nachdrücklicher, auf die Hauptfigur
hingelenkt. Auf deren Kopf, der ohnehin im Mittelpunkt des Relieffeldes liegt, sind überdies mit
feiner Kunst noch andere Blickbahnen ausgerichtet worden, weit über den in Boglösa und Väste-
räker erreichten Zustand hinaus: die drei Kanten des Altartisches, die Kerze und die Kanne auf
der Mensa, der rechte Rand des auf der Mensa stehenden Altärchens, die linke Hand des linken
Bischofs, die Hände des im Mittelgrund knienden Diakons usw. usw. Wichtig auch, daß Gregor
nunmehr, abweichend von seinem Gegenstück in Boglösa (aber übereinstimmend mit Västeräker),
rückhaltlos zu Christus aufblickt. Durch Hennings Kompositionskunst wurde aber nicht nur die
dargestellte Handlung deutlicher gemacht, sondern außerdem auch eine rein formale Harmonie
von ganz persönlichem Klang gefunden. Erst durch sie entstand vor der oberen Figurenreihe eine
vollentwickelte untere (die auch in Västeräker noch fehlte), festigte sich die Darstellung also aufs
schönste im Gleichklang zweier paralleler Figurenfriese. Erst durch sie wurde aus der unteren
Reihe eine symmetrische Gruppe, in der eine erregende Diagonale eingeführt, aber gleich wieder
neutralisiert werden konnte. Am glänzendsten olfenbart das Können des Meisters sich vielleicht
dadurch, daß es hier gelang, die zehn Figuren der Szene ganz streng, ganz dekorativ an die Fläche
zu binden und dabei doch (vermittels Andeutung von vier Figurenschichten) eine überzeugende
Tiefenwirkung zu erzielen. Klarheit, Ebenmaß, Harmonie - das sind die Werte, die Henning in
dieser Komposition verwirklichte (260). Wie weit er dadurch vom Wege seines Lehrers Notke
ab wich, zeigt am besten das Gegenbeispiel des Revaler Altares. Dieser ist viel räumlicher durch-
gebildet, aber weniger klar und dekorativ. Hennings Umwertung der notkeschen Werte bedeutet
also auch in diesem Falle ganz offenbar eine Wiederannäherung an die vornotkesche gotische
Altarbildnerei. Wiederum offenbart sich Henning also als ein gleichstrebender Generationsgenosse
des Imperialissima-Meisters („Wylsyncks"), denn auch dieser hatte ja bekanntlich in seinen Altä-
2"9) Über dieses Bild vgl. unten S. 200 f. Es wurde wahrscheinlich von dem Notke-Gehilfen gemalt, der am
Revaler Altar die Passionsbilder ausführte. Vermutlich entstand es zwischen dem Revaler Altar (1483) und
Hennings Fronleichnams-Altar (1496). In diesem Fall wäre es vielleicht als Vorbild Hennings anzusehen.
Doch könnte es auch nach 1496 anzusetzen sein.
26(9 Thorlacius-Ussing muß etwas Ähnliches empfunden haben, denn er gab der Komposition die Bezeich-
nung „akademisch" (Fornv. 1930, 106).