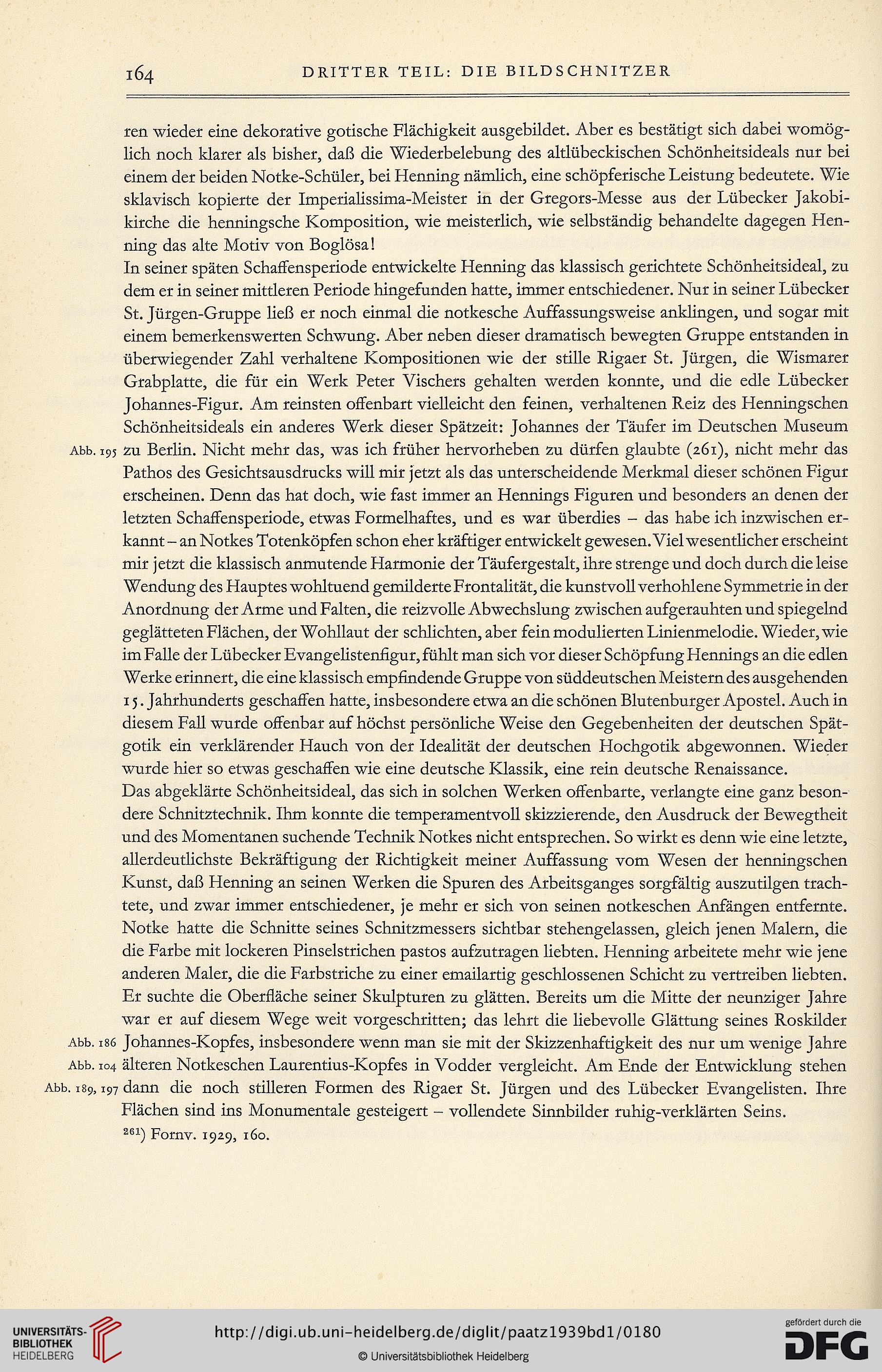164
DRITTER TEIL: DIE BILDSCHNITZER
iren wieder eine dekorative gotische Flächigkeit ausgebildet. Abet es bestätigt sich dabei womög-
lich noch klatet als bisher, daß die Wiederbelebung des altlübeckischen Schönheitsideals nur bei
einem der beiden Notke-Schüler, bei Henning nämlich, eine schöpferische Leistung bedeutete. Wie
sklavisch kopierte der Imperialissima-Meister in der Gregors-Messe aus der Lübecker Jakobi-
kirche die henningsche Komposition, wie meisterlich, wie selbständig behandelte dagegen Hen-
ning das alte Motiv von Boglösa!
In seiner späten Schaffensperiode entwickelte Henning das klassisch gerichtete Schönheitsideal, zu
dem er in seiner mittleren Periode hingefunden hatte, immer entschiedener. Nur in seiner Lübecker
St. Jürgen-Gruppe ließ er noch einmal die notkesche Auffassungsweise anklingen, und sogar mit
einem bemerkenswerten Schwung. Aber neben dieser dramatisch bewegten Gruppe entstanden in
überwiegender Zahl verhaltene Kompositionen wie der stille Rigaer St. Jürgen, die Wismarer
Grabplatte, die für ein Werk Peter Vischers gehalten werden konnte, und die edle Lübecker
Johannes-Figur. Am reinsten olfenbart vielleicht den feinen, verhaltenen Reiz des Henningschen
Schönheitsideals ein anderes Werk dieser Spätzeit: Johannes der Täufer im Deutschen Museum
Abb. 19$ zu Berlin. Nicht mehr das, was ich früher hervorheben zu dürfen glaubte (261), nicht mehr das
Pathos des Gesichtsausdrucks will mit jetzt als das unterscheidende Merkmal dieser schönen Figur
erscheinen. Denn das hat doch, wie fast immer an Hennings Figuren und besonders an denen der
letzten Schalfensperiode, etwas Formelhaftes, und es war überdies - das habe ich inzwischen er-
kannt - an Notkes Totenköpfen schon eher kräftiger entwickelt gewesen. Viel wesentlicher erscheint
mir jetzt die klassisch anmutende Harmonie der Täufergestalt, ihre strenge und doch durch die leise
Wendung des Hauptes wohltuend gemilderte Frontalität, die kunstvoll verhohlene Symmetrie in der
Anordnung der Arme und Falten, die reizvolle Abwechslung zwischen aufgerauhten und spiegelnd
geglätteten Flächen, der Wohllaut der schlichten, aber fein modulierten Linienmelodie. Wieder, wie
im Falle der Lübecker Evangelistenhgur, fühlt man sich vor dieser Schöpfung Hennings an die edlen
Werke erinnert, die eine klassisch empßndende Gruppe von süddeutschen Meistern des ausgehenden
1 $. Jahrhunderts geschaffen hatte, insbesondere etwa an die schönen Blutenburger Apostel. Auch in
diesem Fall wurde olfenbar auf höchst persönliche Weise den Gegebenheiten der deutschen Spät-
gotik ein verklärender Hauch von der Idealität der deutschen Hochgotik abgewonnen. Wieder
wurde hier so etwas geschahen wie eine deutsche Klassik, eine rein deutsche Renaissance.
Das abgeklärte Schönheitsideal, das sich in solchen Werken olfenbarte, verlangte eine ganz beson-
dere Schnitztechnik. Ihm konnte die temperamentvoll skizzierende, den Ausdruck der Bewegtheit
und des Momentanen suchende Technik Notkes nicht entsprechen. So wirkt es denn wie eine letzte,
allerdeutlichste Bekräftigung der Richtigkeit meiner Auffassung vom Wesen der henningschen
Kunst, daß Henning an seinen Werken die Spuren des Arbeitsganges sorgfältig auszutilgen trach-
tete, und zwar immer entschiedener, je mehr er sich von seinen notkeschen Anfängen entfernte.
Notke hatte die Schnitte seines Schnitzmessers sichtbar stehengelassen, gleich jenen Malern, die
die Farbe mit lockeren Pinselstrichen pastös aufzutragen liebten. Henning arbeitete mehr wie jene
anderen Maler, die die Farbstriche zu einet emailartig geschlossenen Schicht zu vertreiben liebten.
Er suchte die OberAäche seiner Skulpturen zu glätten. Bereits um die Mitte der neunziger Jahre
war er auf diesem Wege weit vorgeschritten; das lehrt die liebevolle Glättung seines Roskilder
Abb. 186 Johannes-Kopfes, insbesondere wenn man sie mit der Skizzenhaftigkeit des nur um wenige Jahre
Abb. 104 älteren Notkeschen Laurentius-Kopfes in Vodder vergleicht. Am Ende der Entwicklung stehen
Abb. 189,197 dann die noch stilleren Formen des Rigaer St. Jürgen und des Lübecker Evangelisten. Ihre
Flächen sind ins Monumentale gesteigert - vollendete Sinnbilder ruhig-verklärten Seins.
Fomv. 192^, 160.
DRITTER TEIL: DIE BILDSCHNITZER
iren wieder eine dekorative gotische Flächigkeit ausgebildet. Abet es bestätigt sich dabei womög-
lich noch klatet als bisher, daß die Wiederbelebung des altlübeckischen Schönheitsideals nur bei
einem der beiden Notke-Schüler, bei Henning nämlich, eine schöpferische Leistung bedeutete. Wie
sklavisch kopierte der Imperialissima-Meister in der Gregors-Messe aus der Lübecker Jakobi-
kirche die henningsche Komposition, wie meisterlich, wie selbständig behandelte dagegen Hen-
ning das alte Motiv von Boglösa!
In seiner späten Schaffensperiode entwickelte Henning das klassisch gerichtete Schönheitsideal, zu
dem er in seiner mittleren Periode hingefunden hatte, immer entschiedener. Nur in seiner Lübecker
St. Jürgen-Gruppe ließ er noch einmal die notkesche Auffassungsweise anklingen, und sogar mit
einem bemerkenswerten Schwung. Aber neben dieser dramatisch bewegten Gruppe entstanden in
überwiegender Zahl verhaltene Kompositionen wie der stille Rigaer St. Jürgen, die Wismarer
Grabplatte, die für ein Werk Peter Vischers gehalten werden konnte, und die edle Lübecker
Johannes-Figur. Am reinsten olfenbart vielleicht den feinen, verhaltenen Reiz des Henningschen
Schönheitsideals ein anderes Werk dieser Spätzeit: Johannes der Täufer im Deutschen Museum
Abb. 19$ zu Berlin. Nicht mehr das, was ich früher hervorheben zu dürfen glaubte (261), nicht mehr das
Pathos des Gesichtsausdrucks will mit jetzt als das unterscheidende Merkmal dieser schönen Figur
erscheinen. Denn das hat doch, wie fast immer an Hennings Figuren und besonders an denen der
letzten Schalfensperiode, etwas Formelhaftes, und es war überdies - das habe ich inzwischen er-
kannt - an Notkes Totenköpfen schon eher kräftiger entwickelt gewesen. Viel wesentlicher erscheint
mir jetzt die klassisch anmutende Harmonie der Täufergestalt, ihre strenge und doch durch die leise
Wendung des Hauptes wohltuend gemilderte Frontalität, die kunstvoll verhohlene Symmetrie in der
Anordnung der Arme und Falten, die reizvolle Abwechslung zwischen aufgerauhten und spiegelnd
geglätteten Flächen, der Wohllaut der schlichten, aber fein modulierten Linienmelodie. Wieder, wie
im Falle der Lübecker Evangelistenhgur, fühlt man sich vor dieser Schöpfung Hennings an die edlen
Werke erinnert, die eine klassisch empßndende Gruppe von süddeutschen Meistern des ausgehenden
1 $. Jahrhunderts geschaffen hatte, insbesondere etwa an die schönen Blutenburger Apostel. Auch in
diesem Fall wurde olfenbar auf höchst persönliche Weise den Gegebenheiten der deutschen Spät-
gotik ein verklärender Hauch von der Idealität der deutschen Hochgotik abgewonnen. Wieder
wurde hier so etwas geschahen wie eine deutsche Klassik, eine rein deutsche Renaissance.
Das abgeklärte Schönheitsideal, das sich in solchen Werken olfenbarte, verlangte eine ganz beson-
dere Schnitztechnik. Ihm konnte die temperamentvoll skizzierende, den Ausdruck der Bewegtheit
und des Momentanen suchende Technik Notkes nicht entsprechen. So wirkt es denn wie eine letzte,
allerdeutlichste Bekräftigung der Richtigkeit meiner Auffassung vom Wesen der henningschen
Kunst, daß Henning an seinen Werken die Spuren des Arbeitsganges sorgfältig auszutilgen trach-
tete, und zwar immer entschiedener, je mehr er sich von seinen notkeschen Anfängen entfernte.
Notke hatte die Schnitte seines Schnitzmessers sichtbar stehengelassen, gleich jenen Malern, die
die Farbe mit lockeren Pinselstrichen pastös aufzutragen liebten. Henning arbeitete mehr wie jene
anderen Maler, die die Farbstriche zu einet emailartig geschlossenen Schicht zu vertreiben liebten.
Er suchte die OberAäche seiner Skulpturen zu glätten. Bereits um die Mitte der neunziger Jahre
war er auf diesem Wege weit vorgeschritten; das lehrt die liebevolle Glättung seines Roskilder
Abb. 186 Johannes-Kopfes, insbesondere wenn man sie mit der Skizzenhaftigkeit des nur um wenige Jahre
Abb. 104 älteren Notkeschen Laurentius-Kopfes in Vodder vergleicht. Am Ende der Entwicklung stehen
Abb. 189,197 dann die noch stilleren Formen des Rigaer St. Jürgen und des Lübecker Evangelisten. Ihre
Flächen sind ins Monumentale gesteigert - vollendete Sinnbilder ruhig-verklärten Seins.
Fomv. 192^, 160.