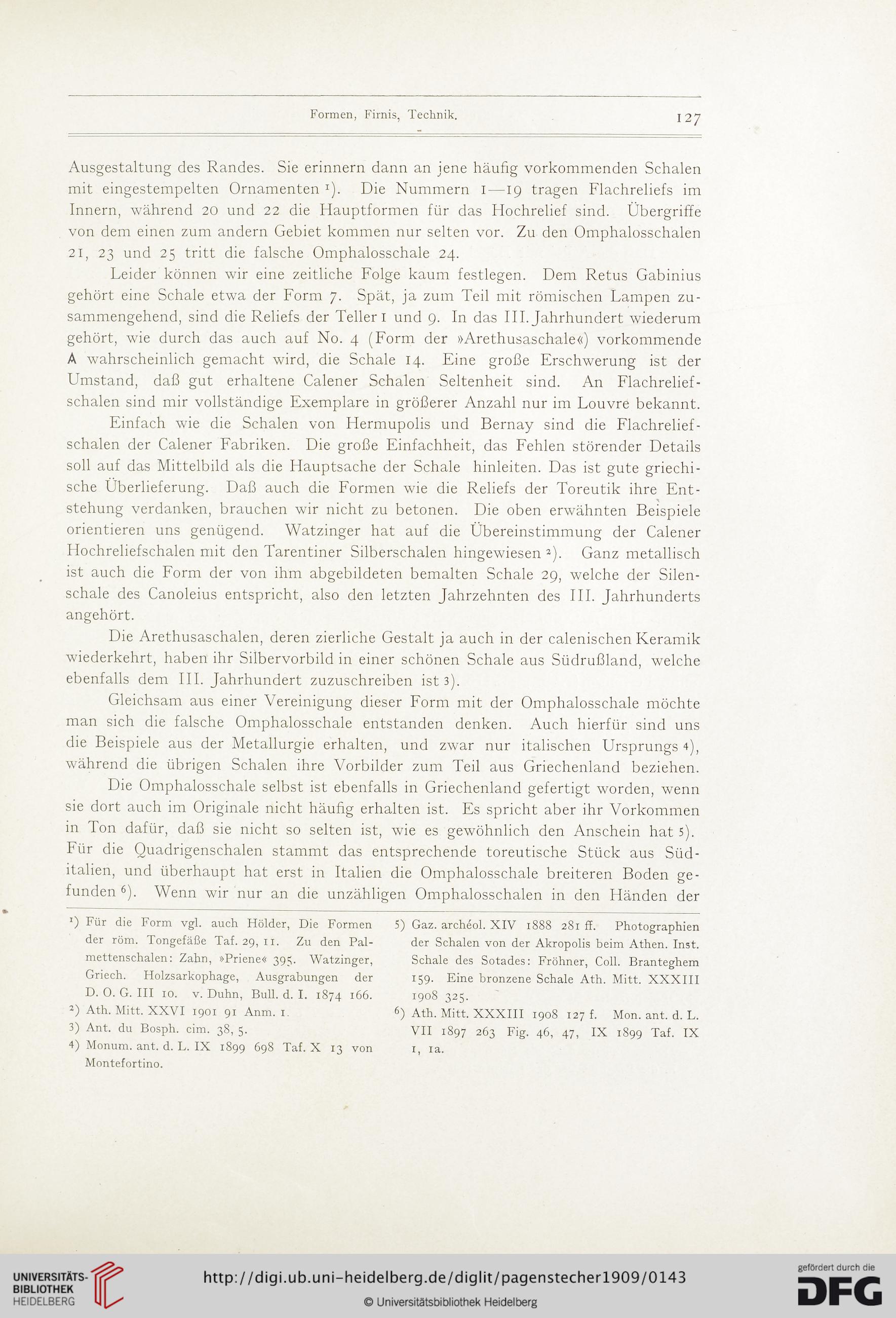Formen, Firnis, Technik.
127
Ausgestaltung des Randes. Sie erinnern dann an jene häufig vorkommenden Schalen
mit eingestempelten Ornamenten 1). Die Nummern I—19 tragen Flachreliefs im
Innern, während 20 und 22 die Hauptformen für das Flochrelief sind. Übergriffe
von dem einen zum andern Gebiet kommen nur selten vor. Zu den Omphalosschalen
21, 23 und 25 tritt die falsche Omphalosschale 24.
Leider können wir eine zeitliche Folge kaum festlegen. Dem Retus Gabinius
gehört eine Schale etwa der Form 7. Spät, ja zum Teil mit römischen Lampen zu-
sammengehend, sind die Reliefs der Teilen und 9. In das III. Jahrhundert wiederum
gehört, wie durch das auch auf No. 4 (Form der »Arethusaschale«) vorkommende
A wahrscheinlich gemacht wird, die Schale 14. Eine große Erschwerung ist der
Umstand, daß gut erhaltene Calener Schalen Seltenheit sind. An Flachrelief-
schalen sind mir vollständige Exemplare in größerer Anzahl nur im Louvre bekannt.
Einfach wie die Schalen von Hermupolis und Bernay sind die Flachrelief -
schalen der Calener Fabriken. Die große Einfachheit, das Fehlen störender Details
soll auf das Mittelbild als die Hauptsache der Schale hinleiten. Das ist gute griechi-
sche Überlieferung. Daß auch die Formen wie die Reliefs der Toreutik ihre Ent-
stehung verdanken, brauchen wir nicht zu betonen. Die oben erwähnten Beispiele
orientieren uns genügend. Watzinger hat auf die Übereinstimmung der Calener
Hochreliefschalen mit den Tarentiner Silberschalen hingewiesen 2). Ganz metallisch
ist auch die Form der von ihm abgebildeten bemalten Schale 29, welche der Silen-
schale des Canoleius entspricht, also den letzten Jahrzehnten des III. Jahrhunderts
angehört.
Die Arethusaschalen, deren zierliche Gestalt ja auch in der calenischen Keramik
wiederkehrt, haben ihr Silbervorbild in einer schönen Schale aus Südrußland, welche
ebenfalls dem III. Jahrhundert zuzuschreiben ist 3).
Gleichsam aus einer Vereinigung dieser Form mit der Omphalosschale möchte
man sich die falsche Omphalosschale entstanden denken. Auch hierfür sind uns
die Beispiele aus der Metallurgie erhalten, und zwar nur italischen Ursprungs 4),
während die übrigen Schalen ihre Vorbilder zum Teil aus Griechenland beziehen.
Die Omphalosschale selbst ist ebenfalls in Griechenland gefertigt worden, wenn
sie dort auch im Originale nicht häufig erhalten ist. Es spricht aber ihr Vorkommen
in Ton dafür, daß sie nicht so selten ist, wie es gewöhnlich den Anschein hat 5).
Für die Quadrigenschalen stammt das entsprechende toreutische Stück aus Süd-
italien, und überhaupt hat erst in Italien die Omphalosschale breiteren Boden ge-
funden 6). Wenn wir nur an die unzähligen Omphalosschalen in den Händen der
') Für die Form vgl. auch Holder, Die Formen
der röm. Tongefäße Taf. 29, n. Zu den Pal-
mettenschalen: Zahn, »Priene« 395. Watzinger,
Griech. Holzsarkophage, Ausgrabungen der
D. 0. G. III 10. v. Duhn, Bull. d. I. 1874 166.
2) Ath. Mitt. XXVI 1901 91 Anm. I.
3) Ant. du Bosph. cim. 38, 5.
4) Monum. ant. d. L. IX 1899 698 Taf. X 13 von
Montefortino.
5) Gaz. archeol. XIV 1888 281 ff. Photographien
der Schalen von der Akropolis beim Athen. Inst.
Schale des Sotades: Fröhner, Coli. Branteghem
159. Eine bronzene Schale Ath. Mitt. XXXIII
1908 325.
6) Ath. Mitt. XXXIII 1908 127 f. Mon. ant. d. L.
VII 1897 263 Fig. 46, 47, IX 1899 Taf. IX
1, ia.
127
Ausgestaltung des Randes. Sie erinnern dann an jene häufig vorkommenden Schalen
mit eingestempelten Ornamenten 1). Die Nummern I—19 tragen Flachreliefs im
Innern, während 20 und 22 die Hauptformen für das Flochrelief sind. Übergriffe
von dem einen zum andern Gebiet kommen nur selten vor. Zu den Omphalosschalen
21, 23 und 25 tritt die falsche Omphalosschale 24.
Leider können wir eine zeitliche Folge kaum festlegen. Dem Retus Gabinius
gehört eine Schale etwa der Form 7. Spät, ja zum Teil mit römischen Lampen zu-
sammengehend, sind die Reliefs der Teilen und 9. In das III. Jahrhundert wiederum
gehört, wie durch das auch auf No. 4 (Form der »Arethusaschale«) vorkommende
A wahrscheinlich gemacht wird, die Schale 14. Eine große Erschwerung ist der
Umstand, daß gut erhaltene Calener Schalen Seltenheit sind. An Flachrelief-
schalen sind mir vollständige Exemplare in größerer Anzahl nur im Louvre bekannt.
Einfach wie die Schalen von Hermupolis und Bernay sind die Flachrelief -
schalen der Calener Fabriken. Die große Einfachheit, das Fehlen störender Details
soll auf das Mittelbild als die Hauptsache der Schale hinleiten. Das ist gute griechi-
sche Überlieferung. Daß auch die Formen wie die Reliefs der Toreutik ihre Ent-
stehung verdanken, brauchen wir nicht zu betonen. Die oben erwähnten Beispiele
orientieren uns genügend. Watzinger hat auf die Übereinstimmung der Calener
Hochreliefschalen mit den Tarentiner Silberschalen hingewiesen 2). Ganz metallisch
ist auch die Form der von ihm abgebildeten bemalten Schale 29, welche der Silen-
schale des Canoleius entspricht, also den letzten Jahrzehnten des III. Jahrhunderts
angehört.
Die Arethusaschalen, deren zierliche Gestalt ja auch in der calenischen Keramik
wiederkehrt, haben ihr Silbervorbild in einer schönen Schale aus Südrußland, welche
ebenfalls dem III. Jahrhundert zuzuschreiben ist 3).
Gleichsam aus einer Vereinigung dieser Form mit der Omphalosschale möchte
man sich die falsche Omphalosschale entstanden denken. Auch hierfür sind uns
die Beispiele aus der Metallurgie erhalten, und zwar nur italischen Ursprungs 4),
während die übrigen Schalen ihre Vorbilder zum Teil aus Griechenland beziehen.
Die Omphalosschale selbst ist ebenfalls in Griechenland gefertigt worden, wenn
sie dort auch im Originale nicht häufig erhalten ist. Es spricht aber ihr Vorkommen
in Ton dafür, daß sie nicht so selten ist, wie es gewöhnlich den Anschein hat 5).
Für die Quadrigenschalen stammt das entsprechende toreutische Stück aus Süd-
italien, und überhaupt hat erst in Italien die Omphalosschale breiteren Boden ge-
funden 6). Wenn wir nur an die unzähligen Omphalosschalen in den Händen der
') Für die Form vgl. auch Holder, Die Formen
der röm. Tongefäße Taf. 29, n. Zu den Pal-
mettenschalen: Zahn, »Priene« 395. Watzinger,
Griech. Holzsarkophage, Ausgrabungen der
D. 0. G. III 10. v. Duhn, Bull. d. I. 1874 166.
2) Ath. Mitt. XXVI 1901 91 Anm. I.
3) Ant. du Bosph. cim. 38, 5.
4) Monum. ant. d. L. IX 1899 698 Taf. X 13 von
Montefortino.
5) Gaz. archeol. XIV 1888 281 ff. Photographien
der Schalen von der Akropolis beim Athen. Inst.
Schale des Sotades: Fröhner, Coli. Branteghem
159. Eine bronzene Schale Ath. Mitt. XXXIII
1908 325.
6) Ath. Mitt. XXXIII 1908 127 f. Mon. ant. d. L.
VII 1897 263 Fig. 46, 47, IX 1899 Taf. IX
1, ia.