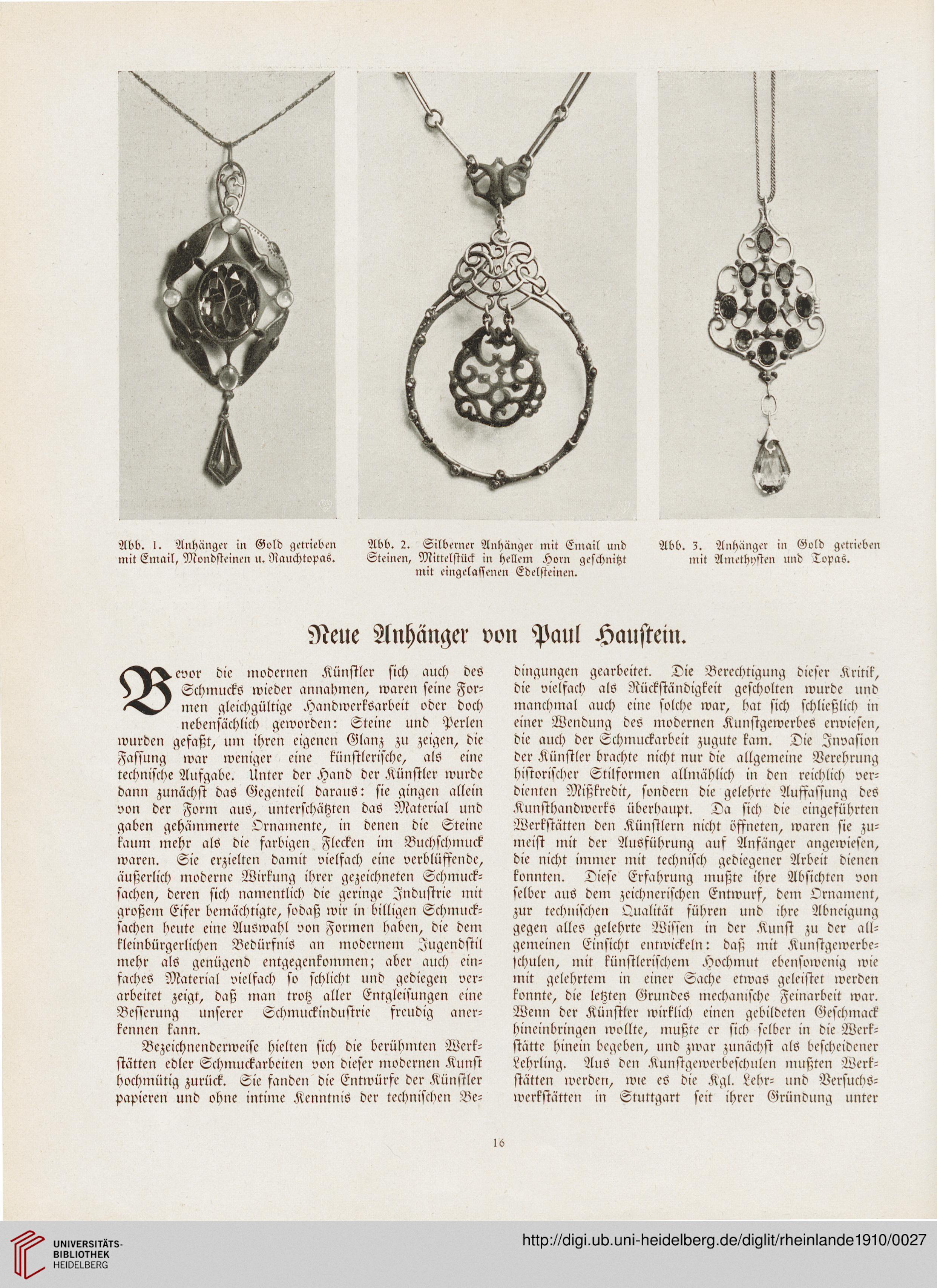Abb. I. Anhänger in Gold getrieben
mit Cmail, Mondsteinen u. Rauchtopas.
Abb. 2. Silberner Anhänger mit Cmail und Abb. Z. Anhänger in Gold getrieben
Steinen, Mittelstück in hellem Horn geschnitzt mit Amethysten und Topas.
mit eingelaffencn Cdelsteinen.
Neile Anhällger voll Paul Hausteill.
evor die modernen Künstler sich auch des
Schmucks wieder annahmen, waren seine For-
men gleichgültige Handwerksarbeit oder doch
nebensächlich geworden: Steine und Perlen
wurden gefaßt, um ihren eigenen Glanz zu zeigen, die
Fassung war weniger eine künstlerische, als eine
technische Ausgabe. Ünter der Hand der Künstler wurde
dann zunächst das Gegenteil daraus: sie gingen allein
von der Form auS, unterschätzten das Material und
gaben gehämmerte Ornamente, in denen die Steine
kaum mehr als dic sarbigen Flccken im Buchschmuck
waren. Sie erzielten damit vielfach eine verblüffende,
äußerlich moderne Wirkung ihrer gezeichneten Schmuck-
sachen, deren sich namentlich die geringe Jndustrie mit
großem Eifer bemächtigte, sodaß wir in billigen Schmuck-
sachen heutc eine Auswahl von Formen haben, die dem
kleinbürgerlichen Bedürsnis an modernem Jugendftil
mehr als genügend entgegenkommen; aber auch ein-
saches Material vielfach so schlicht und gediegen ver-
arbeitet zeigt, daß man trotz aller Emgleisungen eine
Befferung unserer Schmuckindustrie sreudig aner-
kennen kann.
Bezeichnenderweise hielten sich die berühmten Werk-
stätten edler Schmuckarbeitcn von diescr modcrnen Kunst
hochmütig zurück. Sie fanden die Entwürfe der Künstler
papieren und ohne intime Kenntnis der technischen Be-
dingungen gearbeitet. Die Berechtigung dieser Kritik,
die vielsach als Rückständigkeit gescholten wurde und
manchmal auch eine solche war, hat sich schließlich in
einer Wendung des modernen Kunstgewerbes erwiesen,
die auch der Schmuckarbeit zugute kam. Die Jnvasion
der Künstler brachte nicht nur die allgemeine Verehrung
hiftorischer Stilsormen allmählich in den reichlich ver-
dienten Mißkredit, sondern die gelehrte Auffassung des
Kunsthandwerks überhaupt. Da sich die eingeführten
Werkftätten de» Künstlern nicht öffneten, waren sie zu-
meist mit der Ausführung auf Anfänger angewiesen,
die nicht immer mit technisch gediegener Arbeit dienen
konnten. Diese Ersahrung mußte ihre Absichten von
selber auö dem zeichnerischen Entwurf, dem Ornament,
zur techiüschen Qualität führen und ihre Abneigung
gegen alles gelehrte Wissen in der Kunst zu der all-
gemeinen Einsicht eutwickeln: daß mit Kunstgewerbe-
schulen, mit künftlerischem Hochmut ebensowenig wie
mit gelehrtem in einer Sache etwas geleistet werden
konnte, die letzten Grundes mechanische Feinarbeit war.
Wenn der Künstler wirklich einen gebildeten Geschmack
hineinbringen wollte, mußte cr sich sclber in die Werk-
stätte hinein begeben, und zwar zunächst als bescheidener
Lehrling. Aus den Kunstgewerbeschulen mußten Werk-
stätten werden, wie es die Kgl. Lehr- und VersuchS-
werkstätten in Stuttgart seit ihrer Gründung unter
mit Cmail, Mondsteinen u. Rauchtopas.
Abb. 2. Silberner Anhänger mit Cmail und Abb. Z. Anhänger in Gold getrieben
Steinen, Mittelstück in hellem Horn geschnitzt mit Amethysten und Topas.
mit eingelaffencn Cdelsteinen.
Neile Anhällger voll Paul Hausteill.
evor die modernen Künstler sich auch des
Schmucks wieder annahmen, waren seine For-
men gleichgültige Handwerksarbeit oder doch
nebensächlich geworden: Steine und Perlen
wurden gefaßt, um ihren eigenen Glanz zu zeigen, die
Fassung war weniger eine künstlerische, als eine
technische Ausgabe. Ünter der Hand der Künstler wurde
dann zunächst das Gegenteil daraus: sie gingen allein
von der Form auS, unterschätzten das Material und
gaben gehämmerte Ornamente, in denen die Steine
kaum mehr als dic sarbigen Flccken im Buchschmuck
waren. Sie erzielten damit vielfach eine verblüffende,
äußerlich moderne Wirkung ihrer gezeichneten Schmuck-
sachen, deren sich namentlich die geringe Jndustrie mit
großem Eifer bemächtigte, sodaß wir in billigen Schmuck-
sachen heutc eine Auswahl von Formen haben, die dem
kleinbürgerlichen Bedürsnis an modernem Jugendftil
mehr als genügend entgegenkommen; aber auch ein-
saches Material vielfach so schlicht und gediegen ver-
arbeitet zeigt, daß man trotz aller Emgleisungen eine
Befferung unserer Schmuckindustrie sreudig aner-
kennen kann.
Bezeichnenderweise hielten sich die berühmten Werk-
stätten edler Schmuckarbeitcn von diescr modcrnen Kunst
hochmütig zurück. Sie fanden die Entwürfe der Künstler
papieren und ohne intime Kenntnis der technischen Be-
dingungen gearbeitet. Die Berechtigung dieser Kritik,
die vielsach als Rückständigkeit gescholten wurde und
manchmal auch eine solche war, hat sich schließlich in
einer Wendung des modernen Kunstgewerbes erwiesen,
die auch der Schmuckarbeit zugute kam. Die Jnvasion
der Künstler brachte nicht nur die allgemeine Verehrung
hiftorischer Stilsormen allmählich in den reichlich ver-
dienten Mißkredit, sondern die gelehrte Auffassung des
Kunsthandwerks überhaupt. Da sich die eingeführten
Werkftätten de» Künstlern nicht öffneten, waren sie zu-
meist mit der Ausführung auf Anfänger angewiesen,
die nicht immer mit technisch gediegener Arbeit dienen
konnten. Diese Ersahrung mußte ihre Absichten von
selber auö dem zeichnerischen Entwurf, dem Ornament,
zur techiüschen Qualität führen und ihre Abneigung
gegen alles gelehrte Wissen in der Kunst zu der all-
gemeinen Einsicht eutwickeln: daß mit Kunstgewerbe-
schulen, mit künftlerischem Hochmut ebensowenig wie
mit gelehrtem in einer Sache etwas geleistet werden
konnte, die letzten Grundes mechanische Feinarbeit war.
Wenn der Künstler wirklich einen gebildeten Geschmack
hineinbringen wollte, mußte cr sich sclber in die Werk-
stätte hinein begeben, und zwar zunächst als bescheidener
Lehrling. Aus den Kunstgewerbeschulen mußten Werk-
stätten werden, wie es die Kgl. Lehr- und VersuchS-
werkstätten in Stuttgart seit ihrer Gründung unter