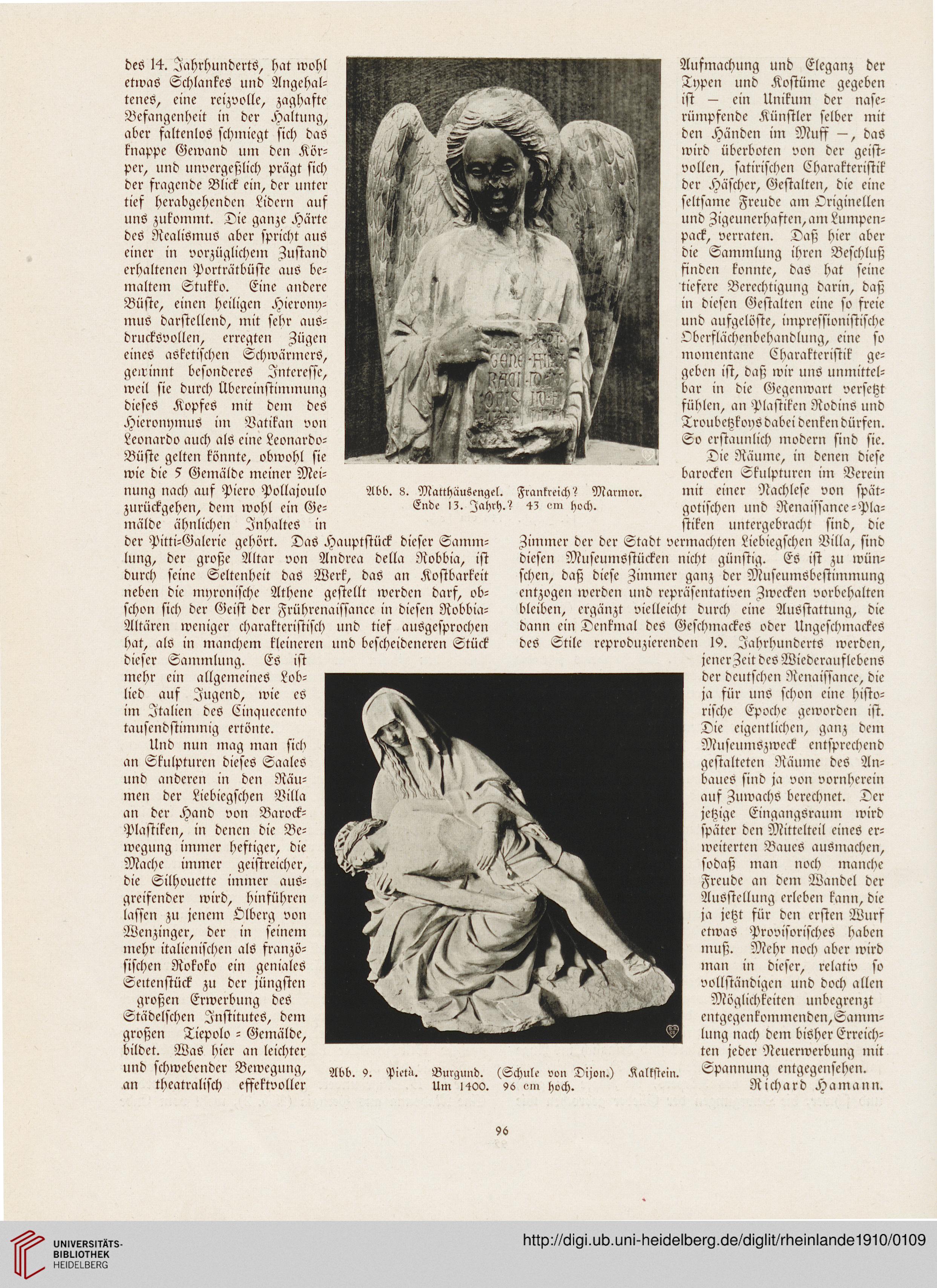des 14. Jahrhunderts, hat wohl
etwas Schlankes und Angehal-
tenes, eine reizvolle, zaghafte
Befangenheit in der Haltung,
aber faltenlos schmiegt sich das
knappe Gewand um den Kör-
per, und unvergeßlich prägt sich
der fragende Blick ein, der unter
tief herabgehenden Lidern auf
uns zukommt. Die ganze Härte
des Realismus aber spricht aus
einer in vorzüglichem Iuftand
erhaltenen Porträtbüfte aus be-
maltem Stukko. Eine andere
Büfte, einen heiligen Hierony-
mus darstellend, mit sehr aus-
druckövollen, erregten Zügen
eines asketischen Schwärmers,
gewinnt besonderes Jnteresse,
weil sie durch Übereinstimmung
dieses Kopseö mit dem deö
Hieronymus im Vatikan von
Leonardo auch als eine Leonardo-
Büfte geltcn könnte, obwohl sie
wie die 5 Gemälde meiner Mei-
nung nach aus Piero Pollajoulo
zurückgehen, dem wohl ein Ge-
mälde ähnlichen Jnhaltes in
der Pitti-Galerie gehört. Daö Hauptftück dieser Samm-
lung, der große Altar von Andrea della Robbia, ift
durch seine Seltenheit daö Werk, daö an Kostbarkeit
neben die myronische Athene geftellt werden dars, ob-
schon sich der Geist der Frührenaissance in diesen Robbia-
Altären wcniger charakteristisch und tief ausgesprochen
hat, alö in manchem kleineren und bescheideneren Stück
dieser Sammlung. Eö ist
mehr ein allgemeineö Lob-
lied auf Jugend, wie eS
im Jtalien deö Cinquecento
tausendstimmig ertönte.
Und nun mag man sich
an Skulpturen dieseö SaaleS
und anderen in den Räu-
men der Liebiegschen Villa
an der Hand von Barock-
Plaftiken, in dencn die Be-
wegung immer hestiger, die
Mache immer geiftreicher,
die Silhouette immer auö-
greisender wird, hinsühren
lassen zu jenem Olberg von
Wenzinger, der in seinem
mehr italienischen alö sranzö-
sischen Rokoko ein genialeö
Seitenftück zu der jüngften
großen Erwerbung deö
Städelschen Jnftitutes, dem
großen Tiepolo - Gemälde,
bildet. Waö hier an leichter
und schwebender Bewegung,
an theatralisch effektvoller
Aufmachung und Eleganz der
Typen und Kostüme gegeben
ist — ein Unikum der nase-
rümpsende Künstler selber mit
den Händen im Muff —, daö
wird überboten von der geift-
vollen, satirischen Charakteristik
der Häscher, Gestalten, die eine
seltsame Freude am Originellen
und Iigeunerhasten,amLumpen-
pack, verraten. Daß hier aber
die Sammlung ihren Beschluß
finden konnte, das hat seine
tiesere Berechtigung darin, daß
in diesen Gestalten eine so freie
und aufgelöfte, impressionistische
Oberflächenbehandlung, eine so
momentane Charakteristik ge-
geben ist, daß wir unö unmittel-
bar in die Gegenwart versetzt
fühlen, an Plastiken Rodinö und
Troubetzkoys dabei denken dürsen.
So erstaunlich modern sind sie.
Die Räume, in denen diese
barocken Skulpturen im Verein
mit einer Nachlese von spät-
gotischen und Renaissance-Pla-
stiken untergebracht sind, die
Iimmcr der der Stadt vermachten Liebicgschen Villa, sind
dicsen Museumöstücken nicht günstig. Eö ist zu wün-
schen, daß diese Iimmer ganz der Museumsbestimmung
entzogen werden und repräsentativen Zwecken vorbehalten
bleiben, ergänzt vielleicht durch eine Ausstattung, die
dann ein Denkmal des Geschmackeö oder Ungeschmackes
des Stile reproduzierenden I<). Jahrhunderts werden,
jenerIeit deö Wiederauflebens
der deutschen Renaissance, die
ja sür unö schon eine hifto-
rische Epoche geworden ift.
Die eigentlichen, ganz dem
Museumszweck entsprechend
gestalteten Räume des An-
baueö sind ja von vornherein
aus Zuwachs berechnet. Der
jetzige Eingangsraum wird
später den Mittelteil eineö er-
weiterten Baues auömachen,
sodaß man noch manche
Freude an dem Wandel der
Ausstellung erleben kann, die
ja jetzt für den erften Wurs
etwaö Provisorisches haben
muß. Mehr noch aber wird
man in dieser, relativ so
vollständigen und doch allen
Möglichkeiten unbegrenzt
entgegenkommenden,Samm-
lung nach dem bisher Erreich-
ten jeder Neuerwerbung mit
Spannung entgegensehen.
Richard Hamann.
Abb. 8. Matthäuscngel. Frankreich? Marmor.
Ende IZ. Jahrh.2 4Z vm hoch.
Abb. ?. Pietä. Burgund. (Schule von Dijon.) Kalkstein.
Um 1400. -S em hoch.
etwas Schlankes und Angehal-
tenes, eine reizvolle, zaghafte
Befangenheit in der Haltung,
aber faltenlos schmiegt sich das
knappe Gewand um den Kör-
per, und unvergeßlich prägt sich
der fragende Blick ein, der unter
tief herabgehenden Lidern auf
uns zukommt. Die ganze Härte
des Realismus aber spricht aus
einer in vorzüglichem Iuftand
erhaltenen Porträtbüfte aus be-
maltem Stukko. Eine andere
Büfte, einen heiligen Hierony-
mus darstellend, mit sehr aus-
druckövollen, erregten Zügen
eines asketischen Schwärmers,
gewinnt besonderes Jnteresse,
weil sie durch Übereinstimmung
dieses Kopseö mit dem deö
Hieronymus im Vatikan von
Leonardo auch als eine Leonardo-
Büfte geltcn könnte, obwohl sie
wie die 5 Gemälde meiner Mei-
nung nach aus Piero Pollajoulo
zurückgehen, dem wohl ein Ge-
mälde ähnlichen Jnhaltes in
der Pitti-Galerie gehört. Daö Hauptftück dieser Samm-
lung, der große Altar von Andrea della Robbia, ift
durch seine Seltenheit daö Werk, daö an Kostbarkeit
neben die myronische Athene geftellt werden dars, ob-
schon sich der Geist der Frührenaissance in diesen Robbia-
Altären wcniger charakteristisch und tief ausgesprochen
hat, alö in manchem kleineren und bescheideneren Stück
dieser Sammlung. Eö ist
mehr ein allgemeineö Lob-
lied auf Jugend, wie eS
im Jtalien deö Cinquecento
tausendstimmig ertönte.
Und nun mag man sich
an Skulpturen dieseö SaaleS
und anderen in den Räu-
men der Liebiegschen Villa
an der Hand von Barock-
Plaftiken, in dencn die Be-
wegung immer hestiger, die
Mache immer geiftreicher,
die Silhouette immer auö-
greisender wird, hinsühren
lassen zu jenem Olberg von
Wenzinger, der in seinem
mehr italienischen alö sranzö-
sischen Rokoko ein genialeö
Seitenftück zu der jüngften
großen Erwerbung deö
Städelschen Jnftitutes, dem
großen Tiepolo - Gemälde,
bildet. Waö hier an leichter
und schwebender Bewegung,
an theatralisch effektvoller
Aufmachung und Eleganz der
Typen und Kostüme gegeben
ist — ein Unikum der nase-
rümpsende Künstler selber mit
den Händen im Muff —, daö
wird überboten von der geift-
vollen, satirischen Charakteristik
der Häscher, Gestalten, die eine
seltsame Freude am Originellen
und Iigeunerhasten,amLumpen-
pack, verraten. Daß hier aber
die Sammlung ihren Beschluß
finden konnte, das hat seine
tiesere Berechtigung darin, daß
in diesen Gestalten eine so freie
und aufgelöfte, impressionistische
Oberflächenbehandlung, eine so
momentane Charakteristik ge-
geben ist, daß wir unö unmittel-
bar in die Gegenwart versetzt
fühlen, an Plastiken Rodinö und
Troubetzkoys dabei denken dürsen.
So erstaunlich modern sind sie.
Die Räume, in denen diese
barocken Skulpturen im Verein
mit einer Nachlese von spät-
gotischen und Renaissance-Pla-
stiken untergebracht sind, die
Iimmcr der der Stadt vermachten Liebicgschen Villa, sind
dicsen Museumöstücken nicht günstig. Eö ist zu wün-
schen, daß diese Iimmer ganz der Museumsbestimmung
entzogen werden und repräsentativen Zwecken vorbehalten
bleiben, ergänzt vielleicht durch eine Ausstattung, die
dann ein Denkmal des Geschmackeö oder Ungeschmackes
des Stile reproduzierenden I<). Jahrhunderts werden,
jenerIeit deö Wiederauflebens
der deutschen Renaissance, die
ja sür unö schon eine hifto-
rische Epoche geworden ift.
Die eigentlichen, ganz dem
Museumszweck entsprechend
gestalteten Räume des An-
baueö sind ja von vornherein
aus Zuwachs berechnet. Der
jetzige Eingangsraum wird
später den Mittelteil eineö er-
weiterten Baues auömachen,
sodaß man noch manche
Freude an dem Wandel der
Ausstellung erleben kann, die
ja jetzt für den erften Wurs
etwaö Provisorisches haben
muß. Mehr noch aber wird
man in dieser, relativ so
vollständigen und doch allen
Möglichkeiten unbegrenzt
entgegenkommenden,Samm-
lung nach dem bisher Erreich-
ten jeder Neuerwerbung mit
Spannung entgegensehen.
Richard Hamann.
Abb. 8. Matthäuscngel. Frankreich? Marmor.
Ende IZ. Jahrh.2 4Z vm hoch.
Abb. ?. Pietä. Burgund. (Schule von Dijon.) Kalkstein.
Um 1400. -S em hoch.