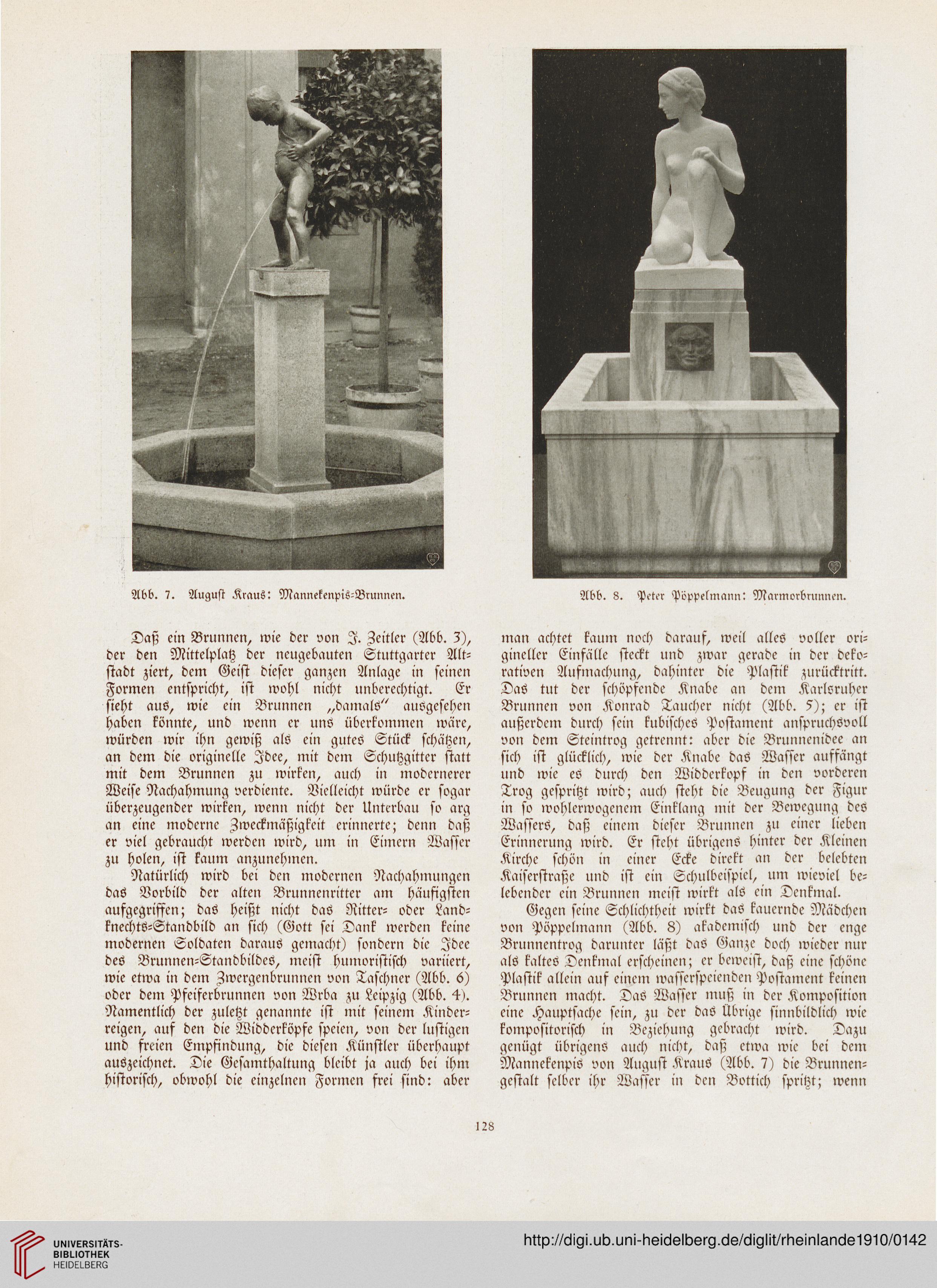Abb. 7. August Kraus: Mannekenpis-Brunnen.
Abb. 8. Peter Poppelmann! Marmorbrunnen.
Daß ein Brunnen, wie der von I. Ieitler (Abb. Z),
der den Mttelplatz der neugebauten Stuttgarter Alt-
stadt ziert, dem Geist dieser ganzen Anlage in seinen
Formen entspricht, ist wohl nicht unberechtigt. Er
sieht aus, wie ein Brunnen „damals" auögesehen
haben könnte, und wenn cr uns überkommcn wäre,
würden wir ihn gewiß als ein guteö Stück schätzen,
an dem die originelle Jdee, mit dem Schutzgitter statt
mit dem Brunnen zu wirken, auch >n modernerer
Weise Nachahmung verdiente. Vielleicht würde er sogar
überzeugender wirken, wenn nicht der Unterbau so arg
an eine moderne Zweckmäßigkeit erinnerte; denn daß
er viel gebraucht werden wird, um in Eimern Waster
zu holen, ist kaum anzunehmcn.
Natürlich wird bei den modernen Nachahmungen
das Vorbild der alten Brunnenritter am häufigsten
aufgegriffen; das heißt nicht das Ritter- oder Land-
knechtö-Standbild an sich (Gott sei Dank werden keine
modernen Soldaten darauS gemacht) sondern die Jdee
des Brunnen-Standbildeö, meist humoristisch variiert,
wie etwa in dem Zwcrgenbrunnen von Taschncr (Abb. 6)
oder dem Pfeiferbrunnen von Wrba zu Leipzig (Abb. 4).
Namentlich der zuletzt genannte ist nu't seinem Kinder-
reigen, auf den die Widderköpfe spei'e», von der lustigen
und freien Empfindung, die diesen Künstler überhaupt
auSzeichnet. Die Gesamthaltung blcibt ja auch bci ihm
historisch, obwohl die einzelncn Formcn frei sind: aber
man achtet kaum noch darauf, wei'l alles voller ori-
gineller Einfälle steckt und zwar gerade in der deko-
rativen Aufmachung, dahinter die Plastik zurücktritt.
Das tut der schöpfende Knabe an dem Karlsruher
Brunnen von Konrad Taucher ni'cht (Abb. 5); er ist
außerdem durch sein kubischeS Postament anspruchsvoll
von dem Steintrog getrennt: aber die Brunnenidee an
sich ist glücklich, wie der Knabe das Wasser auffängt
und wie es durch den Widderkopf in den vorderen
Trog gespritzt wird; auch steht die Beugung der Figur
in so wohlerwogenem Einklang mit der Bewegung des
Waffers, daß einem dieser Brunnen zu einer lieben
Erinnerung wird. Er steht übrigens hinter der Kleinen
Kirche schön in einer Ecke direkt an der belebten
Kaiserstraße und ist ein Schulbeispiel, um wi'eviel be-
lebender ein Brunnen meist wirkt als ein Denkmal.
Gegen scine Schlichtheit wirkt das kauernde Mädchen
von Pöppelmann (Abb. 8) akademisch und der enge
Brunnentrog darunter läßt das Ganze doch wieder nur
alö kaltes Denkmal erscheinen; er beweist, daß eine schöne
Plastik allein auf einem wasserspeienden Poftament keinen
Brunnen macht. Das Waffer muß in der Komposition
eine Hauptsache sein, zu der das llbrige sinnbildli'ch wie
kompositorisch in Beziehung gebracht wird. Dazu
genügt übrigens auch nicht, daß etwa wie bei dem
Mannekenpis von August Kraus (Abb. 7) die Brunnen-
gestalt selber ihr Wasser in den Bottich spritzt; wenn
128
Abb. 8. Peter Poppelmann! Marmorbrunnen.
Daß ein Brunnen, wie der von I. Ieitler (Abb. Z),
der den Mttelplatz der neugebauten Stuttgarter Alt-
stadt ziert, dem Geist dieser ganzen Anlage in seinen
Formen entspricht, ist wohl nicht unberechtigt. Er
sieht aus, wie ein Brunnen „damals" auögesehen
haben könnte, und wenn cr uns überkommcn wäre,
würden wir ihn gewiß als ein guteö Stück schätzen,
an dem die originelle Jdee, mit dem Schutzgitter statt
mit dem Brunnen zu wirken, auch >n modernerer
Weise Nachahmung verdiente. Vielleicht würde er sogar
überzeugender wirken, wenn nicht der Unterbau so arg
an eine moderne Zweckmäßigkeit erinnerte; denn daß
er viel gebraucht werden wird, um in Eimern Waster
zu holen, ist kaum anzunehmcn.
Natürlich wird bei den modernen Nachahmungen
das Vorbild der alten Brunnenritter am häufigsten
aufgegriffen; das heißt nicht das Ritter- oder Land-
knechtö-Standbild an sich (Gott sei Dank werden keine
modernen Soldaten darauS gemacht) sondern die Jdee
des Brunnen-Standbildeö, meist humoristisch variiert,
wie etwa in dem Zwcrgenbrunnen von Taschncr (Abb. 6)
oder dem Pfeiferbrunnen von Wrba zu Leipzig (Abb. 4).
Namentlich der zuletzt genannte ist nu't seinem Kinder-
reigen, auf den die Widderköpfe spei'e», von der lustigen
und freien Empfindung, die diesen Künstler überhaupt
auSzeichnet. Die Gesamthaltung blcibt ja auch bci ihm
historisch, obwohl die einzelncn Formcn frei sind: aber
man achtet kaum noch darauf, wei'l alles voller ori-
gineller Einfälle steckt und zwar gerade in der deko-
rativen Aufmachung, dahinter die Plastik zurücktritt.
Das tut der schöpfende Knabe an dem Karlsruher
Brunnen von Konrad Taucher ni'cht (Abb. 5); er ist
außerdem durch sein kubischeS Postament anspruchsvoll
von dem Steintrog getrennt: aber die Brunnenidee an
sich ist glücklich, wie der Knabe das Wasser auffängt
und wie es durch den Widderkopf in den vorderen
Trog gespritzt wird; auch steht die Beugung der Figur
in so wohlerwogenem Einklang mit der Bewegung des
Waffers, daß einem dieser Brunnen zu einer lieben
Erinnerung wird. Er steht übrigens hinter der Kleinen
Kirche schön in einer Ecke direkt an der belebten
Kaiserstraße und ist ein Schulbeispiel, um wi'eviel be-
lebender ein Brunnen meist wirkt als ein Denkmal.
Gegen scine Schlichtheit wirkt das kauernde Mädchen
von Pöppelmann (Abb. 8) akademisch und der enge
Brunnentrog darunter läßt das Ganze doch wieder nur
alö kaltes Denkmal erscheinen; er beweist, daß eine schöne
Plastik allein auf einem wasserspeienden Poftament keinen
Brunnen macht. Das Waffer muß in der Komposition
eine Hauptsache sein, zu der das llbrige sinnbildli'ch wie
kompositorisch in Beziehung gebracht wird. Dazu
genügt übrigens auch nicht, daß etwa wie bei dem
Mannekenpis von August Kraus (Abb. 7) die Brunnen-
gestalt selber ihr Wasser in den Bottich spritzt; wenn
128