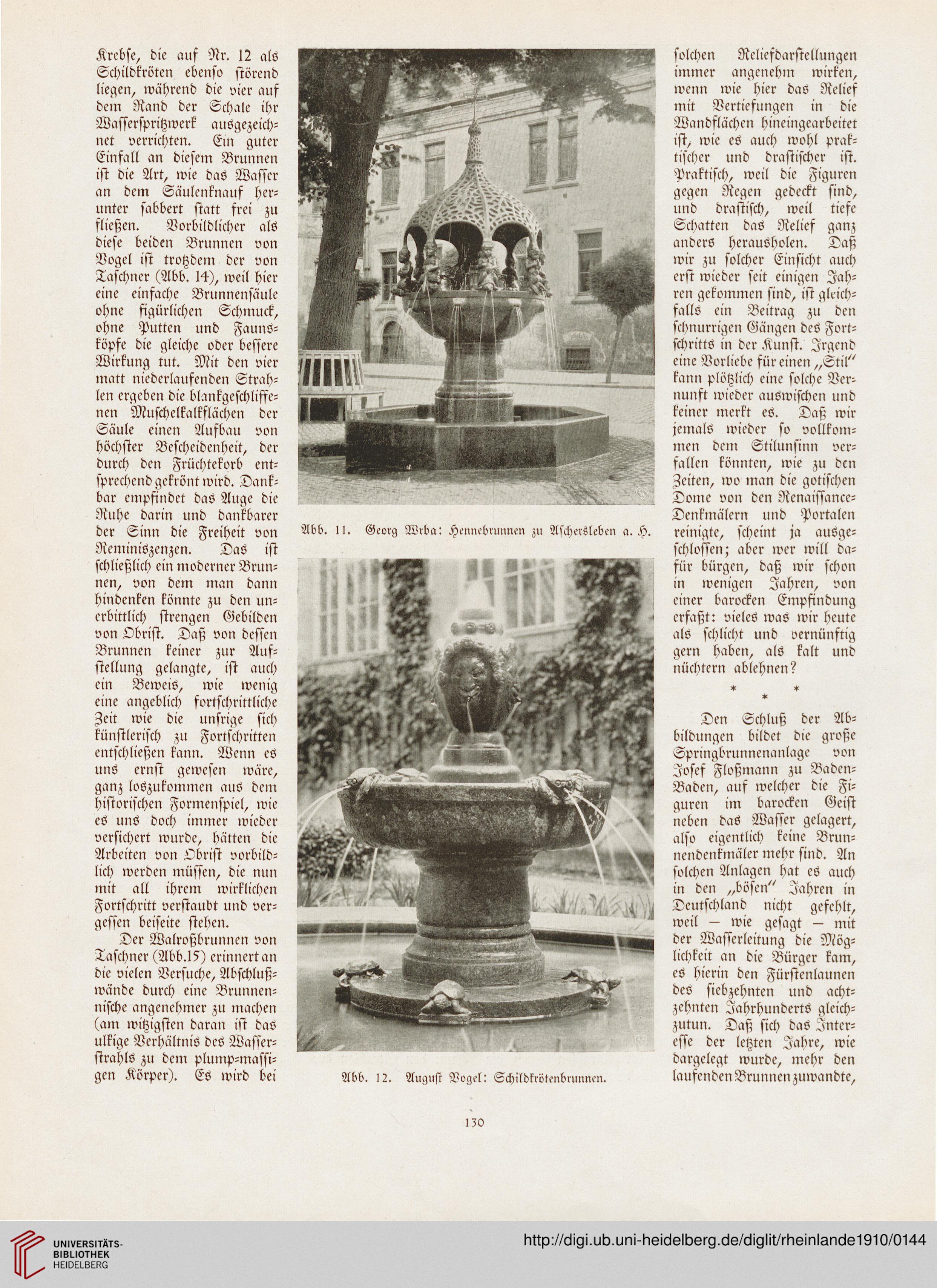Krebse, die auf Nr. 12 als
Schildkrötcn ebenso störcnd
liegen, während die vier aus
dein Rand der Schale ihr
Wasserspritzwerk ausgezeich-
net verrichten. Ein guter
Einfall an diesem Brunnen
ist die Art, wie das Wasscr
an dem Säulenknauf her-
unter sabbert statt frei zu
fließen. Vorbildlicher alS
diese beiden Brunnen von
Vogel ist trotzdem der von
Taschner (Abb. 14), weil hier
eine einfache Brunnensäule
ohne figürlichen Schmuck,
ohne Putten und Fauns-
köpfe die gleiche oder bessere
Wirkung tut. Mit den vier
matt niederlaufenden Strah-
len ergeben die blankgeschliffe-
nen Muschelkalkflächen der
Säule einen Aufbau von
höchster Bescheidenheit, der
durch den Früchtekorb ent-
sprechend gekrönt wird. Dank-
bar empfindet daS Auge die
Ruhe darin und dankbarer
der Sinn die Freiheit von
Rennniszenzen. Daö ist
schließlich ein moderner Brun-
nen, von dem man dann
hindenken könnte zu den un-
crbittlich strengen Gebilden
von Obrist. Daß von dessen
Brunnen keiner zur Auf-
stellung gelangte, ist auch
ein Beweis, wie wenig
eine angeblich fortschrittliche
Zeit wie die unsrige sich
künstlerisch zu Fortschritten
entschließen kann. Wenn es
uns ernst gewesen wäre,
ganz loszukommen aus dem
historischen Formenspiel, wie
es uns doch immer wieder
versichert wurde, hätten die
Arbeiten von Obrist vorbild-
lich werden müssen, die nun
mit all ihrem wirklichen
Fortschritt verstaubt und ver-
gessen beiseite ftehen.
Der Walroßbrunnen von
Taschner (Abb.I5) erinnert an
die vielen Versuche, Abschluß-
wände durch eine Brunnen-
nische angenehmer zu machen
(am witzigsten daran ist daö
ulkige VerhältniS dcs Wasser-
strahls zu dcm plump-massi-
gen Körper). Es wird bei
Abb. I I. Georg Wrba: Hennebrunnen zu Aschersleben a. H.
Abb. 12. August Vogel: Schildkrötenbrunncn.
solchen Reliefdarstellungen
immer angenehm wirken,
wenn wie hier daS Relief
mit Vertiefungen in die
Wandflächen hineingearbeitet
ift, wic es auch wohl prak-
tischer und drastischer ist.
Praktisch, weil die Figuren
gegen Regen gedeckt sind,
und drastisch, weil tiefe
Schatten daS Relief ganz
anderS herausholen. Daß
wir zu solcher Einsicht auch
erst wieder seit einigen Jah-
ren gekommen sind, ift gleich-
falls ein Beitrag zu den
schnurrigen Gängen deS Fort-
schritts in der Kunft. Jrgcnd
eine Vorliebe für einen „Stil"
kann plötzlich eine solche Ver-
nunft wieder auswischen und
keiner merkt es. Daß wir
jemalS wiedcr so vollkom-
mcn dcm Stilunsinn ver-
fallen könnten, wie zu dcn
Zeiten, wo man die gotischen
Dome von den Renaiffance-
Denkmälern und Portalen
reinigte, scheint ja ausge-
schlossen; aber wer will da-
für bürgen, daß wir schon
in wenigen Jahren, von
einer barocken Empfindung
crfaßt: vieleö was wir heute
als schlicht und oernünftig
gern habcn, als kalt und
nüchtcrn ablehnen?
* 4-
*
Den Schluß der Ab-
bildungen bildet die große
Springbrunnenanlage von
Josef Floßmann zu Badcn-
Baden, auf welcher die Fi-
guren im barocken Geift
iiebcn das Wasscr gelagert,
also eigentlich keine Brun-
nendenkmäler mehr sind. An
solchen Anlagen hat eö auch
in den „bösen" Jahren in
Deutschland nicht gefchlt,
weil - wie gesagt — mit
der Wasserleitung die Mög-
lichkeit an die Bürger kam,
es hierin den Fürstenlaunen
des siebzehnten und acht-
zehnten Jahrhundertö gleich-
zutun. Daß sich das Jnter-
esse der letzten Jahre, wie
dargelegt wurde, mehr den
lausenden Brunnen zuwandte.
Schildkrötcn ebenso störcnd
liegen, während die vier aus
dein Rand der Schale ihr
Wasserspritzwerk ausgezeich-
net verrichten. Ein guter
Einfall an diesem Brunnen
ist die Art, wie das Wasscr
an dem Säulenknauf her-
unter sabbert statt frei zu
fließen. Vorbildlicher alS
diese beiden Brunnen von
Vogel ist trotzdem der von
Taschner (Abb. 14), weil hier
eine einfache Brunnensäule
ohne figürlichen Schmuck,
ohne Putten und Fauns-
köpfe die gleiche oder bessere
Wirkung tut. Mit den vier
matt niederlaufenden Strah-
len ergeben die blankgeschliffe-
nen Muschelkalkflächen der
Säule einen Aufbau von
höchster Bescheidenheit, der
durch den Früchtekorb ent-
sprechend gekrönt wird. Dank-
bar empfindet daS Auge die
Ruhe darin und dankbarer
der Sinn die Freiheit von
Rennniszenzen. Daö ist
schließlich ein moderner Brun-
nen, von dem man dann
hindenken könnte zu den un-
crbittlich strengen Gebilden
von Obrist. Daß von dessen
Brunnen keiner zur Auf-
stellung gelangte, ist auch
ein Beweis, wie wenig
eine angeblich fortschrittliche
Zeit wie die unsrige sich
künstlerisch zu Fortschritten
entschließen kann. Wenn es
uns ernst gewesen wäre,
ganz loszukommen aus dem
historischen Formenspiel, wie
es uns doch immer wieder
versichert wurde, hätten die
Arbeiten von Obrist vorbild-
lich werden müssen, die nun
mit all ihrem wirklichen
Fortschritt verstaubt und ver-
gessen beiseite ftehen.
Der Walroßbrunnen von
Taschner (Abb.I5) erinnert an
die vielen Versuche, Abschluß-
wände durch eine Brunnen-
nische angenehmer zu machen
(am witzigsten daran ist daö
ulkige VerhältniS dcs Wasser-
strahls zu dcm plump-massi-
gen Körper). Es wird bei
Abb. I I. Georg Wrba: Hennebrunnen zu Aschersleben a. H.
Abb. 12. August Vogel: Schildkrötenbrunncn.
solchen Reliefdarstellungen
immer angenehm wirken,
wenn wie hier daS Relief
mit Vertiefungen in die
Wandflächen hineingearbeitet
ift, wic es auch wohl prak-
tischer und drastischer ist.
Praktisch, weil die Figuren
gegen Regen gedeckt sind,
und drastisch, weil tiefe
Schatten daS Relief ganz
anderS herausholen. Daß
wir zu solcher Einsicht auch
erst wieder seit einigen Jah-
ren gekommen sind, ift gleich-
falls ein Beitrag zu den
schnurrigen Gängen deS Fort-
schritts in der Kunft. Jrgcnd
eine Vorliebe für einen „Stil"
kann plötzlich eine solche Ver-
nunft wieder auswischen und
keiner merkt es. Daß wir
jemalS wiedcr so vollkom-
mcn dcm Stilunsinn ver-
fallen könnten, wie zu dcn
Zeiten, wo man die gotischen
Dome von den Renaiffance-
Denkmälern und Portalen
reinigte, scheint ja ausge-
schlossen; aber wer will da-
für bürgen, daß wir schon
in wenigen Jahren, von
einer barocken Empfindung
crfaßt: vieleö was wir heute
als schlicht und oernünftig
gern habcn, als kalt und
nüchtcrn ablehnen?
* 4-
*
Den Schluß der Ab-
bildungen bildet die große
Springbrunnenanlage von
Josef Floßmann zu Badcn-
Baden, auf welcher die Fi-
guren im barocken Geift
iiebcn das Wasscr gelagert,
also eigentlich keine Brun-
nendenkmäler mehr sind. An
solchen Anlagen hat eö auch
in den „bösen" Jahren in
Deutschland nicht gefchlt,
weil - wie gesagt — mit
der Wasserleitung die Mög-
lichkeit an die Bürger kam,
es hierin den Fürstenlaunen
des siebzehnten und acht-
zehnten Jahrhundertö gleich-
zutun. Daß sich das Jnter-
esse der letzten Jahre, wie
dargelegt wurde, mehr den
lausenden Brunnen zuwandte.