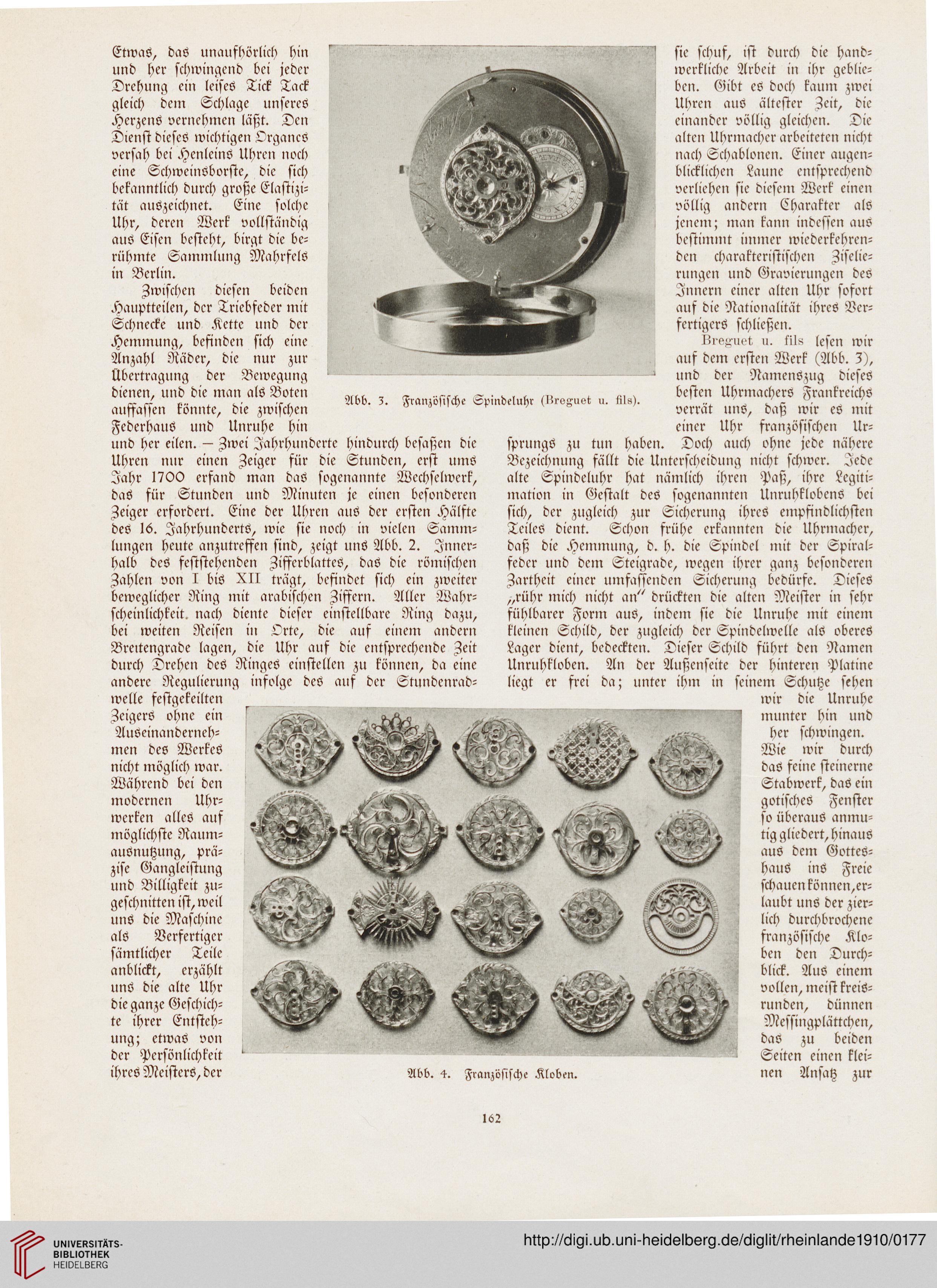Etwas, das unaufhörlich hin
und her schwingend bei jeder
Drehung ein leises Tick Tack
gleich dem Schlage unseres
Herzens vernehmen läßt. Den
Dienft dieses wichtigen Organcs
versah bei Henleinö Uhren nvch
eine SchweinSborfte, die sich
bekanntlich durch große Elaftizi-
tät auszeichnet. Eine solche
Uhr, deren Werk vollftändig
auö Eisen besteht, birgt die be-
riihmte Sammlung MahrselS
in Berlin.
Iwischen diesen beiden
Hauptteilen, dcr Triebfeder mit
Schnecke und Kette und der
Hemmung, bcfinden sich eine
Anzahl Räder, die nur zur
llbertragung der Bewegung
dienen, und die man alS Boten
auffassen könnte, die zwischen
Federhaus und Unruhe hin
und her eilen. — Zwei Jahrhundcrte hindurch besaßcn die
Uhren nur einen Zeiger sür die Stunden, erst ums
Iahr I70O erfand man das sogenannte Wechselwerk,
das für Stunden und Minuten je einen besonderen
Ieiger ersordert. Eine der Uhren aus der erften Hälfte
des 16. Jahrhunderts, wie sie noch in vielen Samm-
lungen heute anzutreffen sind, zeigt uns Abb. 2. Jnner-
halb des fcststchenden IiffcrblattcS, das die römischen
Zahlen von I bis XII trägt, befindet sich ein zweiter
beweglicher Ring mit arabischen Ziffern. Aller Wahr-
scheinlichkeit. nach diente dieser einstellbare Ring dazu,
bei weiten Reisen in Orte, die aus einem andern
Breitengrade lagen, die Uhr aus die entsprechende Aeit
durch Drehen des Ringes einstellen zu können, da eine
andere Regulicrung insolge deö auf der Stundcnrad-
welle sestgekeilten
Ieigers ohne ein
Auseinanderneh-
men des Werkes
nicht möglich war.
Währcnd bci den
modernen Uhr-
werken alles auf
möglichste Raum-
auönutzung, prä-
zise Gangleistung
und Billigkeit zu-
geschnitten ist, weil
uns die Maschine
als Versertiger
sämtlicher Teilc
anblickt, erzählt
unö die alte Uhr
dieganze Geschich-
te ihrer Entfteh-
ung; etwas von
der Persönlichkeit
ihres Meifters, der
sie schuf, ist durch die hand-
werkliche Arbeit in ihr geblie-
ben. Gibt eö doch kaum zwei
Uhren aus ältester Zeit, die
einander völlig gleichen. Die
alten Uhrmacher arbeiteten nicht
nach Schabloncn. Einer augen-
blicklichen Laune entsprechend
verliehen sie diesem Werk einen
völlig andern Charakter alö
jenem; man kann indeffen aus
bcstimmt immer wiederkehren-
den charakteristischen Zisclie-
rungen und Gravierungen des
Jnnern einer alten Uhr sofort
aus die Nationalität ihres Ver-
sertigerö schließen.
ürsKuet u. lils lesen wir
auf dcm crsten Werk (Abb. 7),
und der Namenszug dieseS
besten Uhrmacherö Frankreichs
verrät unS, daß wir es mit
einer Uhr sranzösischen Ur-
sprungS zu tun haben. Doch auch ohne jede nähere
Bezeichnung sällt die Unterscheidung nicht schwer. Jede
alte Spindeluhr hat nämlich ihren Paß, ihre Legiti-
mation in Gestalt des sogenannten Unruhklobcnö bei
sich, der zugleich zur Sicherung ihres empfindlichften
Teiles dient. Schon frühe erkannten die Uhrmacher,
daß die Hemmung, d. h. die Spindel mit der Spiral-
seder und dem Steigrade, wegen ihrer ganz besonderen
Iartheit einer umfassenden Sicherung bedürfe. Dieses
„rühr mich nicht an" drückten die alten Meister in sehr
fühlbarer Form auS, indem sie die Unruhe mit einem
kleinen Schild, der zugleich der Spindelwelle als oberes
Lager dient, bedeckten. Dieser Schild führt den Namen
Unruhkloben. An der Außenseite der hinteren Platine
liegt er srei da; unter ihm in seinem Schutze sehen
wir die Unruhe
munter hin und
her schwingen.
Wie wir durch
das feine steinerne
Stabwerk, das ein
gotisches Fenster
so überaus anmu-
tiggliedert,hinaus
aus dem Gottes-
haus inS Freie
schauenkönnen,er-
laubt uns der zier-
lich durchbrochene
französische Klo-
ben den Durch-
blick. Aus einem
vollen, meist kreis-
runden, dünncn
Messingplättchen,
das zu beiden
Seiten einen klei-
nen Ansatz zur
Abb. Z. Französische Spindeluhr (NröAuet u. üls).
Abb. 4. Französische Klvben.
und her schwingend bei jeder
Drehung ein leises Tick Tack
gleich dem Schlage unseres
Herzens vernehmen läßt. Den
Dienft dieses wichtigen Organcs
versah bei Henleinö Uhren nvch
eine SchweinSborfte, die sich
bekanntlich durch große Elaftizi-
tät auszeichnet. Eine solche
Uhr, deren Werk vollftändig
auö Eisen besteht, birgt die be-
riihmte Sammlung MahrselS
in Berlin.
Iwischen diesen beiden
Hauptteilen, dcr Triebfeder mit
Schnecke und Kette und der
Hemmung, bcfinden sich eine
Anzahl Räder, die nur zur
llbertragung der Bewegung
dienen, und die man alS Boten
auffassen könnte, die zwischen
Federhaus und Unruhe hin
und her eilen. — Zwei Jahrhundcrte hindurch besaßcn die
Uhren nur einen Zeiger sür die Stunden, erst ums
Iahr I70O erfand man das sogenannte Wechselwerk,
das für Stunden und Minuten je einen besonderen
Ieiger ersordert. Eine der Uhren aus der erften Hälfte
des 16. Jahrhunderts, wie sie noch in vielen Samm-
lungen heute anzutreffen sind, zeigt uns Abb. 2. Jnner-
halb des fcststchenden IiffcrblattcS, das die römischen
Zahlen von I bis XII trägt, befindet sich ein zweiter
beweglicher Ring mit arabischen Ziffern. Aller Wahr-
scheinlichkeit. nach diente dieser einstellbare Ring dazu,
bei weiten Reisen in Orte, die aus einem andern
Breitengrade lagen, die Uhr aus die entsprechende Aeit
durch Drehen des Ringes einstellen zu können, da eine
andere Regulicrung insolge deö auf der Stundcnrad-
welle sestgekeilten
Ieigers ohne ein
Auseinanderneh-
men des Werkes
nicht möglich war.
Währcnd bci den
modernen Uhr-
werken alles auf
möglichste Raum-
auönutzung, prä-
zise Gangleistung
und Billigkeit zu-
geschnitten ist, weil
uns die Maschine
als Versertiger
sämtlicher Teilc
anblickt, erzählt
unö die alte Uhr
dieganze Geschich-
te ihrer Entfteh-
ung; etwas von
der Persönlichkeit
ihres Meifters, der
sie schuf, ist durch die hand-
werkliche Arbeit in ihr geblie-
ben. Gibt eö doch kaum zwei
Uhren aus ältester Zeit, die
einander völlig gleichen. Die
alten Uhrmacher arbeiteten nicht
nach Schabloncn. Einer augen-
blicklichen Laune entsprechend
verliehen sie diesem Werk einen
völlig andern Charakter alö
jenem; man kann indeffen aus
bcstimmt immer wiederkehren-
den charakteristischen Zisclie-
rungen und Gravierungen des
Jnnern einer alten Uhr sofort
aus die Nationalität ihres Ver-
sertigerö schließen.
ürsKuet u. lils lesen wir
auf dcm crsten Werk (Abb. 7),
und der Namenszug dieseS
besten Uhrmacherö Frankreichs
verrät unS, daß wir es mit
einer Uhr sranzösischen Ur-
sprungS zu tun haben. Doch auch ohne jede nähere
Bezeichnung sällt die Unterscheidung nicht schwer. Jede
alte Spindeluhr hat nämlich ihren Paß, ihre Legiti-
mation in Gestalt des sogenannten Unruhklobcnö bei
sich, der zugleich zur Sicherung ihres empfindlichften
Teiles dient. Schon frühe erkannten die Uhrmacher,
daß die Hemmung, d. h. die Spindel mit der Spiral-
seder und dem Steigrade, wegen ihrer ganz besonderen
Iartheit einer umfassenden Sicherung bedürfe. Dieses
„rühr mich nicht an" drückten die alten Meister in sehr
fühlbarer Form auS, indem sie die Unruhe mit einem
kleinen Schild, der zugleich der Spindelwelle als oberes
Lager dient, bedeckten. Dieser Schild führt den Namen
Unruhkloben. An der Außenseite der hinteren Platine
liegt er srei da; unter ihm in seinem Schutze sehen
wir die Unruhe
munter hin und
her schwingen.
Wie wir durch
das feine steinerne
Stabwerk, das ein
gotisches Fenster
so überaus anmu-
tiggliedert,hinaus
aus dem Gottes-
haus inS Freie
schauenkönnen,er-
laubt uns der zier-
lich durchbrochene
französische Klo-
ben den Durch-
blick. Aus einem
vollen, meist kreis-
runden, dünncn
Messingplättchen,
das zu beiden
Seiten einen klei-
nen Ansatz zur
Abb. Z. Französische Spindeluhr (NröAuet u. üls).
Abb. 4. Französische Klvben.