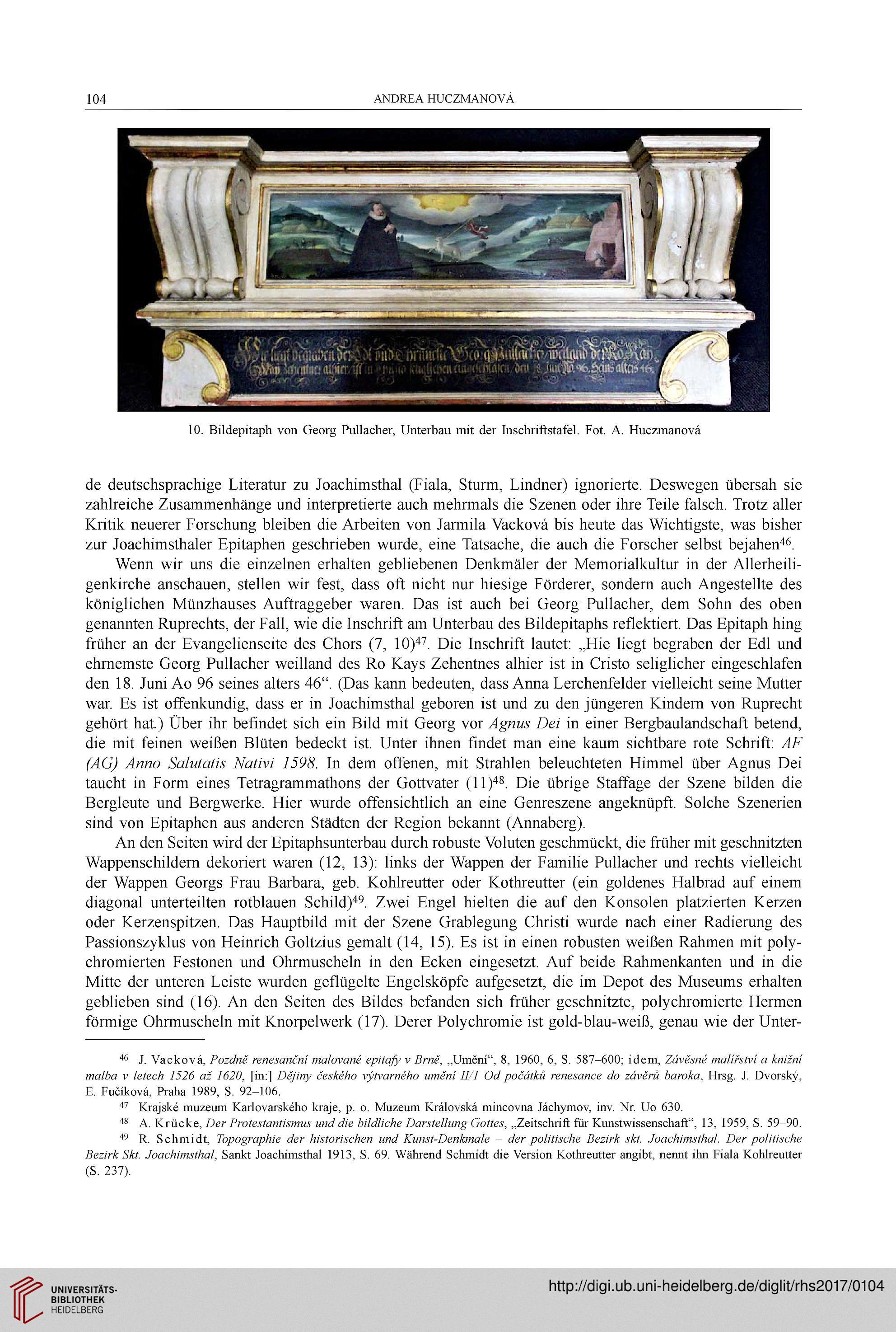104
ANDREA HUCZMANOVA
10. Bildepitaph von Georg Pullacher, Unterbau mit der Inschriftstafel. Fot. A. Huczmanovä
de deutschsprachige Literatur zu Joachimsthal (Fiala, Sturm, Lindner) ignorierte. Deswegen übersah sie
zahlreiche Zusammenhänge und interpretierte auch mehrmals die Szenen oder ihre Teile falsch. Trotz aller
Kritik neuerer Forschung bleiben die Arbeiten von Jarmila Vackovä bis heute das Wichtigste, was bisher
zur Joachimsthaler Epitaphen geschrieben wurde, eine Tatsache, die auch die Forscher selbst bejahen46.
Wenn wir uns die einzelnen erhalten gebliebenen Denkmäler der Memorialkultur in der Allerheili-
genkirche anschauen, stellen wir fest, dass oft nicht nur hiesige Förderer, sondern auch Angestellte des
königlichen Münzhauses Auftraggeber waren. Das ist auch bei Georg Pullacher, dem Sohn des oben
genannten Ruprechts, der Fall, wie die Inschrift am Unterbau des Bildepitaphs reflektiert. Das Epitaph hing
früher an der Evangelienseite des Chors (7, IO)47 Die Inschrift lautet: „Hie liegt begraben der Edl und
ehrnemste Georg Pullacher weilland des Ro Kays Zehentnes alhier ist in Cristo seliglicher eingeschlafen
den 18. Juni Ao 96 seines alters 46“. (Das kann bedeuten, dass Anna Lerchenfelder vielleicht seine Mutter
war. Es ist offenkundig, dass er in Joachimsthal geboren ist und zu den jüngeren Kindern von Ruprecht
gehört hat.) Über ihr befindet sich ein Bild mit Georg vor Agnus Dei in einer Bergbaulandschaft betend,
die mit feinen weißen Blüten bedeckt ist. Unter ihnen findet man eine kaum sichtbare rote Schrift: AF
(AG) Anno Salutatis Nativi 1598. In dem offenen, mit Strahlen beleuchteten Himmel über Agnus Dei
taucht in Form eines Tetragrammathons der Gottvater (ll)48. Die übrige Staffage der Szene bilden die
Bergleute und Bergwerke. Hier wurde offensichtlich an eine Genreszene angeknüpft. Solche Szenerien
sind von Epitaphen aus anderen Städten der Region bekannt (Annaberg).
An den Seiten wird der Epitaphsunterbau durch robuste Voluten geschmückt, die früher mit geschnitzten
Wappenschildern dekoriert waren (12, 13): links der Wappen der Familie Pullacher und rechts vielleicht
der Wappen Georgs Frau Barbara, geb. Kohlreutter oder Kothreutter (ein goldenes Halbrad auf einem
diagonal unterteilten rotblauen Schild)49. Zwei Engel hielten die auf den Konsolen platzierten Kerzen
oder Kerzenspitzen. Das Hauptbild mit der Szene Grablegung Christi wurde nach einer Radierung des
Passionszyklus von Heinrich Goltzius gemalt (14, 15). Es ist in einen robusten weißen Rahmen mit poly-
chromierten Festonen und Ohrmuscheln in den Ecken eingesetzt. Auf beide Rahmenkanten und in die
Mitte der unteren Leiste wurden geflügelte Engelsköpfe aufgesetzt, die im Depot des Museums erhalten
geblieben sind (16). An den Seiten des Bildes befanden sich früher geschnitzte, polychromierte Hermen
förmige Ohrmuscheln mit Knorpelwerk (17). Derer Polychromie ist gold-blau-weiß, genau wie der Unter-
46 J. Vackovä, Pozdnè renesancnt malované epitafy v Brné, „Urnern“, 8, 1960, 6, S. 587-600; idem, Zàvèsné malifstvi a kniznl
inalba v letech 1526 az 1620, [in:] Dèjiny ceského vytvarného umèni 11/1 Od pocàtku renesance do zàvérù baroka, Hrsg. J. Dvorsky,
E. Fucikovä, Praha 1989, S. 92-106.
47 Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o. Muzeum Kràlovskà mincovna Jachymov, inv. Nr. Uo 630.
48 A. Krücke, Der Protestantismus und die bildliche Darstellung Gottes, „Zeitschrift für Kunstwissenschaft“, 13, 1959, S. 59-90.
49 R. Schmidt, Topographie der historischen und Kunst-Denkmale - der politische Bezirk skt. Joachimsthal. Der politische
Bezirk Skt. Joachimsthal, Sankt Joachimsthal 1913, S. 69. Während Schmidt die Version Kothreutter angibt, nennt ihn Fiala Kohlreutter
(S. 237).
ANDREA HUCZMANOVA
10. Bildepitaph von Georg Pullacher, Unterbau mit der Inschriftstafel. Fot. A. Huczmanovä
de deutschsprachige Literatur zu Joachimsthal (Fiala, Sturm, Lindner) ignorierte. Deswegen übersah sie
zahlreiche Zusammenhänge und interpretierte auch mehrmals die Szenen oder ihre Teile falsch. Trotz aller
Kritik neuerer Forschung bleiben die Arbeiten von Jarmila Vackovä bis heute das Wichtigste, was bisher
zur Joachimsthaler Epitaphen geschrieben wurde, eine Tatsache, die auch die Forscher selbst bejahen46.
Wenn wir uns die einzelnen erhalten gebliebenen Denkmäler der Memorialkultur in der Allerheili-
genkirche anschauen, stellen wir fest, dass oft nicht nur hiesige Förderer, sondern auch Angestellte des
königlichen Münzhauses Auftraggeber waren. Das ist auch bei Georg Pullacher, dem Sohn des oben
genannten Ruprechts, der Fall, wie die Inschrift am Unterbau des Bildepitaphs reflektiert. Das Epitaph hing
früher an der Evangelienseite des Chors (7, IO)47 Die Inschrift lautet: „Hie liegt begraben der Edl und
ehrnemste Georg Pullacher weilland des Ro Kays Zehentnes alhier ist in Cristo seliglicher eingeschlafen
den 18. Juni Ao 96 seines alters 46“. (Das kann bedeuten, dass Anna Lerchenfelder vielleicht seine Mutter
war. Es ist offenkundig, dass er in Joachimsthal geboren ist und zu den jüngeren Kindern von Ruprecht
gehört hat.) Über ihr befindet sich ein Bild mit Georg vor Agnus Dei in einer Bergbaulandschaft betend,
die mit feinen weißen Blüten bedeckt ist. Unter ihnen findet man eine kaum sichtbare rote Schrift: AF
(AG) Anno Salutatis Nativi 1598. In dem offenen, mit Strahlen beleuchteten Himmel über Agnus Dei
taucht in Form eines Tetragrammathons der Gottvater (ll)48. Die übrige Staffage der Szene bilden die
Bergleute und Bergwerke. Hier wurde offensichtlich an eine Genreszene angeknüpft. Solche Szenerien
sind von Epitaphen aus anderen Städten der Region bekannt (Annaberg).
An den Seiten wird der Epitaphsunterbau durch robuste Voluten geschmückt, die früher mit geschnitzten
Wappenschildern dekoriert waren (12, 13): links der Wappen der Familie Pullacher und rechts vielleicht
der Wappen Georgs Frau Barbara, geb. Kohlreutter oder Kothreutter (ein goldenes Halbrad auf einem
diagonal unterteilten rotblauen Schild)49. Zwei Engel hielten die auf den Konsolen platzierten Kerzen
oder Kerzenspitzen. Das Hauptbild mit der Szene Grablegung Christi wurde nach einer Radierung des
Passionszyklus von Heinrich Goltzius gemalt (14, 15). Es ist in einen robusten weißen Rahmen mit poly-
chromierten Festonen und Ohrmuscheln in den Ecken eingesetzt. Auf beide Rahmenkanten und in die
Mitte der unteren Leiste wurden geflügelte Engelsköpfe aufgesetzt, die im Depot des Museums erhalten
geblieben sind (16). An den Seiten des Bildes befanden sich früher geschnitzte, polychromierte Hermen
förmige Ohrmuscheln mit Knorpelwerk (17). Derer Polychromie ist gold-blau-weiß, genau wie der Unter-
46 J. Vackovä, Pozdnè renesancnt malované epitafy v Brné, „Urnern“, 8, 1960, 6, S. 587-600; idem, Zàvèsné malifstvi a kniznl
inalba v letech 1526 az 1620, [in:] Dèjiny ceského vytvarného umèni 11/1 Od pocàtku renesance do zàvérù baroka, Hrsg. J. Dvorsky,
E. Fucikovä, Praha 1989, S. 92-106.
47 Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o. Muzeum Kràlovskà mincovna Jachymov, inv. Nr. Uo 630.
48 A. Krücke, Der Protestantismus und die bildliche Darstellung Gottes, „Zeitschrift für Kunstwissenschaft“, 13, 1959, S. 59-90.
49 R. Schmidt, Topographie der historischen und Kunst-Denkmale - der politische Bezirk skt. Joachimsthal. Der politische
Bezirk Skt. Joachimsthal, Sankt Joachimsthal 1913, S. 69. Während Schmidt die Version Kothreutter angibt, nennt ihn Fiala Kohlreutter
(S. 237).