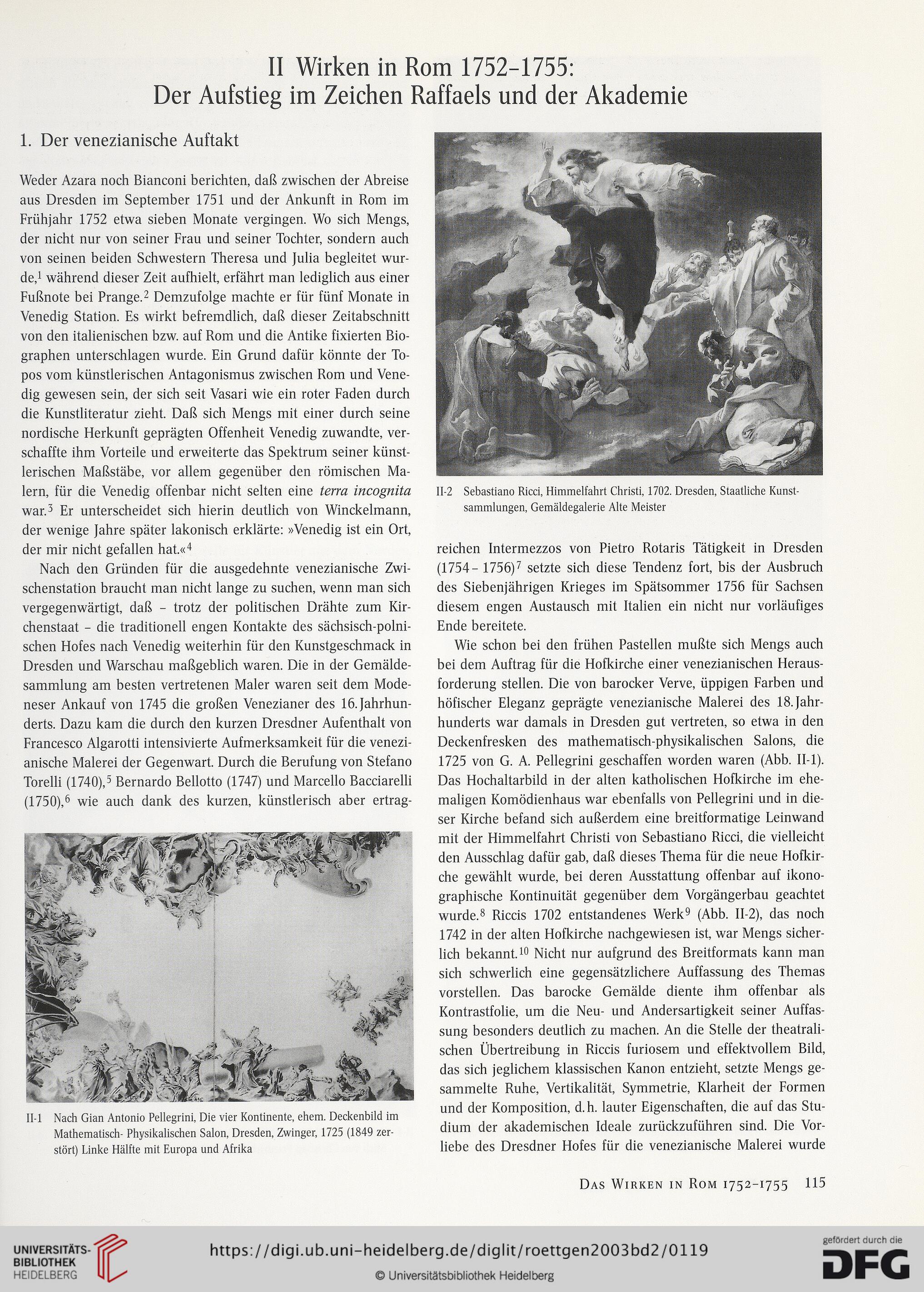II Wirken in Rom 1752-1755:
Der Aufstieg im Zeichen Raffaels und der Akademie
1. Der venezianische Auftakt
Weder Azara noch Bianconi berichten, daß zwischen der Abreise
aus Dresden im September 1751 und der Ankunft in Rom im
Frühjahr 1752 etwa sieben Monate vergingen. Wo sich Mengs,
der nicht nur von seiner Frau und seiner Tochter, sondern auch
von seinen beiden Schwestern Theresa und Julia begleitet wur-
de,1 während dieser Zeit aufhielt, erfährt man lediglich aus einer
Fußnote bei Prange.2 Demzufolge machte er für fünf Monate in
Venedig Station. Es wirkt befremdlich, daß dieser Zeitabschnitt
von den italienischen bzw. auf Rom und die Antike fixierten Bio-
graphen unterschlagen wurde. Ein Grund dafür könnte der To-
pos vom künstlerischen Antagonismus zwischen Rom und Vene-
dig gewesen sein, der sich seit Vasari wie ein roter Faden durch
die Kunstliteratur zieht. Daß sich Mengs mit einer durch seine
nordische Herkunft geprägten Offenheit Venedig zuwandte, ver-
schaffte ihm Vorteile und erweiterte das Spektrum seiner künst-
lerischen Maßstäbe, vor allem gegenüber den römischen Ma-
lern, für die Venedig offenbar nicht selten eine terra incognita
war.3 Er unterscheidet sich hierin deutlich von Winckelmann,
der wenige Jahre später lakonisch erklärte: »Venedig ist ein Ort,
der mir nicht gefallen hat.«4
Nach den Gründen für die ausgedehnte venezianische Zwi-
schenstation braucht man nicht lange zu suchen, wenn man sich
vergegenwärtigt, daß - trotz der politischen Drähte zum Kir-
chenstaat - die traditionell engen Kontakte des sächsisch-polni-
schen Hofes nach Venedig weiterhin für den Kunstgeschmack in
Dresden und Warschau maßgeblich waren. Die in der Gemälde-
sammlung am besten vertretenen Maler waren seit dem Mode-
neser Ankauf von 1745 die großen Venezianer des 16. Jahrhun-
derts. Dazu kam die durch den kurzen Dresdner Aufenthalt von
Francesco Algarotti intensivierte Aufmerksamkeit für die venezi-
anische Malerei der Gegenwart. Durch die Berufung von Stefano
Torelli (1740),5 Bernardo Beilotto (1747) und Marcello Bacciarelli
(1750),6 wie auch dank des kurzen, künstlerisch aber ertrag-
II-l Nach Gian Antonio Pellegrini, Die vier Kontinente, ehern. Deckenbild im
Mathematisch- Physikalischen Salon, Dresden, Zwinger, 1725 (1849 zer-
stört) Linke Hälfte mit Europa und Afrika
II-2 Sebastiano Ricci, Himmelfahrt Christi, 1702. Dresden, Staatliche Kunst-
sammlungen, Gemäldegalerie Alte Meister
reichen Intermezzos von Pietro Rotaris Tätigkeit in Dresden
(1754- 1756)7 setzte sich diese Tendenz fort, bis der Ausbruch
des Siebenjährigen Krieges im Spätsommer 1756 für Sachsen
diesem engen Austausch mit Italien ein nicht nur vorläufiges
Ende bereitete.
Wie schon bei den frühen Pastellen mußte sich Mengs auch
bei dem Auftrag für die Hofkirche einer venezianischen Heraus-
forderung stellen. Die von barocker Verve, üppigen Farben und
höfischer Eleganz geprägte venezianische Malerei des 18. Jahr-
hunderts war damals in Dresden gut vertreten, so etwa in den
Deckenfresken des mathematisch-physikalischen Salons, die
1725 von G. A. Pellegrini geschaffen worden waren (Abb. II-l).
Das Hochaltarbild in der alten katholischen Hofkirche im ehe-
maligen Komödienhaus war ebenfalls von Pellegrini und in die-
ser Kirche befand sich außerdem eine breitformatige Leinwand
mit der Himmelfahrt Christi von Sebastiano Ricci, die vielleicht
den Ausschlag dafür gab, daß dieses Thema für die neue Hofkir-
che gewählt wurde, bei deren Ausstattung offenbar auf ikono-
graphische Kontinuität gegenüber dem Vorgängerbau geachtet
wurde.8 Riccis 1702 entstandenes Werk9 (Abb. II-2), das noch
1742 in der alten Hofkirche nachgewiesen ist, war Mengs sicher-
lich bekannt.10 Nicht nur aufgrund des Breitformats kann man
sich schwerlich eine gegensätzlichere Auffassung des Themas
vorstellen. Das barocke Gemälde diente ihm offenbar als
Kontrastfolie, um die Neu- und Andersartigkeit seiner Auffas-
sung besonders deutlich zu machen. An die Stelle der theatrali-
schen Übertreibung in Riccis furiosem und effektvollem Bild,
das sich jeglichem klassischen Kanon entzieht, setzte Mengs ge-
sammelte Ruhe, Vertikalität, Symmetrie, Klarheit der Formen
und der Komposition, d.h. lauter Eigenschaften, die auf das Stu-
dium der akademischen Ideale zurückzuführen sind. Die Vor-
liebe des Dresdner Hofes für die venezianische Malerei wurde
Das Wirken in Rom 1752-1755 115
Der Aufstieg im Zeichen Raffaels und der Akademie
1. Der venezianische Auftakt
Weder Azara noch Bianconi berichten, daß zwischen der Abreise
aus Dresden im September 1751 und der Ankunft in Rom im
Frühjahr 1752 etwa sieben Monate vergingen. Wo sich Mengs,
der nicht nur von seiner Frau und seiner Tochter, sondern auch
von seinen beiden Schwestern Theresa und Julia begleitet wur-
de,1 während dieser Zeit aufhielt, erfährt man lediglich aus einer
Fußnote bei Prange.2 Demzufolge machte er für fünf Monate in
Venedig Station. Es wirkt befremdlich, daß dieser Zeitabschnitt
von den italienischen bzw. auf Rom und die Antike fixierten Bio-
graphen unterschlagen wurde. Ein Grund dafür könnte der To-
pos vom künstlerischen Antagonismus zwischen Rom und Vene-
dig gewesen sein, der sich seit Vasari wie ein roter Faden durch
die Kunstliteratur zieht. Daß sich Mengs mit einer durch seine
nordische Herkunft geprägten Offenheit Venedig zuwandte, ver-
schaffte ihm Vorteile und erweiterte das Spektrum seiner künst-
lerischen Maßstäbe, vor allem gegenüber den römischen Ma-
lern, für die Venedig offenbar nicht selten eine terra incognita
war.3 Er unterscheidet sich hierin deutlich von Winckelmann,
der wenige Jahre später lakonisch erklärte: »Venedig ist ein Ort,
der mir nicht gefallen hat.«4
Nach den Gründen für die ausgedehnte venezianische Zwi-
schenstation braucht man nicht lange zu suchen, wenn man sich
vergegenwärtigt, daß - trotz der politischen Drähte zum Kir-
chenstaat - die traditionell engen Kontakte des sächsisch-polni-
schen Hofes nach Venedig weiterhin für den Kunstgeschmack in
Dresden und Warschau maßgeblich waren. Die in der Gemälde-
sammlung am besten vertretenen Maler waren seit dem Mode-
neser Ankauf von 1745 die großen Venezianer des 16. Jahrhun-
derts. Dazu kam die durch den kurzen Dresdner Aufenthalt von
Francesco Algarotti intensivierte Aufmerksamkeit für die venezi-
anische Malerei der Gegenwart. Durch die Berufung von Stefano
Torelli (1740),5 Bernardo Beilotto (1747) und Marcello Bacciarelli
(1750),6 wie auch dank des kurzen, künstlerisch aber ertrag-
II-l Nach Gian Antonio Pellegrini, Die vier Kontinente, ehern. Deckenbild im
Mathematisch- Physikalischen Salon, Dresden, Zwinger, 1725 (1849 zer-
stört) Linke Hälfte mit Europa und Afrika
II-2 Sebastiano Ricci, Himmelfahrt Christi, 1702. Dresden, Staatliche Kunst-
sammlungen, Gemäldegalerie Alte Meister
reichen Intermezzos von Pietro Rotaris Tätigkeit in Dresden
(1754- 1756)7 setzte sich diese Tendenz fort, bis der Ausbruch
des Siebenjährigen Krieges im Spätsommer 1756 für Sachsen
diesem engen Austausch mit Italien ein nicht nur vorläufiges
Ende bereitete.
Wie schon bei den frühen Pastellen mußte sich Mengs auch
bei dem Auftrag für die Hofkirche einer venezianischen Heraus-
forderung stellen. Die von barocker Verve, üppigen Farben und
höfischer Eleganz geprägte venezianische Malerei des 18. Jahr-
hunderts war damals in Dresden gut vertreten, so etwa in den
Deckenfresken des mathematisch-physikalischen Salons, die
1725 von G. A. Pellegrini geschaffen worden waren (Abb. II-l).
Das Hochaltarbild in der alten katholischen Hofkirche im ehe-
maligen Komödienhaus war ebenfalls von Pellegrini und in die-
ser Kirche befand sich außerdem eine breitformatige Leinwand
mit der Himmelfahrt Christi von Sebastiano Ricci, die vielleicht
den Ausschlag dafür gab, daß dieses Thema für die neue Hofkir-
che gewählt wurde, bei deren Ausstattung offenbar auf ikono-
graphische Kontinuität gegenüber dem Vorgängerbau geachtet
wurde.8 Riccis 1702 entstandenes Werk9 (Abb. II-2), das noch
1742 in der alten Hofkirche nachgewiesen ist, war Mengs sicher-
lich bekannt.10 Nicht nur aufgrund des Breitformats kann man
sich schwerlich eine gegensätzlichere Auffassung des Themas
vorstellen. Das barocke Gemälde diente ihm offenbar als
Kontrastfolie, um die Neu- und Andersartigkeit seiner Auffas-
sung besonders deutlich zu machen. An die Stelle der theatrali-
schen Übertreibung in Riccis furiosem und effektvollem Bild,
das sich jeglichem klassischen Kanon entzieht, setzte Mengs ge-
sammelte Ruhe, Vertikalität, Symmetrie, Klarheit der Formen
und der Komposition, d.h. lauter Eigenschaften, die auf das Stu-
dium der akademischen Ideale zurückzuführen sind. Die Vor-
liebe des Dresdner Hofes für die venezianische Malerei wurde
Das Wirken in Rom 1752-1755 115