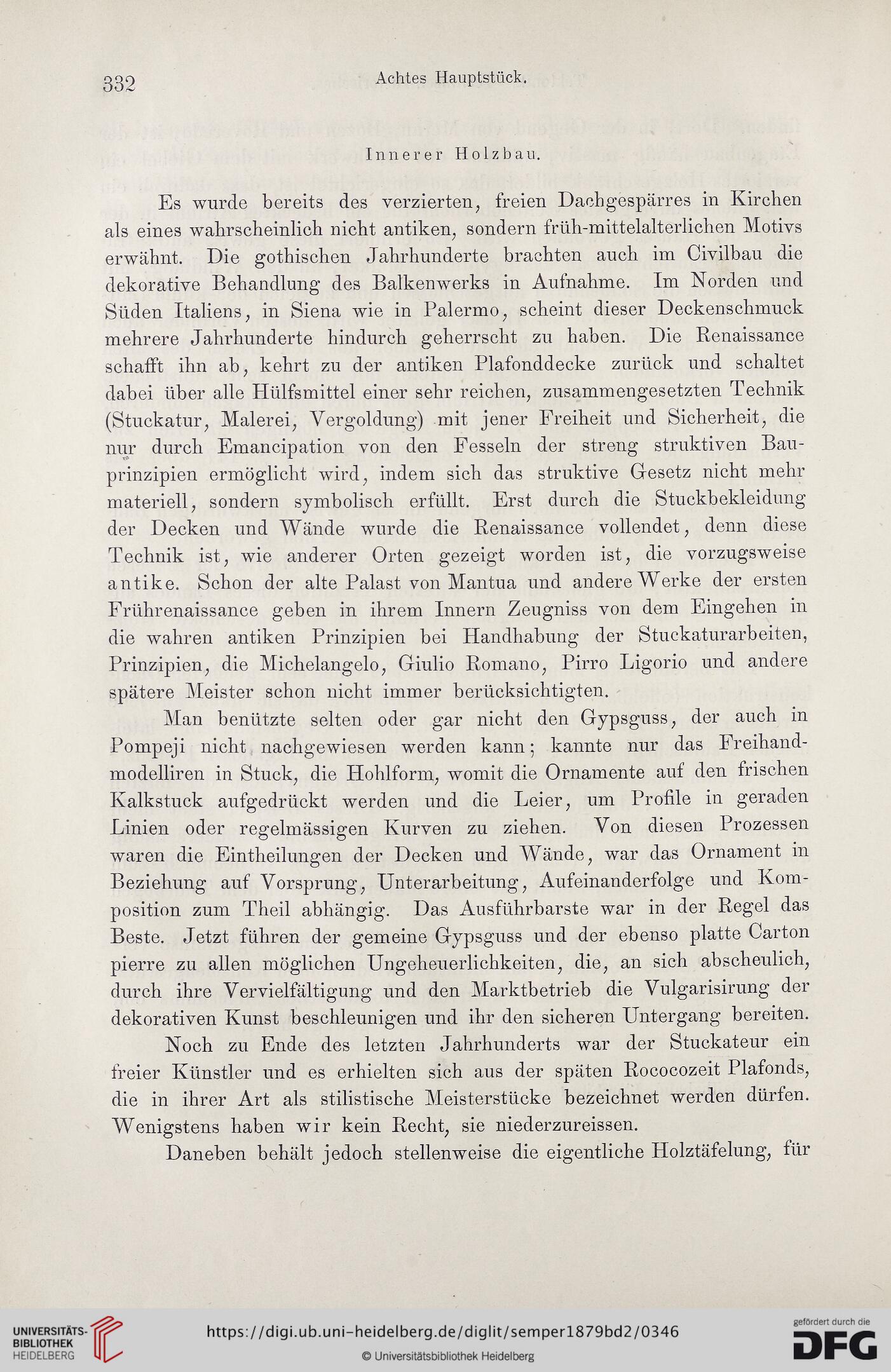332
Achtes Hauptstück.
Innerer Holzbau.
Es wurde bereits des verzierten, freien Dachgespärres in Kirchen
als eines wahrscheinlich nicht antiken, sondern früh-mittelalterlichen Motivs
erwähnt. Die gothischen Jahrhunderte brachten auch im Civilbau die
dekorative Behandlung des Balkenwerks in Aufnahme. Im Norden und
Süden Italiens, in Siena wie in Palermo, scheint dieser Deckenschmuck
mehrere Jahrhunderte hindurch geherrscht zu haben. Die Renaissance
schafft ihn ab, kehrt zu der antiken Plafonddecke zurück und schaltet
dabei über alle Hülfsmittel einer sehr reichen, zusammengesetzten Technik
(Stuckatur, Malerei, Vergoldung) mit jener Freiheit und Sicherheit, die
nur durch Emancipation von den Fesseln der streng struktiven Bau-
prinzipien ermöglicht wird, indem sich das struktive Gesetz nicht mehr
materiell, sondern symbolisch erfüllt. Erst durch die Stuckbekleidung
der Decken und Wände wurde die Renaissance vollendet, denn diese
Technik ist, wie anderer Orten gezeigt worden ist, die vorzugsweise
antike. Schon der alte Palast von Mantua und andere Werke der ersten
Frührenaissance geben in ihrem Innern Zeugniss von dem Eingehen in
die wahren antiken Prinzipien bei Handhabung der Stuckaturarbeiten,
Prinzipien, die Michelangelo, Giulio Romano, Pirro Ligorio und andere
spätere Meister schon nicht immer berücksichtigten.
Man benützte selten oder gar nicht den Gypsguss, der auch in
Pompeji nicht nachgewiesen werden kann; kannte nur das Freihand-
modelliren in Stuck, die Hohlform, womit die Ornamente auf den frischen
Kalkstuck aufgedrückt werden und die Leier, um Profile in geraden
Linien oder regelmässigen Kurven zu ziehen. Von diesen Prozessen
waren die Eintheilungen der Decken und Wände, war das Ornament in
Beziehung auf Vorsprung, Unterarbeitung, Aufeinanderfolge und Kom-
position zum Theil abhängig. Das Ausführbarste war in der Regel das
Beste. Jetzt führen der gemeine Gypsguss und der ebenso platte Carton
pierre zu allen möglichen Ungeheuerlichkeiten, die, an sich abscheulich,
durch ihre Vervielfältigung und den Marktbetrieb die Vulgarisirung der
dekorativen Kunst beschleunigen und ihr den sicheren Untergang bereiten.
Noch zu Ende des letzten Jahrhunderts war der Stuckateur ein
freier Künstler und es erhielten sich aus der späten Rococozeit Plafonds,
die in ihrer Art als stilistische Meisterstücke bezeichnet werden dürfen.
Wenigstens haben wir kein Recht, sie niederzureissen.
Daneben behält jedoch stellenweise die eigentliche Holztäfelung, für
Achtes Hauptstück.
Innerer Holzbau.
Es wurde bereits des verzierten, freien Dachgespärres in Kirchen
als eines wahrscheinlich nicht antiken, sondern früh-mittelalterlichen Motivs
erwähnt. Die gothischen Jahrhunderte brachten auch im Civilbau die
dekorative Behandlung des Balkenwerks in Aufnahme. Im Norden und
Süden Italiens, in Siena wie in Palermo, scheint dieser Deckenschmuck
mehrere Jahrhunderte hindurch geherrscht zu haben. Die Renaissance
schafft ihn ab, kehrt zu der antiken Plafonddecke zurück und schaltet
dabei über alle Hülfsmittel einer sehr reichen, zusammengesetzten Technik
(Stuckatur, Malerei, Vergoldung) mit jener Freiheit und Sicherheit, die
nur durch Emancipation von den Fesseln der streng struktiven Bau-
prinzipien ermöglicht wird, indem sich das struktive Gesetz nicht mehr
materiell, sondern symbolisch erfüllt. Erst durch die Stuckbekleidung
der Decken und Wände wurde die Renaissance vollendet, denn diese
Technik ist, wie anderer Orten gezeigt worden ist, die vorzugsweise
antike. Schon der alte Palast von Mantua und andere Werke der ersten
Frührenaissance geben in ihrem Innern Zeugniss von dem Eingehen in
die wahren antiken Prinzipien bei Handhabung der Stuckaturarbeiten,
Prinzipien, die Michelangelo, Giulio Romano, Pirro Ligorio und andere
spätere Meister schon nicht immer berücksichtigten.
Man benützte selten oder gar nicht den Gypsguss, der auch in
Pompeji nicht nachgewiesen werden kann; kannte nur das Freihand-
modelliren in Stuck, die Hohlform, womit die Ornamente auf den frischen
Kalkstuck aufgedrückt werden und die Leier, um Profile in geraden
Linien oder regelmässigen Kurven zu ziehen. Von diesen Prozessen
waren die Eintheilungen der Decken und Wände, war das Ornament in
Beziehung auf Vorsprung, Unterarbeitung, Aufeinanderfolge und Kom-
position zum Theil abhängig. Das Ausführbarste war in der Regel das
Beste. Jetzt führen der gemeine Gypsguss und der ebenso platte Carton
pierre zu allen möglichen Ungeheuerlichkeiten, die, an sich abscheulich,
durch ihre Vervielfältigung und den Marktbetrieb die Vulgarisirung der
dekorativen Kunst beschleunigen und ihr den sicheren Untergang bereiten.
Noch zu Ende des letzten Jahrhunderts war der Stuckateur ein
freier Künstler und es erhielten sich aus der späten Rococozeit Plafonds,
die in ihrer Art als stilistische Meisterstücke bezeichnet werden dürfen.
Wenigstens haben wir kein Recht, sie niederzureissen.
Daneben behält jedoch stellenweise die eigentliche Holztäfelung, für