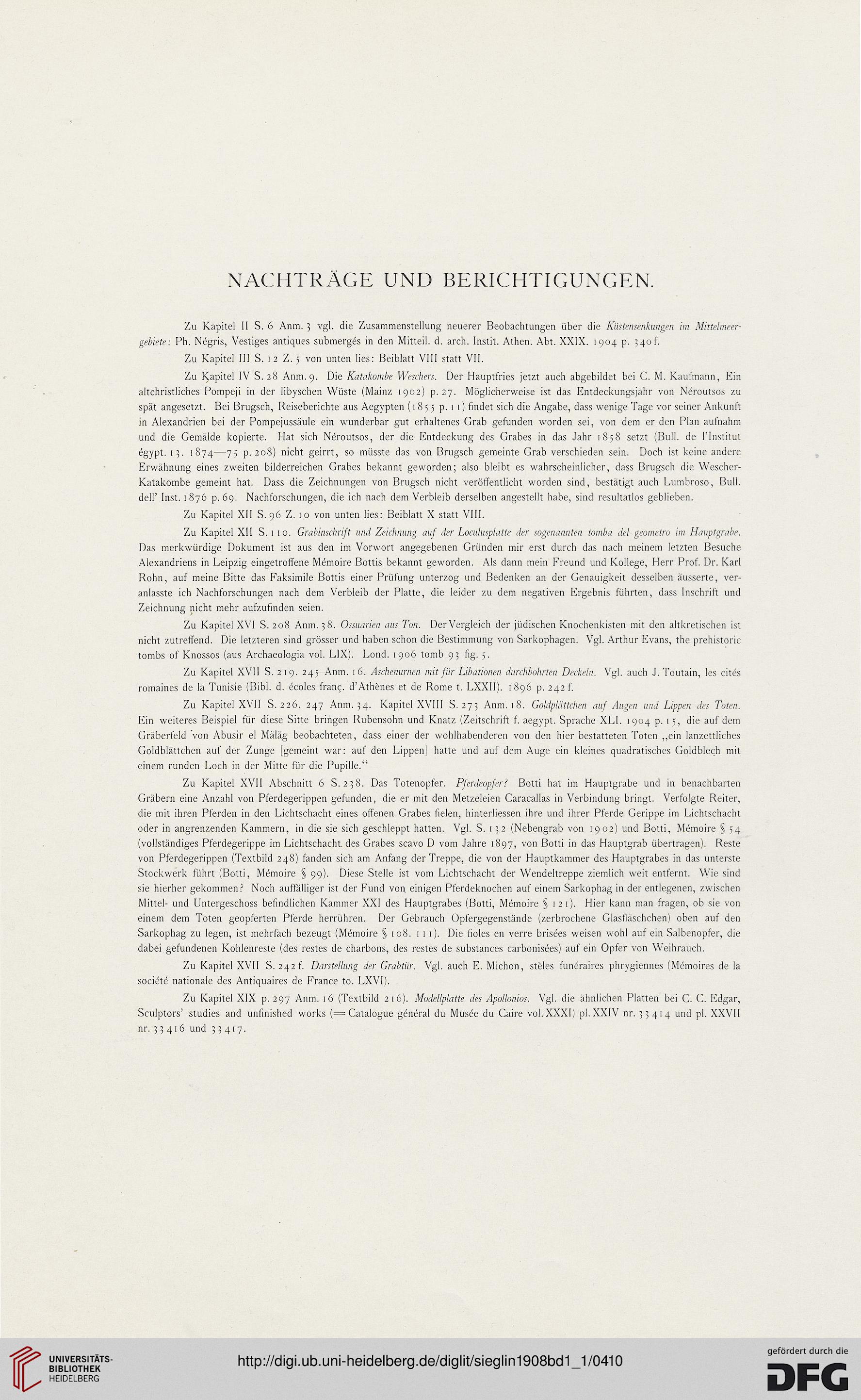NACHTRÄGE UND BERICHTIGUNGEN.
Zu Kapitel II S. 6 Anm. 3 vgl. die Zusammenstellung neuerer Beobachtungen über die Kästensenkungen im Mittelmeer-
gebiete: Ph. Ndgris, Vestiges antiques submergds in den Mitteil. d. arch. Instit. Athen. Abt. XXIX. 1904 p. 340 b
Zu Kapitel III S. 1 2 Z. 5 von unten lies: Beiblatt VIII statt VII.
Zu Kapitel IV S. 28 Anm. 9. Die Katakombe Weschers. Der Hauptfries jetzt auch abgebildet bei C. M. Kaufmann, Ein
altchristliches Pompeji in der libyschen Wüste (Mainz 1902) p. 27. Möglicherweise ist das Entdeckungsjahr von Nöroutsos zu
spät angesetzt. Bei Brugsch, Reiseberichte aus Aegypten (1855 p. 1 1) findet sich die Angabe, dass wenige Tage vor seiner Ankunft
in Alexandrien bei der Pompejussäule ein wunderbar gut erhaltenes Grab gefunden worden sei, von dem er den Plan aufnahm
und die Gemälde kopierte. Hat sich Nöroutsos, der die Entdeckung des Grabes in das Jahr 1858 setzt (Bull, de l’Institut
ögypt. 13. 1874—75 p. 208) nicht geirrt, so müsste das von Brugsch gemeinte Grab verschieden sein. Doch ist keine andere
Erwähnung eines zweiten bilderreichen Grabes bekannt geworden; also bleibt es wahrscheinlicher, dass Brugsch die Wescher-
Katakombe gemeint hat. Dass die Zeichnungen von Brugsch nicht veröffentlicht worden sind, bestätigt auch Lumbroso, Bull,
dell’ Inst. 1876 p.69. Nachforschungen, die ich nach dem Verbleib derselben angestellt habe, sind resultatlos geblieben.
Zu Kapitel XII S. 96 Z. 10 von unten lies: Beiblatt X statt VIII.
Zu Kapitel XII S. 1 10. Grabinschrift und Zeichnung auf der Loculusplatte der sogenannten tomba del geometro im Hauptgrabe.
Das merkwürdige Dokument ist aus den im Vorwort angegebenen Gründen mir erst durch das nach meinem letzten Besuche
Alexandriens in Leipzig eingetroffene Mömoire Bottis bekannt geworden. Als dann mein Freund und Kollege, Herr Prof. Dr. Karl
Rohn, auf meine Bitte das Faksimile Bottis einer Prüfung unterzog und Bedenken an der Genauigkeit desselben äusserte, ver-
anlasste ich Nachforschungen nach dem Verbleib der Platte, die leider zu dem negativen Ergebnis führten, dass Inschrift und
Zeichnung nicht mehr aufzufinden seien.
Zu Kapitel XVI S. 208 Anm. 38. Ossuarien aus Ton. DerVergleich der jüdischen Knochenkisten mit den altkretischen ist
nicht zutreffend. Die letzteren sind grösser und haben schon die Bestimmung von Sarkophagen. Vgl. Arthur Evans, the prehistoric
tombs of Knossos (aus Archaeologia vol. LIX). Lond. 1906 tomb 93 fig. 5.
Zu Kapitel XVII S. 219. 245 Anm. 16. Aschenurnen mit für Libationen durchbohrten Deckeln. Vgl. auch J.Toutain, les citds
romaines de la Tunisie (Bibi. d. öcoles franp. d’Athönes et de Rome t. LXXII). 1 896 p. 242 f.
Zu Kapitel XVII S. 226. 247 Anm. 34. Kapitel XVIII S. 273 Anm. 18. Goldplättchen auf Augen und Lippen des Toten.
Ein weiteres Beispiel für diese Sitte bringen Rubensohn und Knatz (Zeitschrift f. aegypt. Sprache XLI. 1904 p. 15, die auf dem
Gräberfeld von Abusir el Mäläg beobachteten, dass einer der wohlhabenderen von den hier bestatteten Toten „ein lanzettliches
Goldblättchen auf der Zunge [gemeint war: auf den Lippen] hatte und auf dem Auge ein kleines quadratisches Goldblech mit
einem runden Loch in der Mitte für die Pupille.“
Zu Kapitel XVII Abschnitt 6 S.238. Das Totenopfer. Pferdeopfer? Botti hat im Hauptgrabe und in benachbarten
Gräbern eine Anzahl von Pferdegerippen gefunden, die er mit den Metzeleien Caracallas in Verbindung bringt. Verfolgte Reiter,
die mit ihren Pferden in den Lichtschacht eines offenen Grabes fielen, hinterliessen ihre und ihrer Pferde Gerippe im Lichtschacht
oder in angrenzenden Kammern, in die sie sich geschleppt hatten. Vgl. S. 132 (Nebengrab von 1902) und Botti, Mümoire § 54
(vollständiges Pferdegerippe im Lichtschacht, des Grabes scavo D vom Jahre 1897, von Botti in das Hauptgrab übertragen). Reste
von Pferdegerippen (Textbild 248) fanden sich am Anfang der Treppe, die von der Hauptkammer des Hauptgrabes in das unterste
Stockwerk führt (Botti, Mömoire § 99). Diese Stelle ist vom Lichtschacht der Wendeltreppe ziemlich weit entfernt. Wie sind
sie hierher gekommen? Noch auffälliger ist der Fund von einigen Pferdeknochen auf einem Sarkophag in der entlegenen, zwischen
Mittel- und Untergeschoss befindlichen Kammer XXI des Hauptgrabes (Botti, Mümoire § 121). Hier kann man fragen, ob sie von
einem dem Toten geopferten Pferde herrühren. Der Gebrauch Opfergegenstände (zerbrochene Glasfläschchen) oben auf den
Sarkophag zu legen, ist mehrfach bezeugt (Mömoire § 108. 1 1 1). Die fioles en verre brisöes weisen wohl auf ein Salbenopfer, die
dabei gefundenen Kohlenreste (des restes de charbons, des restes de substances carbonisöes) auf ein Opfer von Weihrauch.
Zu Kapitel XVII S. 242 b Darstellung der Grabtür. Vgl. auch E. Michon, steles funöraires phrygiennes (Mömoires de Ia
sociötö nationale des Antiquaires de France to. LXVI).
Zu Kapitel XIX p. 297 Anm. 16 (Textbild 216). Modellplatte des Apollonios. Vgl. die ähnlichen Platten bei C. C. Edgar,
Sculptors’ studies and unfmished works (= Catalogue gönöral du Musüe du Caire vol. XXXI) pl.XXiV nr. 33414 und pl. XXVII
nr. 33416 und 33417.
Zu Kapitel II S. 6 Anm. 3 vgl. die Zusammenstellung neuerer Beobachtungen über die Kästensenkungen im Mittelmeer-
gebiete: Ph. Ndgris, Vestiges antiques submergds in den Mitteil. d. arch. Instit. Athen. Abt. XXIX. 1904 p. 340 b
Zu Kapitel III S. 1 2 Z. 5 von unten lies: Beiblatt VIII statt VII.
Zu Kapitel IV S. 28 Anm. 9. Die Katakombe Weschers. Der Hauptfries jetzt auch abgebildet bei C. M. Kaufmann, Ein
altchristliches Pompeji in der libyschen Wüste (Mainz 1902) p. 27. Möglicherweise ist das Entdeckungsjahr von Nöroutsos zu
spät angesetzt. Bei Brugsch, Reiseberichte aus Aegypten (1855 p. 1 1) findet sich die Angabe, dass wenige Tage vor seiner Ankunft
in Alexandrien bei der Pompejussäule ein wunderbar gut erhaltenes Grab gefunden worden sei, von dem er den Plan aufnahm
und die Gemälde kopierte. Hat sich Nöroutsos, der die Entdeckung des Grabes in das Jahr 1858 setzt (Bull, de l’Institut
ögypt. 13. 1874—75 p. 208) nicht geirrt, so müsste das von Brugsch gemeinte Grab verschieden sein. Doch ist keine andere
Erwähnung eines zweiten bilderreichen Grabes bekannt geworden; also bleibt es wahrscheinlicher, dass Brugsch die Wescher-
Katakombe gemeint hat. Dass die Zeichnungen von Brugsch nicht veröffentlicht worden sind, bestätigt auch Lumbroso, Bull,
dell’ Inst. 1876 p.69. Nachforschungen, die ich nach dem Verbleib derselben angestellt habe, sind resultatlos geblieben.
Zu Kapitel XII S. 96 Z. 10 von unten lies: Beiblatt X statt VIII.
Zu Kapitel XII S. 1 10. Grabinschrift und Zeichnung auf der Loculusplatte der sogenannten tomba del geometro im Hauptgrabe.
Das merkwürdige Dokument ist aus den im Vorwort angegebenen Gründen mir erst durch das nach meinem letzten Besuche
Alexandriens in Leipzig eingetroffene Mömoire Bottis bekannt geworden. Als dann mein Freund und Kollege, Herr Prof. Dr. Karl
Rohn, auf meine Bitte das Faksimile Bottis einer Prüfung unterzog und Bedenken an der Genauigkeit desselben äusserte, ver-
anlasste ich Nachforschungen nach dem Verbleib der Platte, die leider zu dem negativen Ergebnis führten, dass Inschrift und
Zeichnung nicht mehr aufzufinden seien.
Zu Kapitel XVI S. 208 Anm. 38. Ossuarien aus Ton. DerVergleich der jüdischen Knochenkisten mit den altkretischen ist
nicht zutreffend. Die letzteren sind grösser und haben schon die Bestimmung von Sarkophagen. Vgl. Arthur Evans, the prehistoric
tombs of Knossos (aus Archaeologia vol. LIX). Lond. 1906 tomb 93 fig. 5.
Zu Kapitel XVII S. 219. 245 Anm. 16. Aschenurnen mit für Libationen durchbohrten Deckeln. Vgl. auch J.Toutain, les citds
romaines de la Tunisie (Bibi. d. öcoles franp. d’Athönes et de Rome t. LXXII). 1 896 p. 242 f.
Zu Kapitel XVII S. 226. 247 Anm. 34. Kapitel XVIII S. 273 Anm. 18. Goldplättchen auf Augen und Lippen des Toten.
Ein weiteres Beispiel für diese Sitte bringen Rubensohn und Knatz (Zeitschrift f. aegypt. Sprache XLI. 1904 p. 15, die auf dem
Gräberfeld von Abusir el Mäläg beobachteten, dass einer der wohlhabenderen von den hier bestatteten Toten „ein lanzettliches
Goldblättchen auf der Zunge [gemeint war: auf den Lippen] hatte und auf dem Auge ein kleines quadratisches Goldblech mit
einem runden Loch in der Mitte für die Pupille.“
Zu Kapitel XVII Abschnitt 6 S.238. Das Totenopfer. Pferdeopfer? Botti hat im Hauptgrabe und in benachbarten
Gräbern eine Anzahl von Pferdegerippen gefunden, die er mit den Metzeleien Caracallas in Verbindung bringt. Verfolgte Reiter,
die mit ihren Pferden in den Lichtschacht eines offenen Grabes fielen, hinterliessen ihre und ihrer Pferde Gerippe im Lichtschacht
oder in angrenzenden Kammern, in die sie sich geschleppt hatten. Vgl. S. 132 (Nebengrab von 1902) und Botti, Mümoire § 54
(vollständiges Pferdegerippe im Lichtschacht, des Grabes scavo D vom Jahre 1897, von Botti in das Hauptgrab übertragen). Reste
von Pferdegerippen (Textbild 248) fanden sich am Anfang der Treppe, die von der Hauptkammer des Hauptgrabes in das unterste
Stockwerk führt (Botti, Mömoire § 99). Diese Stelle ist vom Lichtschacht der Wendeltreppe ziemlich weit entfernt. Wie sind
sie hierher gekommen? Noch auffälliger ist der Fund von einigen Pferdeknochen auf einem Sarkophag in der entlegenen, zwischen
Mittel- und Untergeschoss befindlichen Kammer XXI des Hauptgrabes (Botti, Mümoire § 121). Hier kann man fragen, ob sie von
einem dem Toten geopferten Pferde herrühren. Der Gebrauch Opfergegenstände (zerbrochene Glasfläschchen) oben auf den
Sarkophag zu legen, ist mehrfach bezeugt (Mömoire § 108. 1 1 1). Die fioles en verre brisöes weisen wohl auf ein Salbenopfer, die
dabei gefundenen Kohlenreste (des restes de charbons, des restes de substances carbonisöes) auf ein Opfer von Weihrauch.
Zu Kapitel XVII S. 242 b Darstellung der Grabtür. Vgl. auch E. Michon, steles funöraires phrygiennes (Mömoires de Ia
sociötö nationale des Antiquaires de France to. LXVI).
Zu Kapitel XIX p. 297 Anm. 16 (Textbild 216). Modellplatte des Apollonios. Vgl. die ähnlichen Platten bei C. C. Edgar,
Sculptors’ studies and unfmished works (= Catalogue gönöral du Musüe du Caire vol. XXXI) pl.XXiV nr. 33414 und pl. XXVII
nr. 33416 und 33417.