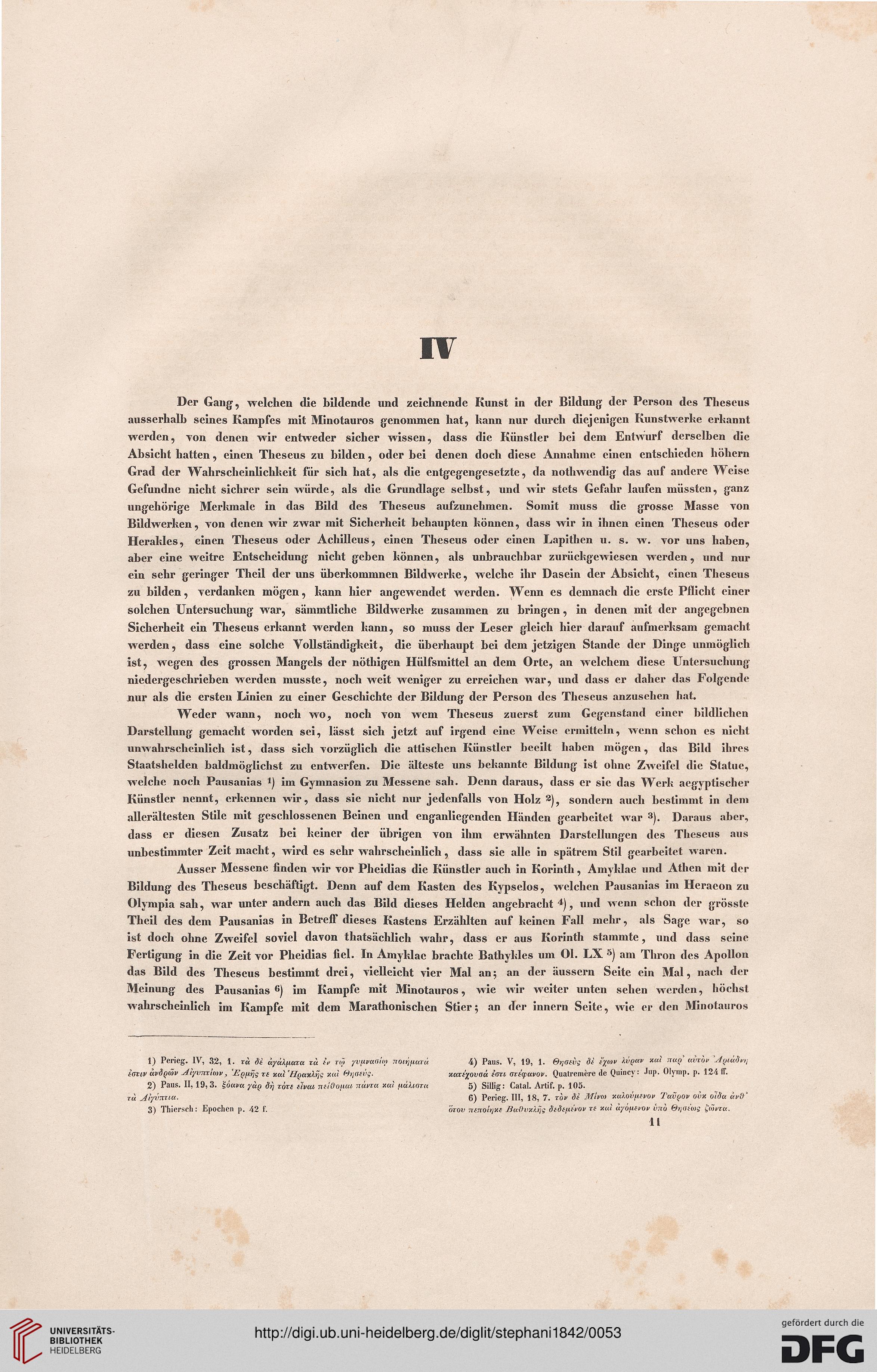Der Gang, welchen die bildende und zeichnende Kunst in der Bildung der Person des Theseus
ausserhalb seines Kampfes mit Minotauros genommen hat, kann nur durch diejenigen Kunstwerke erkannt
werden, Ton denen wir entweder sicher wissen, dass die Künstler bei dem Entwurf derselben die
Absicht hatten, einen Theseus zu bilden, oder bei denen doch diese Annahme einen entschieden höhern
Grad der Wahrscheinlichkeit für sich hat, als die entgegengesetzte, da nothwendig das auf andere Weise
Gefundne nicht sichrer sein würde, als die Grundlage selbst, und wir stets Gefahr laufen müssten, ganz
ungehörige Merkmale in das Bild des Theseus aufzunehmen. Somit muss die grosse Masse von
Bildwerken, von denen wir zwar mit Sicherheit behaupten können, dass wir in ihnen einen Theseus oder
Herakles, einen Theseus oder Achilleus, einen Theseus oder einen Lapithen u. s. w. vor uns haben,
aber eine weitre Entscheidung nicht geben können, als unbrauchbar zurückgewiesen werden, und nur
ein sehr geringer Theil der uns überkommnen Bildwerke, welche ihr Dasein der Absicht, einen Theseus
zu bilden, verdanken mögen, kann hier angewendet werden. Wenn es demnach die erste Pflicht einer
solchen Untersuchung w ar, sämmtlichc Bildwerke zusammen zu bringen, in denen mit der angegebnen
Sicherheit ein Theseus erkannt werden kann, so muss der Leser gleich hier darauf aufmerksam gemacht
werden, dass eine solche Vollständigkeit, die überhaupt bei dem jetzigen Stande der Dinge unmöglich
ist, wegen des grossen Mangels der nöthigen Hülfsmittel an dem Orte, an welchem diese Untersuchung
niedergeschrieben werden musste, noch weit weniger zu erreichen war, und dass er daher das Folgende
nur als die ersten Linien zu einer Geschichte der Bildung der Person des Theseus anzusehen hat.
Weder wann, noch wo, noch von wem Theseus zuerst zum Gegenstand einer bildlichen
Darstellung gemacht worden sei, lässt sich jetzt auf irgend eine Weise ermitteln, wenn schon es nicht
unwahrscheinlich ist, dass sich vorzüglich die attischen Künstler beeilt haben mögen, das Bild ihres
Staatshelden baldmöglichst zu entwerfen. Die älteste uns bekannte Bildung ist ohne Zweifel die Statue,
welche noch Pausanias *) im Gymnasion zu Messene sah. Denn daraus, dass er sie das Werk aegvptischer
Künstler nennt, erkennen wir, dass sie nicht nur jedenfalls von Holz 3), sondern auch bestimmt in dem
allerältesten Stile mit geschlossenen Beinen und enganliegenden Händen gearbeitet war 3). Daraus aber,
dass er diesen Zusatz bei keiner der übrigen von ihm erwähnten Darstellungen des Theseus aus
unbestimmter Zeit macht, wird es sehr wahrscheinlich, dass sie alle in spätrem Stil gearbeitet waren.
Ausser Messene finden wir vor Pheidias die Künstler auch in Korinth, Amvklae und Athen mit der
Bildung des Theseus beschäftigt. Denn auf dem Kasten des Kypselos, welchen Pausanias im Heraeon zu
Olympia sah, war unter andern auch das Bild dieses Helden angebracht 4), und wenn schon der grösste
Theil des dem Pausanias in Betreff dieses Kastens Erzählten auf keinen Fall mehr, als Sage war, so
ist doch ohne Zweifel soviel davon thatsächlich wahr, dass er aus Korinth stammte, und dass seine
Fertigung in die Zeit vor Pheidias fiel. In Amyklac brachte Bathykles um Ol. LX 5) am Thron des Apollon
das Bild des Theseus bestimmt drei, vielleicht vier Mal an; an der äussern Seite ein Mal, nach der
Meinung des Pausanias6) im Kampfe mit Minotauros, wie wir weiter unten sehen werden, höchst
wahrscheinlich im Kampfe mit dem Marathonischen Stier; an der innern Seite, wie er den Minotauros
1) Perieg. IV, 32, 1. rä dt aydkfiaza icc tV ro> yvpvaolm noiij^iuTu
iativ uvSqwv Aiyvirtimv, 'E^ji^g rt xal 'Hgaxlijs xal ßtjacvg.
2) Paus. II, 19,3. iöavu yag dt] rört elvai nei&opM nuvra xai ndUma
tu Aiyvmia.
3) Thicrscli: Epochen p. 42 f.
4) Paus. V, 19, 1. &n<jtvg dt i'xoiv Ai^av xal nup' aveov '^(fiäditj
xoai%ovaä iari mtyavov. Quatremere de Quincy: Jap. Olymp, p. 124 ff.
5) Sillig: Catal. Artif. p. 105.
6) Perieg. III, 18, 7. rhu dt Mivo) xalov^avov Taiifjov ovx oida ai>0'
Ötov TTfnolijxe Ba&vxkijs dedffUfOv Tt xui ayoiinoi/ vjiu &>jtn'wg fajfra.
II
ausserhalb seines Kampfes mit Minotauros genommen hat, kann nur durch diejenigen Kunstwerke erkannt
werden, Ton denen wir entweder sicher wissen, dass die Künstler bei dem Entwurf derselben die
Absicht hatten, einen Theseus zu bilden, oder bei denen doch diese Annahme einen entschieden höhern
Grad der Wahrscheinlichkeit für sich hat, als die entgegengesetzte, da nothwendig das auf andere Weise
Gefundne nicht sichrer sein würde, als die Grundlage selbst, und wir stets Gefahr laufen müssten, ganz
ungehörige Merkmale in das Bild des Theseus aufzunehmen. Somit muss die grosse Masse von
Bildwerken, von denen wir zwar mit Sicherheit behaupten können, dass wir in ihnen einen Theseus oder
Herakles, einen Theseus oder Achilleus, einen Theseus oder einen Lapithen u. s. w. vor uns haben,
aber eine weitre Entscheidung nicht geben können, als unbrauchbar zurückgewiesen werden, und nur
ein sehr geringer Theil der uns überkommnen Bildwerke, welche ihr Dasein der Absicht, einen Theseus
zu bilden, verdanken mögen, kann hier angewendet werden. Wenn es demnach die erste Pflicht einer
solchen Untersuchung w ar, sämmtlichc Bildwerke zusammen zu bringen, in denen mit der angegebnen
Sicherheit ein Theseus erkannt werden kann, so muss der Leser gleich hier darauf aufmerksam gemacht
werden, dass eine solche Vollständigkeit, die überhaupt bei dem jetzigen Stande der Dinge unmöglich
ist, wegen des grossen Mangels der nöthigen Hülfsmittel an dem Orte, an welchem diese Untersuchung
niedergeschrieben werden musste, noch weit weniger zu erreichen war, und dass er daher das Folgende
nur als die ersten Linien zu einer Geschichte der Bildung der Person des Theseus anzusehen hat.
Weder wann, noch wo, noch von wem Theseus zuerst zum Gegenstand einer bildlichen
Darstellung gemacht worden sei, lässt sich jetzt auf irgend eine Weise ermitteln, wenn schon es nicht
unwahrscheinlich ist, dass sich vorzüglich die attischen Künstler beeilt haben mögen, das Bild ihres
Staatshelden baldmöglichst zu entwerfen. Die älteste uns bekannte Bildung ist ohne Zweifel die Statue,
welche noch Pausanias *) im Gymnasion zu Messene sah. Denn daraus, dass er sie das Werk aegvptischer
Künstler nennt, erkennen wir, dass sie nicht nur jedenfalls von Holz 3), sondern auch bestimmt in dem
allerältesten Stile mit geschlossenen Beinen und enganliegenden Händen gearbeitet war 3). Daraus aber,
dass er diesen Zusatz bei keiner der übrigen von ihm erwähnten Darstellungen des Theseus aus
unbestimmter Zeit macht, wird es sehr wahrscheinlich, dass sie alle in spätrem Stil gearbeitet waren.
Ausser Messene finden wir vor Pheidias die Künstler auch in Korinth, Amvklae und Athen mit der
Bildung des Theseus beschäftigt. Denn auf dem Kasten des Kypselos, welchen Pausanias im Heraeon zu
Olympia sah, war unter andern auch das Bild dieses Helden angebracht 4), und wenn schon der grösste
Theil des dem Pausanias in Betreff dieses Kastens Erzählten auf keinen Fall mehr, als Sage war, so
ist doch ohne Zweifel soviel davon thatsächlich wahr, dass er aus Korinth stammte, und dass seine
Fertigung in die Zeit vor Pheidias fiel. In Amyklac brachte Bathykles um Ol. LX 5) am Thron des Apollon
das Bild des Theseus bestimmt drei, vielleicht vier Mal an; an der äussern Seite ein Mal, nach der
Meinung des Pausanias6) im Kampfe mit Minotauros, wie wir weiter unten sehen werden, höchst
wahrscheinlich im Kampfe mit dem Marathonischen Stier; an der innern Seite, wie er den Minotauros
1) Perieg. IV, 32, 1. rä dt aydkfiaza icc tV ro> yvpvaolm noiij^iuTu
iativ uvSqwv Aiyvirtimv, 'E^ji^g rt xal 'Hgaxlijs xal ßtjacvg.
2) Paus. II, 19,3. iöavu yag dt] rört elvai nei&opM nuvra xai ndUma
tu Aiyvmia.
3) Thicrscli: Epochen p. 42 f.
4) Paus. V, 19, 1. &n<jtvg dt i'xoiv Ai^av xal nup' aveov '^(fiäditj
xoai%ovaä iari mtyavov. Quatremere de Quincy: Jap. Olymp, p. 124 ff.
5) Sillig: Catal. Artif. p. 105.
6) Perieg. III, 18, 7. rhu dt Mivo) xalov^avov Taiifjov ovx oida ai>0'
Ötov TTfnolijxe Ba&vxkijs dedffUfOv Tt xui ayoiinoi/ vjiu &>jtn'wg fajfra.
II