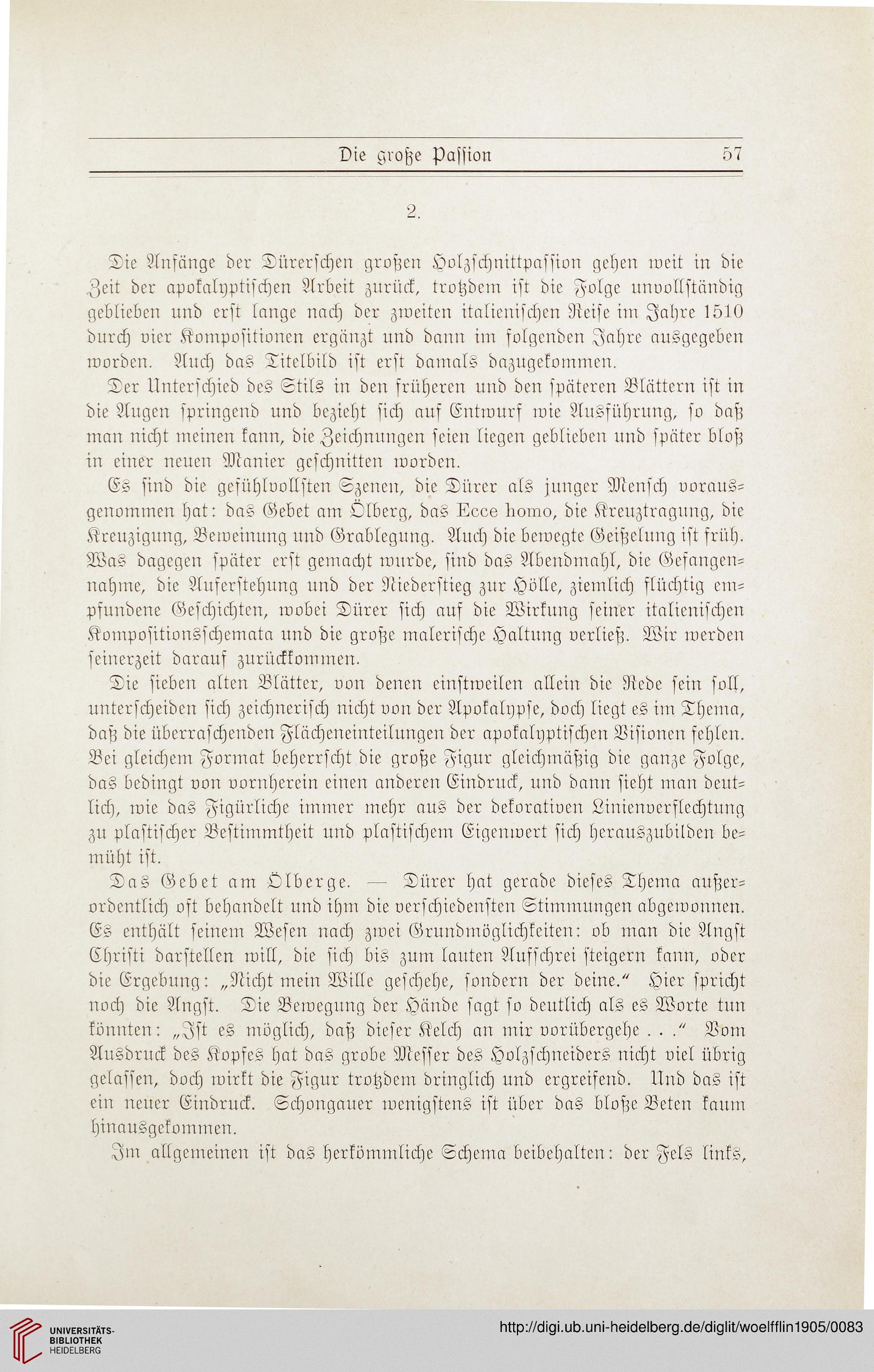Die gvoße passion
57
2.
Die Anfänge der Dürerschen großen Holzschnittpassion gehen weit in die
Zeit der apokalyptischen Arbeit znrück, trotzdem ist die Folge unvollständig
geblieben und erst lange nach der zmeiten italienischen Reise irn Jahre l510
durch vier Kompositionen ergänzt und dann im solgenden Jahre ausgegeben
worden. Auch das Titelbild ist erst damals dazugekommen.
Der llnterschied des Stils in den früheren und den späteren Blättern ist in
die Augen springend und bezieht sich auf Entwurf wie Aussührung, so daß
man nicht meinen kann, die Zeichnungen seien liegen geblieben und später bloß
in einer neuen Manier geschnitten worden.
Es sind die gesühlvollsten Szenen, die Dürer als junger Mensch voraus-
genommen hat: das Gebet am Ölberg, das Looo üomo, die Kreuztragung, die
Kreuzigung, Beweinung und Grablegung. Auch die bewegte Geißelung ist früh.
Was dagegen später erst gemacht wurde, sind das Abendmahl, die Gefnngen-
nahme, die Auferstehung und der Otiederstieg zur Hölle, ziemlich flüchtig em-
pfundene Geschichten, wobei Dürer sich auf die Wirkung seiner italienischen
Kompositionsschemata und die große malerische Haltung verließ. Wir werden
seinerzeit darauf zurückkommen.
Die sieben alten Blätter, von denen einstweilen allein die Rede sein soll,
nnterscheiden sich zeichnerisch nicht oon der Apokalypse, doch liegt es im Thema,
daß die überraschenden Flächeneinteilungen der npokalpptischen Visionen fehlen.
Bei gleichem Format beherrscht die große Figur gleichmäßig die ganze Folge,
das bedingt von vornherein einen anderen Eindruck, und dann sieht man deut-
lich, wie das Figürliche immer mehr aus der dekorativen Linienverflechtung
zu plastischer Bestimmtheit und plastischem Eigenivert sich herauszubilden be-
müht ist.
Das Gebet am Ölberge. — Dürer hat gerade dieses Thema außer-
ordentlich oft behandelt und ihm die verschiedensten Stimmungen abgewonnen.
Es enthält seinem Wesen nach zwei Grundmöglichkeiten: ob man die Angst
Christi darstellen will, die sich bis zum lauten Aufschrei steigern kann, oder
die Ergebung: „Nicht mein Wille geschehe, sondern der deine." Hier spricht
noch die Angst. Die Bewegung der Hände sagt so deutlich als es Worte tun
könnten: „Jst es möglich, daß dieser Kelch an mir vorübergehe . . ." Dom
Ausdruck des Kopfes hat das grobe Messer des Holzschneiders nicht viel übrig
gelassen, doch wirkt die Figur trotzdem dringlich und ergreifend. Ilnd das ist
ein neuer Eindruck. Schongauer wenigstens ist über das bloße Beten kaum
hinausgekommen.
Jm allgemeinen ist das herkömmliche Schema beibehalten: der Fels links.
57
2.
Die Anfänge der Dürerschen großen Holzschnittpassion gehen weit in die
Zeit der apokalyptischen Arbeit znrück, trotzdem ist die Folge unvollständig
geblieben und erst lange nach der zmeiten italienischen Reise irn Jahre l510
durch vier Kompositionen ergänzt und dann im solgenden Jahre ausgegeben
worden. Auch das Titelbild ist erst damals dazugekommen.
Der llnterschied des Stils in den früheren und den späteren Blättern ist in
die Augen springend und bezieht sich auf Entwurf wie Aussührung, so daß
man nicht meinen kann, die Zeichnungen seien liegen geblieben und später bloß
in einer neuen Manier geschnitten worden.
Es sind die gesühlvollsten Szenen, die Dürer als junger Mensch voraus-
genommen hat: das Gebet am Ölberg, das Looo üomo, die Kreuztragung, die
Kreuzigung, Beweinung und Grablegung. Auch die bewegte Geißelung ist früh.
Was dagegen später erst gemacht wurde, sind das Abendmahl, die Gefnngen-
nahme, die Auferstehung und der Otiederstieg zur Hölle, ziemlich flüchtig em-
pfundene Geschichten, wobei Dürer sich auf die Wirkung seiner italienischen
Kompositionsschemata und die große malerische Haltung verließ. Wir werden
seinerzeit darauf zurückkommen.
Die sieben alten Blätter, von denen einstweilen allein die Rede sein soll,
nnterscheiden sich zeichnerisch nicht oon der Apokalypse, doch liegt es im Thema,
daß die überraschenden Flächeneinteilungen der npokalpptischen Visionen fehlen.
Bei gleichem Format beherrscht die große Figur gleichmäßig die ganze Folge,
das bedingt von vornherein einen anderen Eindruck, und dann sieht man deut-
lich, wie das Figürliche immer mehr aus der dekorativen Linienverflechtung
zu plastischer Bestimmtheit und plastischem Eigenivert sich herauszubilden be-
müht ist.
Das Gebet am Ölberge. — Dürer hat gerade dieses Thema außer-
ordentlich oft behandelt und ihm die verschiedensten Stimmungen abgewonnen.
Es enthält seinem Wesen nach zwei Grundmöglichkeiten: ob man die Angst
Christi darstellen will, die sich bis zum lauten Aufschrei steigern kann, oder
die Ergebung: „Nicht mein Wille geschehe, sondern der deine." Hier spricht
noch die Angst. Die Bewegung der Hände sagt so deutlich als es Worte tun
könnten: „Jst es möglich, daß dieser Kelch an mir vorübergehe . . ." Dom
Ausdruck des Kopfes hat das grobe Messer des Holzschneiders nicht viel übrig
gelassen, doch wirkt die Figur trotzdem dringlich und ergreifend. Ilnd das ist
ein neuer Eindruck. Schongauer wenigstens ist über das bloße Beten kaum
hinausgekommen.
Jm allgemeinen ist das herkömmliche Schema beibehalten: der Fels links.