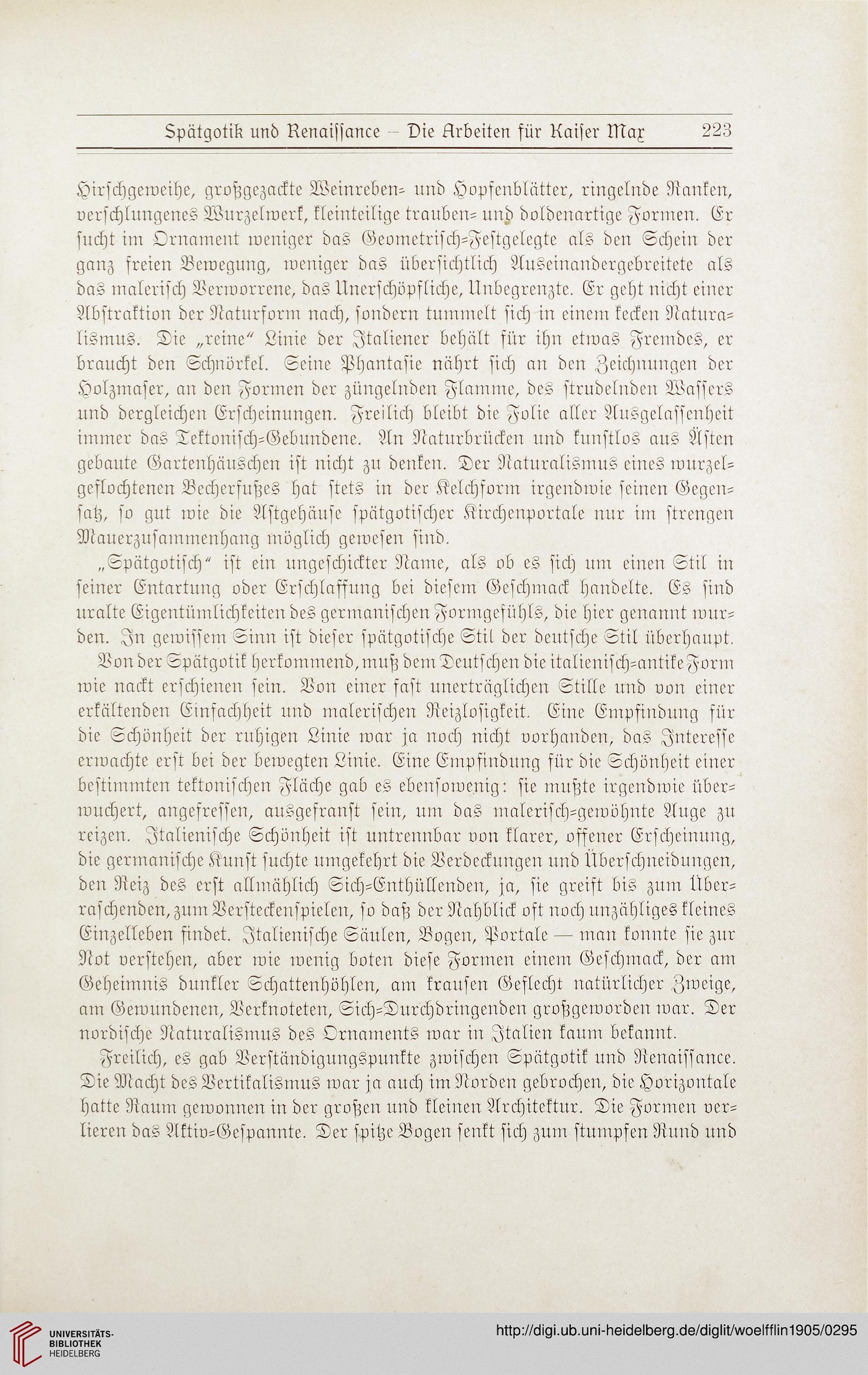Zpätgotik und Renaissance -- Die Krbeiten für ktaiser Max 223
Hirschgeweihe, großgezackte Weinreben- nnd Hopfenblätter, ringelnde Ranken,
verschlungenes Wurzelwerk, kleinteilige trauben- und doldenartige Formen. Er
sucht im Ornament weniger das Geometrisch-Festgelegte als den Schein der
ganz freien Bewegung, weniger das übersichtlich Auseinandergebreitete als
das malerisch Verworrene, das Unerschöpfliche, Unbegrenzte. Er geht nicht einer
Abstraktion der Naturform nach, sondern tummelt sich in einem kecken Natura-
lismus. Die „reine" Linie der Jtaliener behält für ihn etwas Fremdes, er
braucht den Schnörkel. Seine Phantasie nährt sich an den Zeichnungen der
Holzmaser, an den Formen der züngelnden Flamme, des strudelnden Wassers
und dergleichen Erscheinungen. Freckich bleibt die Folie aller Ausgelassenheit
immer das Tektonisch-Gebundene. An Naturbrücken und kunstlos aus Ästen
gebaute Gartenhäuschen ist nicht zu denken. Der Naturalismus eines wurzel-
geflochtenen Becherfußes hat stets in der Kelchform irgendwie seinen Gegen-
satz, so gut wie die Astgehäuse spätgotischer Kirchenportale nur im strengen
Mauerzusammenhang möglich gewesen sind.
„Spätgotisch" ist ein ungeschickter Name, als ob es sich um einen Stil in
seiner Entartung oder Erschlassung bei diesem Geschmack handelte. Es sind
uralte Eigentümlichkeiten des germanischen Formgefühls, die hier genannt wur-
den. Jn gewissem Sinn ist dieser spätgotische Stit der deutsche Stil überhaupt.
Von der Spätgotik herkommend,muß demDeutschen die italienisch-antikeForm
wie nackt erschienen sein. Von einer fast unerträglichen Stille und oon einer
erkältenden Einfachheit und malerischen Reizlosigkeit. Eine Empfindung sür
die Schönheit der ruhigen Linie war ja noch nicht vorhanden, das Jnteresse
erwachte erst bei der bewegten Linie. Eine Empfindung für die Schönheit einer
bestimmten tektonischen Fläche gab es ebensowenig: sie mußte irgendwie über-
wuchert, angefressen, ausgefranst sein, um das malerisch-gewöhnte Auge zu
reizen. Jtalienische Schönheit ist untrennbar oon klarer, osfener Erscheinung,
die germanische Kunst suchte umgekehrt die Verdeckungen und Nberschneidungen,
den Reiz des erst allmahlich Sich-Enthüllenden, ja, sie greift bis zum Nber-
raschenden,zum Versteckenspielen, so daß der Nahblick oft noch unzähliges kleines
Einzelleben sindet. Jtalienische Säulen, Bogen, Portale — man konnte sie zur
Not verstehen, aber wie wenig boten diese Formen einem Geschmack, der am
Geheimnis dunkler Schattenhöhlen, am krausen Geslecht natürlicher Zweige,
am Gewundenen, Verknoteten, Sich-Durchdringenden großgeworden war. Der
nordische Naturalismus des Ornaments war in Jtalien kaum bekannt.
Freilich, es gab Verständigungspunkte zwischen Spätgotik und Renaissance.
Die Macht des Vertikalismus war ja auch im Norden gebrochen, die Horizontale
hatte Raum gewonnen in der großen und kleinen Architektur. Die Formen ver-
lieren das Aktiv-Gespannte. Der spitze Bogen senkt sich zum stumpfen Rnnd und
Hirschgeweihe, großgezackte Weinreben- nnd Hopfenblätter, ringelnde Ranken,
verschlungenes Wurzelwerk, kleinteilige trauben- und doldenartige Formen. Er
sucht im Ornament weniger das Geometrisch-Festgelegte als den Schein der
ganz freien Bewegung, weniger das übersichtlich Auseinandergebreitete als
das malerisch Verworrene, das Unerschöpfliche, Unbegrenzte. Er geht nicht einer
Abstraktion der Naturform nach, sondern tummelt sich in einem kecken Natura-
lismus. Die „reine" Linie der Jtaliener behält für ihn etwas Fremdes, er
braucht den Schnörkel. Seine Phantasie nährt sich an den Zeichnungen der
Holzmaser, an den Formen der züngelnden Flamme, des strudelnden Wassers
und dergleichen Erscheinungen. Freckich bleibt die Folie aller Ausgelassenheit
immer das Tektonisch-Gebundene. An Naturbrücken und kunstlos aus Ästen
gebaute Gartenhäuschen ist nicht zu denken. Der Naturalismus eines wurzel-
geflochtenen Becherfußes hat stets in der Kelchform irgendwie seinen Gegen-
satz, so gut wie die Astgehäuse spätgotischer Kirchenportale nur im strengen
Mauerzusammenhang möglich gewesen sind.
„Spätgotisch" ist ein ungeschickter Name, als ob es sich um einen Stil in
seiner Entartung oder Erschlassung bei diesem Geschmack handelte. Es sind
uralte Eigentümlichkeiten des germanischen Formgefühls, die hier genannt wur-
den. Jn gewissem Sinn ist dieser spätgotische Stit der deutsche Stil überhaupt.
Von der Spätgotik herkommend,muß demDeutschen die italienisch-antikeForm
wie nackt erschienen sein. Von einer fast unerträglichen Stille und oon einer
erkältenden Einfachheit und malerischen Reizlosigkeit. Eine Empfindung sür
die Schönheit der ruhigen Linie war ja noch nicht vorhanden, das Jnteresse
erwachte erst bei der bewegten Linie. Eine Empfindung für die Schönheit einer
bestimmten tektonischen Fläche gab es ebensowenig: sie mußte irgendwie über-
wuchert, angefressen, ausgefranst sein, um das malerisch-gewöhnte Auge zu
reizen. Jtalienische Schönheit ist untrennbar oon klarer, osfener Erscheinung,
die germanische Kunst suchte umgekehrt die Verdeckungen und Nberschneidungen,
den Reiz des erst allmahlich Sich-Enthüllenden, ja, sie greift bis zum Nber-
raschenden,zum Versteckenspielen, so daß der Nahblick oft noch unzähliges kleines
Einzelleben sindet. Jtalienische Säulen, Bogen, Portale — man konnte sie zur
Not verstehen, aber wie wenig boten diese Formen einem Geschmack, der am
Geheimnis dunkler Schattenhöhlen, am krausen Geslecht natürlicher Zweige,
am Gewundenen, Verknoteten, Sich-Durchdringenden großgeworden war. Der
nordische Naturalismus des Ornaments war in Jtalien kaum bekannt.
Freilich, es gab Verständigungspunkte zwischen Spätgotik und Renaissance.
Die Macht des Vertikalismus war ja auch im Norden gebrochen, die Horizontale
hatte Raum gewonnen in der großen und kleinen Architektur. Die Formen ver-
lieren das Aktiv-Gespannte. Der spitze Bogen senkt sich zum stumpfen Rnnd und