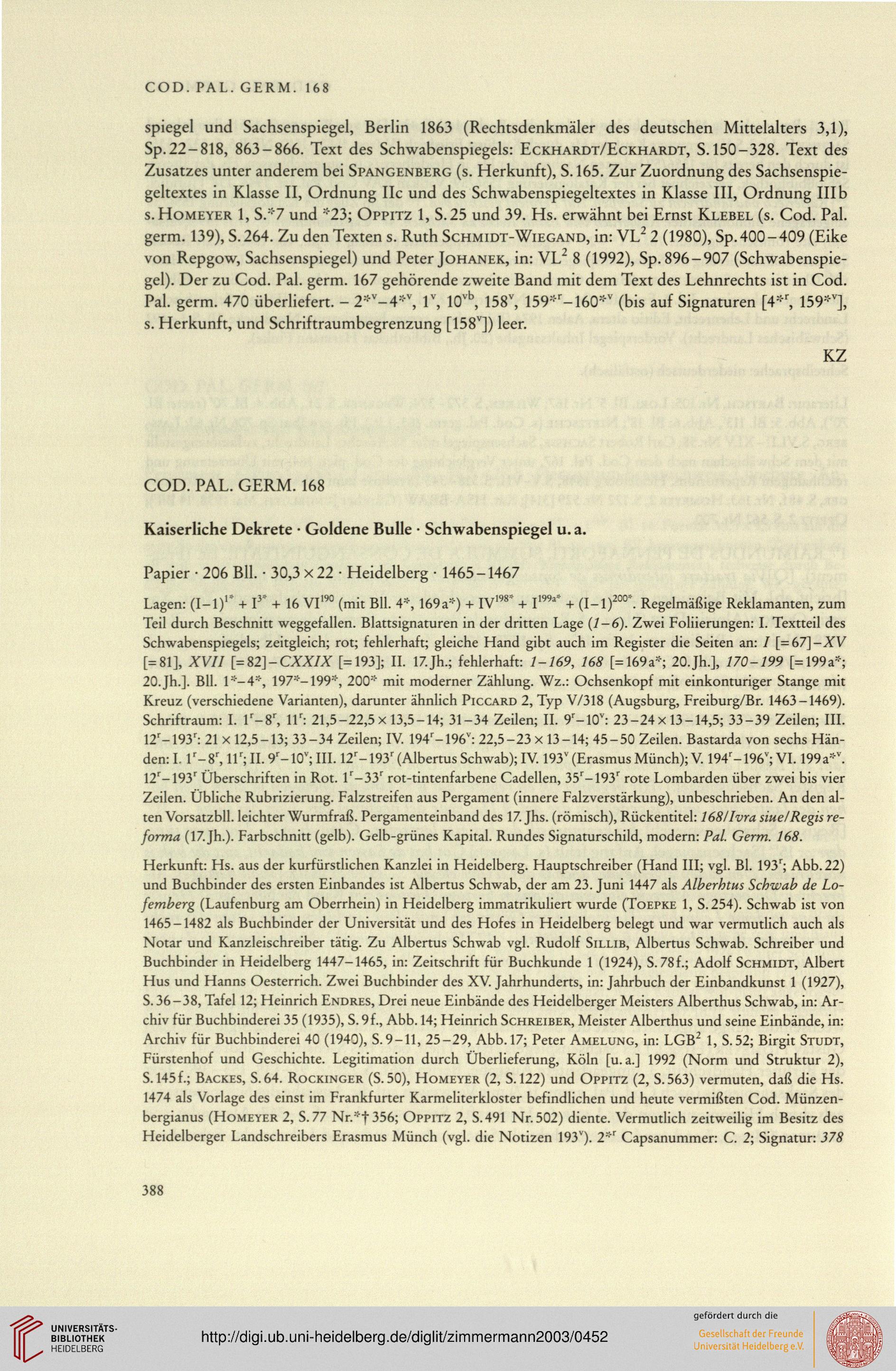COD. PAL. GERM. 168
Spiegel und Sachsenspiegel, Berlin 1863 (Rechtsdenkmäler des deutschen Mittelalters 3,1),
Sp.22-818, 863-866. Text des Schwabenspiegels: Eckhardt/Eckhardt, S. 150-328. Text des
Zusatzes unter anderem bei Spangenberg (s. Herkunft), S. 165. Zur Zuordnung des Sachsenspie-
geltextes in Klasse II, Ordnung IIc und des Schwabenspiegeltextes in Klasse III, Ordnung III b
s. Homeyer 1, S.':"7 und *23; Oppitz 1, S. 25 und 39. Hs. erwähnt bei Ernst Klebel (s. Cod. Pal.
germ. 139), S.264. Zu den Texten s. Ruth Schmidt-Wiegand, in: VL2 2 (1980), Sp. 400-409 (Eike
von Repgow, Sachsenspiegel) und Peter Johanek, in: VL2 8 (1992), Sp. 896-907 (Schwabenspie-
gel). Der zu Cod. Pal. germ. 167 gehörende zweite Band mit dem Text des Lehnrechts ist in Cod.
Pal. germ. 470 überliefert. - 2*v-4*v, 1\ 10vb, 158\ 159*r-160*v (bis auf Signaturen [4*r, 159*v],
s. Herkunft, und Schriftraumbegrenzung [158v]) leer.
KZ
COD. PAL. GERM. 168
Kaiserliche Dekrete • Goldene Bulle • Schwabenspiegel u. a.
Papier ■ 206 Bll. • 30,3 x 22 • Heidelberg • 1465-1467
Lagen: (I-l)1* + I3* + 16 VI190 (mit Bll. 4» 169a*) + IV198* + I1"1* + (I-l)200*. Regelmäßige Reklamanten, zum
Teil durch Beschnitt weggefallen. Blattsignaturen in der dritten Lage (1-6). Zwei Foliierungen: I. Textteil des
Schwabenspiegels; zeitgleich; rot; fehlerhaft; gleiche Hand gibt auch im Register die Seiten an: / [=67] -XV
[=81], XVII [=82]-CXXIX [=193]; II. 17.JL; fehlerhaft: 1-169, 168 [=169a*; 20.Jh.], 170-199 [=199a*;
20.Jh.]. Bll. l*-4*, 197*-199"', 200* mit moderner Zählung. Wz.: Ochsenkopf mit einkonturiger Stange mit
Kreuz (verschiedene Varianten), darunter ähnlich Piccard 2, Typ V/318 (Augsburg, Freiburg/Br. 1463-1469).
Schriftraum: I. lr-8r, llr: 21,5-22,5x13,5-14; 31-34 Zeilen; IL 9r-10v: 23-24x13-14,5; 33-39 Zeilen; III.
12r-193r: 21 x 12,5-13; 33-34 Zeilen; IV 194r-196v: 22,5-23 x 13-14; 45-50 Zeilen. Bastarda von sechs Hän-
den: I. lr-8r, 11r; IL 9r-10v; III. 12r-193r (Albertus Schwab); IV 193v (Erasmus Münch); V 194r-196v; VI. 199 a*v.
12r-193r Überschriften in Rot. lr-33r rot-tintenfarbene Cadellen, 35r-193r rote Lombarden über zwei bis vier
Zeilen. Übliche Rubrizierung. Falzstreifen aus Pergament (innere Falzverstärkung), unbeschrieben. An den al-
ten Vorsatzbll. leichter Wurmfraß. Pergamenteinband des 17. Jhs. (römisch), Rückentitel: 168/Ivra siue/Regis re-
forma (17. Jh.). Farbschnitt (gelb). Gelb-grünes Kapital. Rundes Signaturschild, modern: Pal. Germ. 168.
Herkunft: Hs. aus der kurfürstlichen Kanzlei in Heidelberg. Hauptschreiber (Hand III; vgl. Bl. 193r; Abb. 22)
und Buchbinder des ersten Einbandes ist Albertus Schwab, der am 23. Juni 1447 als Alberhtus Schwab de Lo-
femberg (Laufenburg am Oberrhein) in Heidelberg immatrikuliert wurde (Toepke 1, S. 254). Schwab ist von
1465-1482 als Buchbinder der Universität und des Hofes in Heidelberg belegt und war vermutlich auch als
Notar und Kanzleischreiber tätig. Zu Albertus Schwab vgl. Rudolf Sillib, Albertus Schwab. Schreiber und
Buchbinder in Heidelberg 1447-1465, in: Zeitschrift für Buchkunde 1 (1924), S.78f.; Adolf Schmidt, Albert
Hus und Hanns Oesterrich. Zwei Buchbinder des XV Jahrhunderts, in: Jahrbuch der Einbandkunst 1 (1927),
S. 36-38, Tafel 12; Heinrich Endres, Drei neue Einbände des Heidelberger Meisters Alberthus Schwab, in: Ar-
chiv für Buchbinderei 35 (1935), S. 9f., Abb. 14; Heinrich Schreiber, Meister Alberthus und seine Einbände, in:
Archiv für Buchbinderei 40 (1940), S.9-11, 25-29, Abb. 17; Peter Amelung, in: LGB2 1, S.52; Birgit Studt,
Fürstenhof und Geschichte. Legitimation durch Überlieferung, Köln [u.a.] 1992 (Norm und Struktur 2),
S. 145 f.; Backes, S. 64. Rockinger (S. 50), Homeyer (2, S. 122) und Oppitz (2, S.563) vermuten, daß die Hs.
1474 als Vorlage des einst im Frankfurter Karmeliterkloster befindlichen und heute vermißten Cod. Münzen-
bergianus (Homeyer 2, S.77 Nr.*f356; Oppitz 2, S.491 Nr. 502) diente. Vermutlich zeitweilig im Besitz des
Heidelberger Landschreibers Erasmus Münch (vgl. die Notizen 193v). 2*r Capsanummer: C. 2; Signatur: 378
388
Spiegel und Sachsenspiegel, Berlin 1863 (Rechtsdenkmäler des deutschen Mittelalters 3,1),
Sp.22-818, 863-866. Text des Schwabenspiegels: Eckhardt/Eckhardt, S. 150-328. Text des
Zusatzes unter anderem bei Spangenberg (s. Herkunft), S. 165. Zur Zuordnung des Sachsenspie-
geltextes in Klasse II, Ordnung IIc und des Schwabenspiegeltextes in Klasse III, Ordnung III b
s. Homeyer 1, S.':"7 und *23; Oppitz 1, S. 25 und 39. Hs. erwähnt bei Ernst Klebel (s. Cod. Pal.
germ. 139), S.264. Zu den Texten s. Ruth Schmidt-Wiegand, in: VL2 2 (1980), Sp. 400-409 (Eike
von Repgow, Sachsenspiegel) und Peter Johanek, in: VL2 8 (1992), Sp. 896-907 (Schwabenspie-
gel). Der zu Cod. Pal. germ. 167 gehörende zweite Band mit dem Text des Lehnrechts ist in Cod.
Pal. germ. 470 überliefert. - 2*v-4*v, 1\ 10vb, 158\ 159*r-160*v (bis auf Signaturen [4*r, 159*v],
s. Herkunft, und Schriftraumbegrenzung [158v]) leer.
KZ
COD. PAL. GERM. 168
Kaiserliche Dekrete • Goldene Bulle • Schwabenspiegel u. a.
Papier ■ 206 Bll. • 30,3 x 22 • Heidelberg • 1465-1467
Lagen: (I-l)1* + I3* + 16 VI190 (mit Bll. 4» 169a*) + IV198* + I1"1* + (I-l)200*. Regelmäßige Reklamanten, zum
Teil durch Beschnitt weggefallen. Blattsignaturen in der dritten Lage (1-6). Zwei Foliierungen: I. Textteil des
Schwabenspiegels; zeitgleich; rot; fehlerhaft; gleiche Hand gibt auch im Register die Seiten an: / [=67] -XV
[=81], XVII [=82]-CXXIX [=193]; II. 17.JL; fehlerhaft: 1-169, 168 [=169a*; 20.Jh.], 170-199 [=199a*;
20.Jh.]. Bll. l*-4*, 197*-199"', 200* mit moderner Zählung. Wz.: Ochsenkopf mit einkonturiger Stange mit
Kreuz (verschiedene Varianten), darunter ähnlich Piccard 2, Typ V/318 (Augsburg, Freiburg/Br. 1463-1469).
Schriftraum: I. lr-8r, llr: 21,5-22,5x13,5-14; 31-34 Zeilen; IL 9r-10v: 23-24x13-14,5; 33-39 Zeilen; III.
12r-193r: 21 x 12,5-13; 33-34 Zeilen; IV 194r-196v: 22,5-23 x 13-14; 45-50 Zeilen. Bastarda von sechs Hän-
den: I. lr-8r, 11r; IL 9r-10v; III. 12r-193r (Albertus Schwab); IV 193v (Erasmus Münch); V 194r-196v; VI. 199 a*v.
12r-193r Überschriften in Rot. lr-33r rot-tintenfarbene Cadellen, 35r-193r rote Lombarden über zwei bis vier
Zeilen. Übliche Rubrizierung. Falzstreifen aus Pergament (innere Falzverstärkung), unbeschrieben. An den al-
ten Vorsatzbll. leichter Wurmfraß. Pergamenteinband des 17. Jhs. (römisch), Rückentitel: 168/Ivra siue/Regis re-
forma (17. Jh.). Farbschnitt (gelb). Gelb-grünes Kapital. Rundes Signaturschild, modern: Pal. Germ. 168.
Herkunft: Hs. aus der kurfürstlichen Kanzlei in Heidelberg. Hauptschreiber (Hand III; vgl. Bl. 193r; Abb. 22)
und Buchbinder des ersten Einbandes ist Albertus Schwab, der am 23. Juni 1447 als Alberhtus Schwab de Lo-
femberg (Laufenburg am Oberrhein) in Heidelberg immatrikuliert wurde (Toepke 1, S. 254). Schwab ist von
1465-1482 als Buchbinder der Universität und des Hofes in Heidelberg belegt und war vermutlich auch als
Notar und Kanzleischreiber tätig. Zu Albertus Schwab vgl. Rudolf Sillib, Albertus Schwab. Schreiber und
Buchbinder in Heidelberg 1447-1465, in: Zeitschrift für Buchkunde 1 (1924), S.78f.; Adolf Schmidt, Albert
Hus und Hanns Oesterrich. Zwei Buchbinder des XV Jahrhunderts, in: Jahrbuch der Einbandkunst 1 (1927),
S. 36-38, Tafel 12; Heinrich Endres, Drei neue Einbände des Heidelberger Meisters Alberthus Schwab, in: Ar-
chiv für Buchbinderei 35 (1935), S. 9f., Abb. 14; Heinrich Schreiber, Meister Alberthus und seine Einbände, in:
Archiv für Buchbinderei 40 (1940), S.9-11, 25-29, Abb. 17; Peter Amelung, in: LGB2 1, S.52; Birgit Studt,
Fürstenhof und Geschichte. Legitimation durch Überlieferung, Köln [u.a.] 1992 (Norm und Struktur 2),
S. 145 f.; Backes, S. 64. Rockinger (S. 50), Homeyer (2, S. 122) und Oppitz (2, S.563) vermuten, daß die Hs.
1474 als Vorlage des einst im Frankfurter Karmeliterkloster befindlichen und heute vermißten Cod. Münzen-
bergianus (Homeyer 2, S.77 Nr.*f356; Oppitz 2, S.491 Nr. 502) diente. Vermutlich zeitweilig im Besitz des
Heidelberger Landschreibers Erasmus Münch (vgl. die Notizen 193v). 2*r Capsanummer: C. 2; Signatur: 378
388