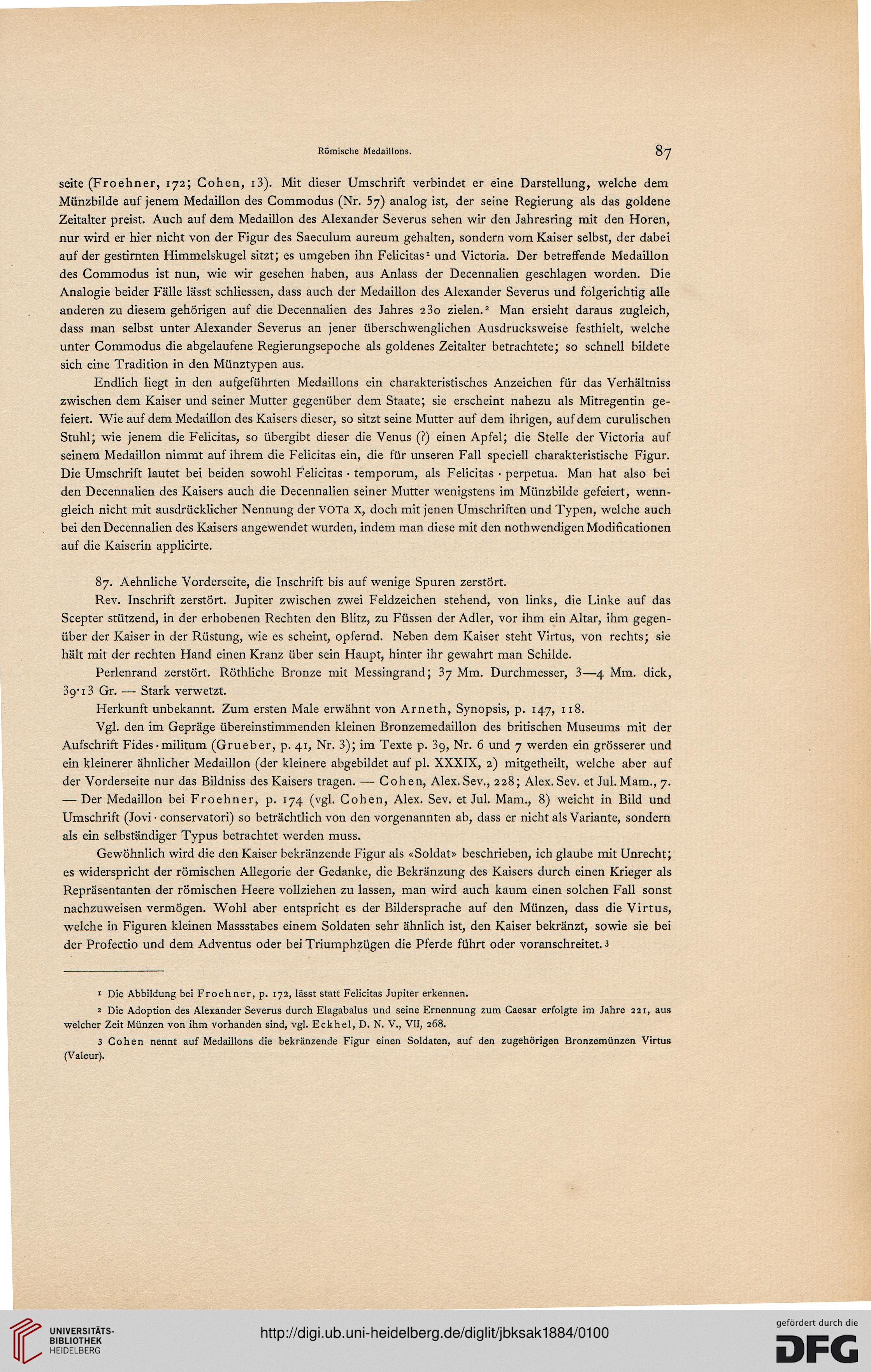Römische Medaillons.
8?
seite (Froehner, 172; Cohen, i3). Mit dieser Umschrift verbindet er eine Darstellung, welche dem
Münzbilde auf jenem Medaillon des Commodus (Nr. 5y) analog ist, der seine Regierung als das goldene
Zeitalter preist. Auch auf dem Medaillon des Alexander Severus sehen wir den Jahresring mit den Hören,
nur wird er hier nicht von der Figur des Saeculum aureum gehalten, sondern vom Kaiser selbst, der dabei
auf der gestirnten Himmelskugel sitzt; es umgeben ihn Felicitas1 und Victoria. Der betreffende Medaillon
des Commodus ist nun, wie wir gesehen haben, aus Anlass der Decennalien geschlagen worden. Die
Analogie beider Fälle lässt schliessen, dass auch der Medaillon des Alexander Severus und folgerichtig alle
anderen zu diesem gehörigen auf die Decennalien des Jahres 2 3o zielen.2 Man ersieht daraus zugleich,
dass man selbst unter Alexander Severus an jener überschwenglichen Ausdrucksweise festhielt, welche
unter Commodus die abgelaufene Regierungsepoche als goldenes Zeitalter betrachtete; so schnell bildete
sich eine Tradition in den Münztypen aus.
Endlich liegt in den aufgeführten Medaillons ein charakteristisches Anzeichen für das Verhältniss
zwischen dem Kaiser und seiner Mutter gegenüber dem Staate; sie erscheint nahezu als Mitregentin ge-
feiert. Wie auf dem Medaillon des Kaisers dieser, so sitzt seine Mutter auf dem ihrigen, auf dem curulischen
Stuhl; wie jenem die Felicitas, so übergibt dieser die Venus (?) einen Apfel; die Stelle der Victoria auf
seinem Medaillon nimmt auf ihrem die Felicitas ein, die für unseren Fall speciell charakteristische Figur.
Die Umschrift lautet bei beiden sowohl Felicitas • temporum, als Felicitas • perpetua. Man hat also bei
den Decennalien des Kaisers auch die Decennalien seiner Mutter wenigstens im Münzbilde gefeiert, wenn-
gleich nicht mit ausdrücklicher Nennung der VOTa X, doch mit jenen Umschriften und Typen, welche auch
bei den Decennalien des Kaisers angewendet wurden, indem man diese mit den nothwendigen Modificationen
auf die Kaiserin applicirte.
87. Aehnliche Vorderseite, die Inschrift bis auf wenige Spuren zerstört.
Rev. Inschrift zerstört. Jupiter zwischen zwei Feldzeichen stehend, von links, die Linke auf das
Scepter stützend, in der erhobenen Rechten den Blitz, zu Füssen der Adler, vor ihm ein Altar, ihm gegen-
über der Kaiser in der Rüstung, wie es scheint, opfernd. Neben dem Kaiser steht Virtus, von rechts; sie
hält mit der rechten Hand einen Kranz über sein Haupt, hinter ihr gewahrt man Schilde.
Perlenrand zerstört. Röthliche Bronze mit Messingrand; 3y Mm. Durchmesser, 3—4 Mm. dick,
39*13 Gr. ■— Stark verwetzt.
Herkunft unbekannt. Zum ersten Male erwähnt von Arneth, Synopsis, p. 147, 118.
Vgl. den im Gepräge übereinstimmenden kleinen Bronzemedaillon des britischen Museums mit der
Aufschrift Fides • militum (Grueber, p. 41, Nr. 3); im Texte p. 39, Nr. 6 und 7 werden ein grösserer und
ein kleinerer ähnlicher Medaillon (der kleinere abgebildet auf pl. XXXIX, 2) mitgetheilt, welche aber auf
der Vorderseite nur das Bildniss des Kaisers tragen. — Cohen, Alex. Sev., 228; Alex. Sev. et Jul. Mam., 7.
— Der Medaillon bei Froehner, p. 174 (vgl. Cohen, Alex. Sev. et Jul. Mam., 8) weicht in Bild und
Umschrift (Jovi • conservatori) so beträchtlich von den vorgenannten ab, dass er nicht als Variante, sondern
als ein selbständiger Typus betrachtet werden muss.
Gewöhnlich wird die den Kaiser bekränzende Figur als «Soldat» beschrieben, ich glaube mit Unrecht;
es widerspricht der römischen Allegorie der Gedanke, die Bekränzung des Kaisers durch einen Krieger als
Repräsentanten der römischen Heere vollziehen zu lassen, man wird auch kaum einen solchen Fall sonst
nachzuweisen vermögen. Wohl aber entspricht es der Bildersprache auf den Münzen, dass die Virtus,
welche in Figuren kleinen Massstabes einem Soldaten sehr ähnlich ist, den Kaiser bekränzt, sowie sie bei
der Profectio und dem Adventus oder bei Triumphzügen die Pferde führt oder voranschreitet. 3
1 Die Abbildung bei Froehner, p. 172, lässt statt Felicitas Jupiter erkennen.
2 Die Adoption des Alexander Severus durch Elagabalus und seine Ernennung zum Caesar erfolgte im Jahre 221, aus
welcher Zeit Münzen von ihm vorhanden sind, vgl. Eckhel, D. N. V., VII, 268.
3 Cohen nennt auf Medaillons die bekränzende Figur einen Soldaten, auf den zugehörigen Bronzemünzen Virtus
(Valeur).
8?
seite (Froehner, 172; Cohen, i3). Mit dieser Umschrift verbindet er eine Darstellung, welche dem
Münzbilde auf jenem Medaillon des Commodus (Nr. 5y) analog ist, der seine Regierung als das goldene
Zeitalter preist. Auch auf dem Medaillon des Alexander Severus sehen wir den Jahresring mit den Hören,
nur wird er hier nicht von der Figur des Saeculum aureum gehalten, sondern vom Kaiser selbst, der dabei
auf der gestirnten Himmelskugel sitzt; es umgeben ihn Felicitas1 und Victoria. Der betreffende Medaillon
des Commodus ist nun, wie wir gesehen haben, aus Anlass der Decennalien geschlagen worden. Die
Analogie beider Fälle lässt schliessen, dass auch der Medaillon des Alexander Severus und folgerichtig alle
anderen zu diesem gehörigen auf die Decennalien des Jahres 2 3o zielen.2 Man ersieht daraus zugleich,
dass man selbst unter Alexander Severus an jener überschwenglichen Ausdrucksweise festhielt, welche
unter Commodus die abgelaufene Regierungsepoche als goldenes Zeitalter betrachtete; so schnell bildete
sich eine Tradition in den Münztypen aus.
Endlich liegt in den aufgeführten Medaillons ein charakteristisches Anzeichen für das Verhältniss
zwischen dem Kaiser und seiner Mutter gegenüber dem Staate; sie erscheint nahezu als Mitregentin ge-
feiert. Wie auf dem Medaillon des Kaisers dieser, so sitzt seine Mutter auf dem ihrigen, auf dem curulischen
Stuhl; wie jenem die Felicitas, so übergibt dieser die Venus (?) einen Apfel; die Stelle der Victoria auf
seinem Medaillon nimmt auf ihrem die Felicitas ein, die für unseren Fall speciell charakteristische Figur.
Die Umschrift lautet bei beiden sowohl Felicitas • temporum, als Felicitas • perpetua. Man hat also bei
den Decennalien des Kaisers auch die Decennalien seiner Mutter wenigstens im Münzbilde gefeiert, wenn-
gleich nicht mit ausdrücklicher Nennung der VOTa X, doch mit jenen Umschriften und Typen, welche auch
bei den Decennalien des Kaisers angewendet wurden, indem man diese mit den nothwendigen Modificationen
auf die Kaiserin applicirte.
87. Aehnliche Vorderseite, die Inschrift bis auf wenige Spuren zerstört.
Rev. Inschrift zerstört. Jupiter zwischen zwei Feldzeichen stehend, von links, die Linke auf das
Scepter stützend, in der erhobenen Rechten den Blitz, zu Füssen der Adler, vor ihm ein Altar, ihm gegen-
über der Kaiser in der Rüstung, wie es scheint, opfernd. Neben dem Kaiser steht Virtus, von rechts; sie
hält mit der rechten Hand einen Kranz über sein Haupt, hinter ihr gewahrt man Schilde.
Perlenrand zerstört. Röthliche Bronze mit Messingrand; 3y Mm. Durchmesser, 3—4 Mm. dick,
39*13 Gr. ■— Stark verwetzt.
Herkunft unbekannt. Zum ersten Male erwähnt von Arneth, Synopsis, p. 147, 118.
Vgl. den im Gepräge übereinstimmenden kleinen Bronzemedaillon des britischen Museums mit der
Aufschrift Fides • militum (Grueber, p. 41, Nr. 3); im Texte p. 39, Nr. 6 und 7 werden ein grösserer und
ein kleinerer ähnlicher Medaillon (der kleinere abgebildet auf pl. XXXIX, 2) mitgetheilt, welche aber auf
der Vorderseite nur das Bildniss des Kaisers tragen. — Cohen, Alex. Sev., 228; Alex. Sev. et Jul. Mam., 7.
— Der Medaillon bei Froehner, p. 174 (vgl. Cohen, Alex. Sev. et Jul. Mam., 8) weicht in Bild und
Umschrift (Jovi • conservatori) so beträchtlich von den vorgenannten ab, dass er nicht als Variante, sondern
als ein selbständiger Typus betrachtet werden muss.
Gewöhnlich wird die den Kaiser bekränzende Figur als «Soldat» beschrieben, ich glaube mit Unrecht;
es widerspricht der römischen Allegorie der Gedanke, die Bekränzung des Kaisers durch einen Krieger als
Repräsentanten der römischen Heere vollziehen zu lassen, man wird auch kaum einen solchen Fall sonst
nachzuweisen vermögen. Wohl aber entspricht es der Bildersprache auf den Münzen, dass die Virtus,
welche in Figuren kleinen Massstabes einem Soldaten sehr ähnlich ist, den Kaiser bekränzt, sowie sie bei
der Profectio und dem Adventus oder bei Triumphzügen die Pferde führt oder voranschreitet. 3
1 Die Abbildung bei Froehner, p. 172, lässt statt Felicitas Jupiter erkennen.
2 Die Adoption des Alexander Severus durch Elagabalus und seine Ernennung zum Caesar erfolgte im Jahre 221, aus
welcher Zeit Münzen von ihm vorhanden sind, vgl. Eckhel, D. N. V., VII, 268.
3 Cohen nennt auf Medaillons die bekränzende Figur einen Soldaten, auf den zugehörigen Bronzemünzen Virtus
(Valeur).