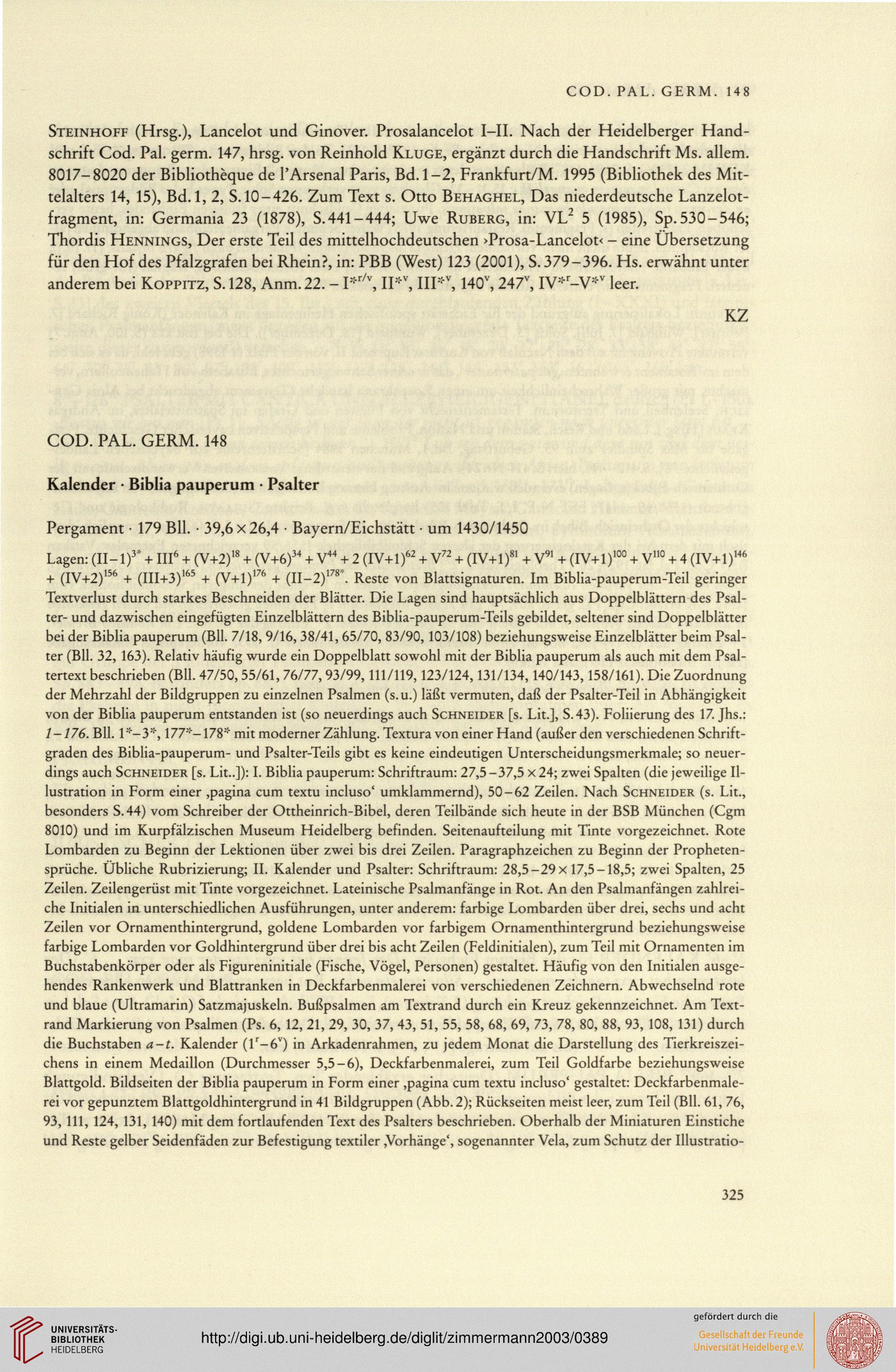COD. PAL. GERM. 148
Steinhoff (Hrsg.), Lancelot und Ginover. Prosalancelot I—II. Nach der Heidelberger Hand-
schrift Cod. Pal. germ. 147, hrsg. von Reinhold Kluge, ergänzt durch die Handschrift Ms. allem.
8017-8020 der Bibliotheque de l'Arsenal Paris, Bd. 1-2, Frankfurt/M. 1995 (Bibliothek des Mit-
telalters 14, 15), Bd. 1, 2, S. 10-426. Zum Text s. Otto Behaghel, Das niederdeutsche Lanzelot-
fragment, in: Germania 23 (1878), S.441-444; Uwe Ruberg, in: VL2 5 (1985), Sp.530-546;
Thordis Hennings, Der erste Teil des mittelhochdeutschen >Prosa-Lancelot< - eine Übersetzung
für den Hof des Pfalzgrafen bei Rhein?, in: PBB (West) 123 (2001), S. 379-396. Hs. erwähnt unter
anderem bei Koppitz, S. 128, Anm.22. - I*r/v, IPV, III"V, 140v, 247v, IV*r-V*v leer.
KZ
COD. PAL. GERM. 148
Kalender • Biblia pauperum ■ Psalter
Pergament • 179 Bll. • 39,6 x 26,4 • Bayern/Eichstätt • um 1430/1450
Lagen: (II-l)3* + III6 + (V+2)18 + (V+6)34 + V44 + 2 (IV+1)62 + V72 + (IV+1)81 + V91 + (IV+1)100 + V110 + 4 (IV+1)146
+ (IV+2)156 + (III+3)165 + (V+l)176 + (II-2)178\ Reste von Blattsignaturen. Im Biblia-pauperum-Teil geringer
Textverlust durch starkes Beschneiden der Blätter. Die Lagen sind hauptsächlich aus Doppelblättern des Psal-
ter- und dazwischen eingefügten Einzelblättern des Biblia-pauperum-Teils gebildet, seltener sind Doppelblätter
bei der Biblia pauperum (Bll. 7/18, 9/16, 38/41,65/70, 83/90,103/108) beziehungsweise Einzelblätter beim Psal-
ter (Bll. 32, 163). Relativ häufig wurde ein Doppelblatt sowohl mit der Biblia pauperum als auch mit dem Psal-
tertext beschrieben (Bll. 47/50,55/61,76/77,93/99,111/119,123/124,131/134,140/143,158/161). Die Zuordnung
der Mehrzahl der Bildgruppen zu einzelnen Psalmen (s.u.) läßt vermuten, daß der Psalter-Teil in Abhängigkeit
von der Biblia pauperum entstanden ist (so neuerdings auch Schneider [s. Lit.], S.43). Foliierung des 17. Jhs.:
1-176. Bll. I*—3*, 177*-178* mit moderner Zählung. Textura von einer Hand (außer den verschiedenen Schrift-
graden des Biblia-pauperum- und Psalter-Teils gibt es keine eindeutigen Unterscheidungsmerkmale; so neuer-
dings auch Schneider [s. Lit..]): I. Biblia pauperum: Schriftraum: 27,5-37,5 x 24; zwei Spalten (die jeweilige Il-
lustration in Form einer ,pagina cum textu incluso' umklammernd), 50-62 Zeilen. Nach Schneider (s. Lit.,
besonders S.44) vom Schreiber der Ottheinrich-Bibel, deren Teilbände sich heute in der BSB München (Cgm
8010) und im Kurpfälzischen Museum Heidelberg befinden. Seitenaufteilung mit Tinte vorgezeichnet. Rote
Lombarden zu Beginn der Lektionen über zwei bis drei Zeilen. Paragraphzeichen zu Beginn der Propheten-
sprüche. Übliche Rubrizierung; II. Kalender und Psalter: Schriftraum: 28,5-29x17,5-18,5; zwei Spalten, 25
Zeilen. Zeilengerüst mit Tinte vorgezeichnet. Lateinische Psalmanfänge in Rot. An den Psalmanfängen zahlrei-
che Initialen in unterschiedlichen Ausführungen, unter anderem: farbige Lombarden über drei, sechs und acht
Zeilen vor Ornamenthintergrund, goldene Lombarden vor farbigem Ornamenthintergrund beziehungsweise
farbige Lombarden vor Goldhintergrund über drei bis acht Zeilen (Feldinitialen), zum Teil mit Ornamenten im
Buchstabenkörper oder als Figureninitiale (Fische, Vögel, Personen) gestaltet. Häufig von den Initialen ausge-
hendes Rankenwerk und Blattranken in Deckfarbenmalerei von verschiedenen Zeichnern. Abwechselnd rote
und blaue (Ultramarin) Satzmajuskeln. Bußpsalmen am Textrand durch ein Kreuz gekennzeichnet. Am Text-
rand Markierung von Psalmen (Ps. 6, 12, 21, 29, 30, 37, 43, 51, 55, 58, 68, 69, 73, 78, 80, 88, 93, 108, 131) durch
die Buchstaben a-t. Kalender (lr-6v) in Arkadenrahmen, zu jedem Monat die Darstellung des Tierkreiszei-
chens in einem Medaillon (Durchmesser 5,5-6), Deckfarbenmalerei, zum Teil Goldfarbe beziehungsweise
Blattgold. Bildseiten der Biblia pauperum in Form einer ,pagina cum textu incluso' gestaltet: Deckfarbenmale-
rei vor gepunztem Blattgoldhintergrund in 41 Bildgruppen (Abb. 2); Rückseiten meist leer, zum Teil (Bll. 61, 76,
93, 111, 124, 131, 140) mit dem fortlaufenden Text des Psalters beschrieben. Oberhalb der Miniaturen Einstiche
und Reste gelber Seidenfäden zur Befestigung textiler .Vorhänge', sogenannter Vela, zum Schutz der Illustratio-
325
Steinhoff (Hrsg.), Lancelot und Ginover. Prosalancelot I—II. Nach der Heidelberger Hand-
schrift Cod. Pal. germ. 147, hrsg. von Reinhold Kluge, ergänzt durch die Handschrift Ms. allem.
8017-8020 der Bibliotheque de l'Arsenal Paris, Bd. 1-2, Frankfurt/M. 1995 (Bibliothek des Mit-
telalters 14, 15), Bd. 1, 2, S. 10-426. Zum Text s. Otto Behaghel, Das niederdeutsche Lanzelot-
fragment, in: Germania 23 (1878), S.441-444; Uwe Ruberg, in: VL2 5 (1985), Sp.530-546;
Thordis Hennings, Der erste Teil des mittelhochdeutschen >Prosa-Lancelot< - eine Übersetzung
für den Hof des Pfalzgrafen bei Rhein?, in: PBB (West) 123 (2001), S. 379-396. Hs. erwähnt unter
anderem bei Koppitz, S. 128, Anm.22. - I*r/v, IPV, III"V, 140v, 247v, IV*r-V*v leer.
KZ
COD. PAL. GERM. 148
Kalender • Biblia pauperum ■ Psalter
Pergament • 179 Bll. • 39,6 x 26,4 • Bayern/Eichstätt • um 1430/1450
Lagen: (II-l)3* + III6 + (V+2)18 + (V+6)34 + V44 + 2 (IV+1)62 + V72 + (IV+1)81 + V91 + (IV+1)100 + V110 + 4 (IV+1)146
+ (IV+2)156 + (III+3)165 + (V+l)176 + (II-2)178\ Reste von Blattsignaturen. Im Biblia-pauperum-Teil geringer
Textverlust durch starkes Beschneiden der Blätter. Die Lagen sind hauptsächlich aus Doppelblättern des Psal-
ter- und dazwischen eingefügten Einzelblättern des Biblia-pauperum-Teils gebildet, seltener sind Doppelblätter
bei der Biblia pauperum (Bll. 7/18, 9/16, 38/41,65/70, 83/90,103/108) beziehungsweise Einzelblätter beim Psal-
ter (Bll. 32, 163). Relativ häufig wurde ein Doppelblatt sowohl mit der Biblia pauperum als auch mit dem Psal-
tertext beschrieben (Bll. 47/50,55/61,76/77,93/99,111/119,123/124,131/134,140/143,158/161). Die Zuordnung
der Mehrzahl der Bildgruppen zu einzelnen Psalmen (s.u.) läßt vermuten, daß der Psalter-Teil in Abhängigkeit
von der Biblia pauperum entstanden ist (so neuerdings auch Schneider [s. Lit.], S.43). Foliierung des 17. Jhs.:
1-176. Bll. I*—3*, 177*-178* mit moderner Zählung. Textura von einer Hand (außer den verschiedenen Schrift-
graden des Biblia-pauperum- und Psalter-Teils gibt es keine eindeutigen Unterscheidungsmerkmale; so neuer-
dings auch Schneider [s. Lit..]): I. Biblia pauperum: Schriftraum: 27,5-37,5 x 24; zwei Spalten (die jeweilige Il-
lustration in Form einer ,pagina cum textu incluso' umklammernd), 50-62 Zeilen. Nach Schneider (s. Lit.,
besonders S.44) vom Schreiber der Ottheinrich-Bibel, deren Teilbände sich heute in der BSB München (Cgm
8010) und im Kurpfälzischen Museum Heidelberg befinden. Seitenaufteilung mit Tinte vorgezeichnet. Rote
Lombarden zu Beginn der Lektionen über zwei bis drei Zeilen. Paragraphzeichen zu Beginn der Propheten-
sprüche. Übliche Rubrizierung; II. Kalender und Psalter: Schriftraum: 28,5-29x17,5-18,5; zwei Spalten, 25
Zeilen. Zeilengerüst mit Tinte vorgezeichnet. Lateinische Psalmanfänge in Rot. An den Psalmanfängen zahlrei-
che Initialen in unterschiedlichen Ausführungen, unter anderem: farbige Lombarden über drei, sechs und acht
Zeilen vor Ornamenthintergrund, goldene Lombarden vor farbigem Ornamenthintergrund beziehungsweise
farbige Lombarden vor Goldhintergrund über drei bis acht Zeilen (Feldinitialen), zum Teil mit Ornamenten im
Buchstabenkörper oder als Figureninitiale (Fische, Vögel, Personen) gestaltet. Häufig von den Initialen ausge-
hendes Rankenwerk und Blattranken in Deckfarbenmalerei von verschiedenen Zeichnern. Abwechselnd rote
und blaue (Ultramarin) Satzmajuskeln. Bußpsalmen am Textrand durch ein Kreuz gekennzeichnet. Am Text-
rand Markierung von Psalmen (Ps. 6, 12, 21, 29, 30, 37, 43, 51, 55, 58, 68, 69, 73, 78, 80, 88, 93, 108, 131) durch
die Buchstaben a-t. Kalender (lr-6v) in Arkadenrahmen, zu jedem Monat die Darstellung des Tierkreiszei-
chens in einem Medaillon (Durchmesser 5,5-6), Deckfarbenmalerei, zum Teil Goldfarbe beziehungsweise
Blattgold. Bildseiten der Biblia pauperum in Form einer ,pagina cum textu incluso' gestaltet: Deckfarbenmale-
rei vor gepunztem Blattgoldhintergrund in 41 Bildgruppen (Abb. 2); Rückseiten meist leer, zum Teil (Bll. 61, 76,
93, 111, 124, 131, 140) mit dem fortlaufenden Text des Psalters beschrieben. Oberhalb der Miniaturen Einstiche
und Reste gelber Seidenfäden zur Befestigung textiler .Vorhänge', sogenannter Vela, zum Schutz der Illustratio-
325