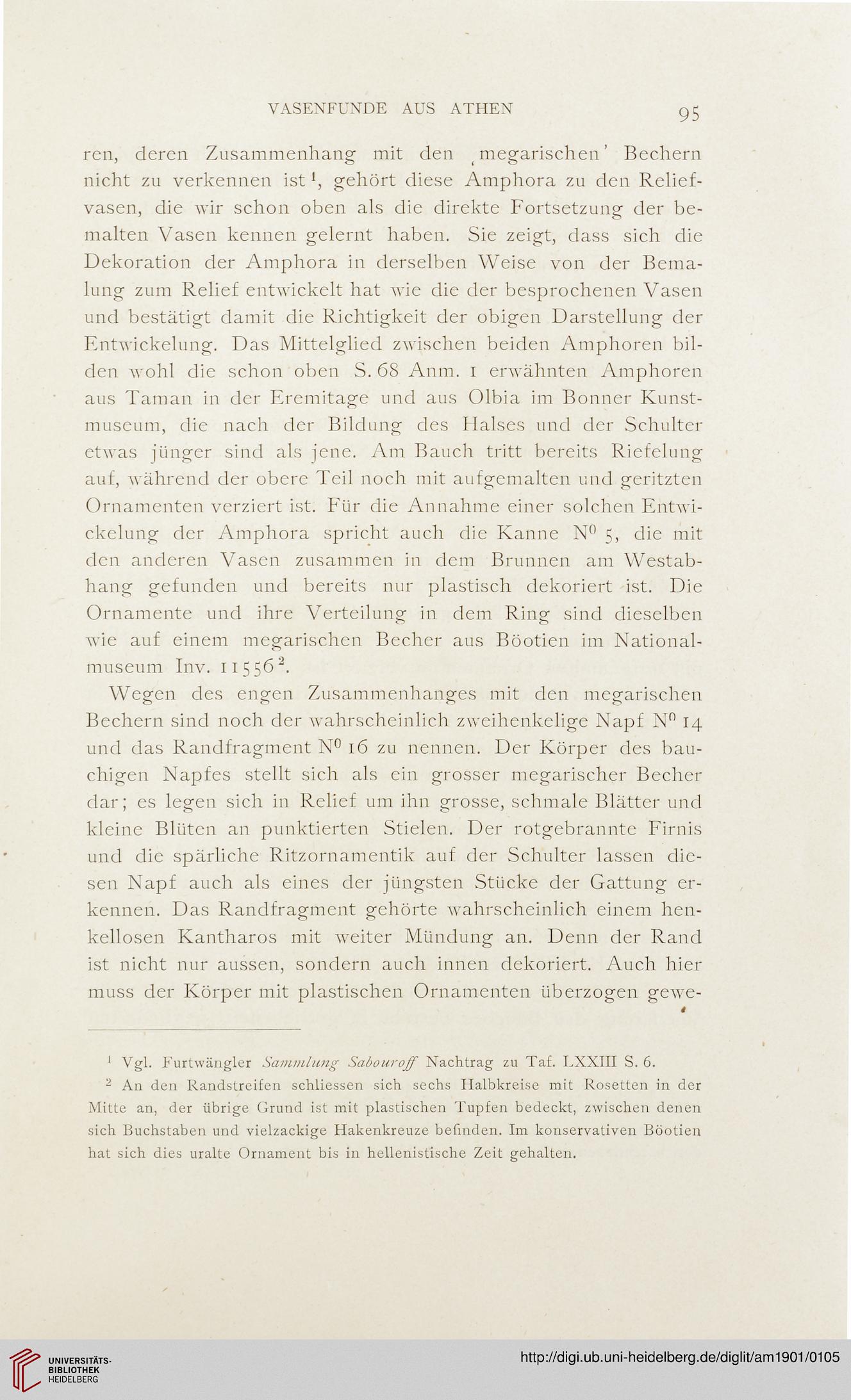VASENFUNDE AUS ATHEN
95
ren, deren Zusammenhang mit den megarischen’ Bechern
nicht zu verkennen istl, gehört diese Amphora zu den Relief-
vasen, die wir schon oben als die direkte Fortsetzung der be-
malten Vasen kennen gelernt haben. Sie zeigt, dass sich die
Dekoration der Amphora in derselben Weise von der Bema-
lung zum Relief entwickelt hat wie die der besprochenen Vasen
und bestätigt damit die Richtigkeit der obigen Darstellung der
Entwickelung. Das Mittelglied zwischen beiden Amphoren bil-
den wohl die schon oben S. 68 Anm. I erwähnten Amphoren
aus Taman in der Eremitage und aus Olbia im Bonner Kunst-
museum, die nach der Bildung des Halses und der Schulter
etwas jünger sind als jene. Am Bauch tritt bereits Riefelung
auf, während der obere Teil noch mit aufgemalten und geritzten
Ornamenten verziert ist. Für die Annahme einer solchen Entwi-
ckelung der Amphora spricht auch die Kanne N° 5, die mit
den anderen Vasen zusammen in dem Brunnen am Westab-
hang gefunden und bereits nur plastisch dekoriert ist. Die
Ornamente und ihre Verteilung in dem Ring sind dieselben
wie auf einem megarischen Becher aus Böotien im National-
museum Inv. 11 5 56 2.
Wegen des engen Zusammenhanges mit den megarischen
Bechern sind noch der wahrscheinlich zweihenkelige Napf Nn 14
und das Randfragment N° 16 zu nennen. Der Körper des bau-
chigen Napfes stellt sich als ein grosser megarischer Becher
dar; es legen sich in Relief um ihn grosse, schmale Blätter und
kleine Blüten an punktierten Stielen. Der rotgebrannte Firnis
und die spärliche Ritzornamentik auf der Schulter lassen die-
sen Napf auch als eines der jüngsten Stücke der Gattung er-
kennen. Das Randfragment gehörte wahrscheinlich einem hen-
kellosen Kantharos mit weiter Mündung an. Denn der Rand
ist nicht nur aussen, sondern auch innen dekoriert. Auch hier
muss der Körper mit plastischen Ornamenten überzogen gewe-
1 Vgl. Furtwängler Sa?nmlung Sabouroff Nachtrag zu Taf. LXXIII S. 6.
2 An den Randstreifen schliessen sich sechs Halbkreise mit Rosetten in der
Mitte an, der übrige Grund ist mit plastischen Tupfen bedeckt, zwischen denen
sich Buchstaben und vielzackige Hakenkreuze befinden. Im konservativen Böotien
hat sich dies uralte Ornament bis in hellenistische Zeit gehalten.
95
ren, deren Zusammenhang mit den megarischen’ Bechern
nicht zu verkennen istl, gehört diese Amphora zu den Relief-
vasen, die wir schon oben als die direkte Fortsetzung der be-
malten Vasen kennen gelernt haben. Sie zeigt, dass sich die
Dekoration der Amphora in derselben Weise von der Bema-
lung zum Relief entwickelt hat wie die der besprochenen Vasen
und bestätigt damit die Richtigkeit der obigen Darstellung der
Entwickelung. Das Mittelglied zwischen beiden Amphoren bil-
den wohl die schon oben S. 68 Anm. I erwähnten Amphoren
aus Taman in der Eremitage und aus Olbia im Bonner Kunst-
museum, die nach der Bildung des Halses und der Schulter
etwas jünger sind als jene. Am Bauch tritt bereits Riefelung
auf, während der obere Teil noch mit aufgemalten und geritzten
Ornamenten verziert ist. Für die Annahme einer solchen Entwi-
ckelung der Amphora spricht auch die Kanne N° 5, die mit
den anderen Vasen zusammen in dem Brunnen am Westab-
hang gefunden und bereits nur plastisch dekoriert ist. Die
Ornamente und ihre Verteilung in dem Ring sind dieselben
wie auf einem megarischen Becher aus Böotien im National-
museum Inv. 11 5 56 2.
Wegen des engen Zusammenhanges mit den megarischen
Bechern sind noch der wahrscheinlich zweihenkelige Napf Nn 14
und das Randfragment N° 16 zu nennen. Der Körper des bau-
chigen Napfes stellt sich als ein grosser megarischer Becher
dar; es legen sich in Relief um ihn grosse, schmale Blätter und
kleine Blüten an punktierten Stielen. Der rotgebrannte Firnis
und die spärliche Ritzornamentik auf der Schulter lassen die-
sen Napf auch als eines der jüngsten Stücke der Gattung er-
kennen. Das Randfragment gehörte wahrscheinlich einem hen-
kellosen Kantharos mit weiter Mündung an. Denn der Rand
ist nicht nur aussen, sondern auch innen dekoriert. Auch hier
muss der Körper mit plastischen Ornamenten überzogen gewe-
1 Vgl. Furtwängler Sa?nmlung Sabouroff Nachtrag zu Taf. LXXIII S. 6.
2 An den Randstreifen schliessen sich sechs Halbkreise mit Rosetten in der
Mitte an, der übrige Grund ist mit plastischen Tupfen bedeckt, zwischen denen
sich Buchstaben und vielzackige Hakenkreuze befinden. Im konservativen Böotien
hat sich dies uralte Ornament bis in hellenistische Zeit gehalten.