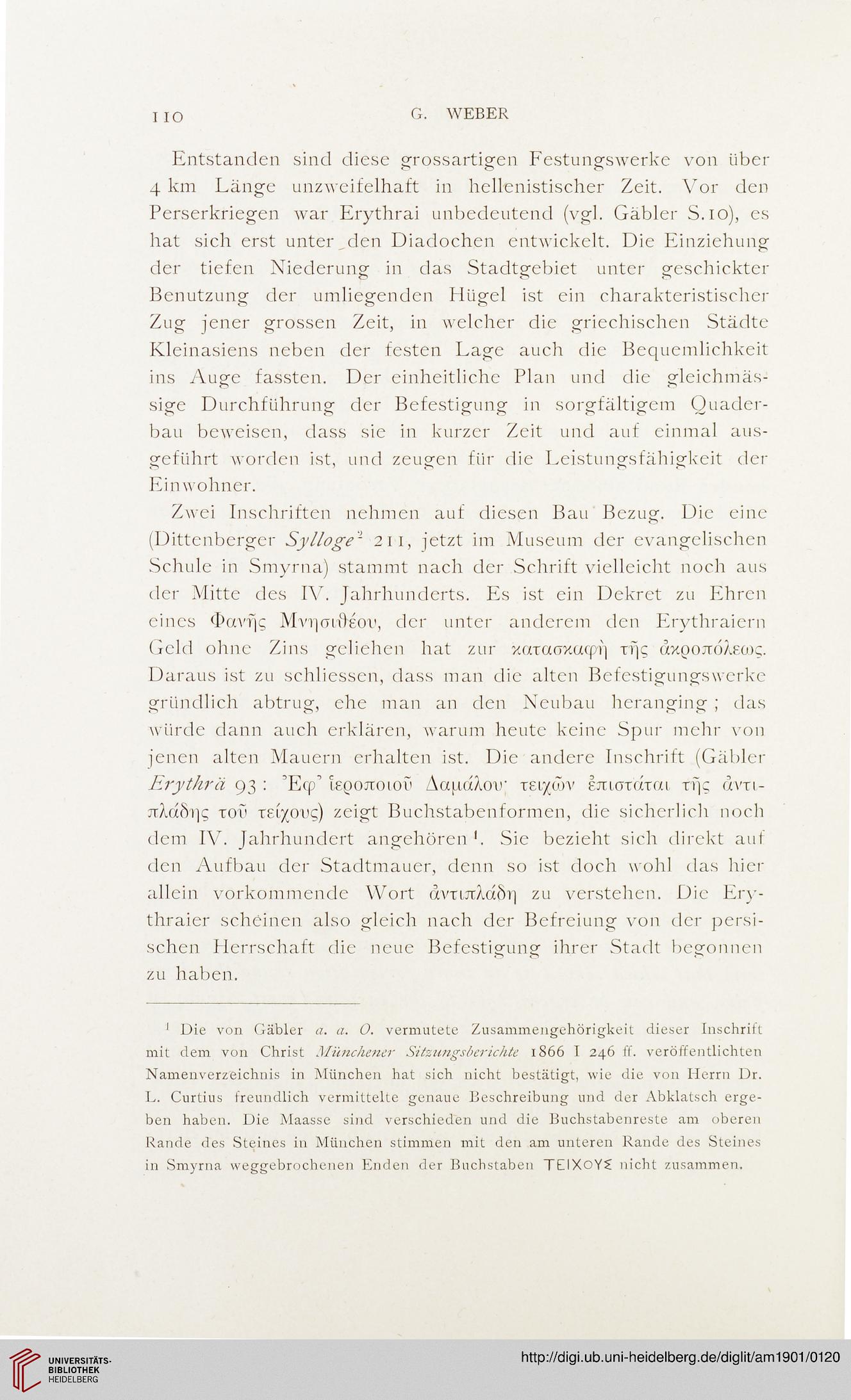I IO
G. WEBER
Entstanden sind diese grossartigen Festungswerke von über
4 km Länge unzweifelhaft in hellenistischer Zeit. Vor den
Perserkriegen war Erythrai unbedeutend (vgl. Gäbler S.io), es
hat sich erst unter , den Diaclochen entwickelt. Die Einziehung
der tiefen Niederung in das Stadtgebiet unter geschickter
Benutzung der umliegenden Idügel ist ein charakteristischer
Zug jener grossen Zeit, in welcher die griechischen Städte
Kleinasiens neben der festen Lage auch die Bequemlichkeit
ins Auge fassten. Der einheitliche Plan und die gleichmäs-
sige Durchführung der Befestigung in sorgfältigem Ouader-
bau beweisen, dass sie in kurzer Zeit und auf einmal aus-
geführt worden ist, und zeugen für die Leistungsfähigkeit der
Einwohner.
Zwei Inschriften nehmen auf diesen Bau Bezug. Die eine
(Dittenberger Sylloge'1 211, jetzt im Museum der evangelischen
Schule in Smyrna) stammt nach der Schrift vielleicht noch aus
der Mitte des IV. Jahrhunderts. Es ist ein Dekret zu Ehren
eines Φανής ΜνησιΦέου, der unter anderem den Erythraiern
Geld ohne Zins geliehen hat zur κατασκαφή τής ακροπόλεως.
Daraus ist zu schliessen, dass man die alten Befestigungswerke
gründlich abtrug, ehe man an den Neubau heranging ; das
würde dann auch erklären, warum heute keine Spur mehr von
jenen alten Mauern erhalten ist. Die andere Inschrift (Gäbler
Erythrä 93 : Έφ’ ΐεροποιοΰ Δαμάλου; τειχών έπιστάται τής άντι-
πλάδης του τείχους) zeigt Buchstabenformen, die sicherlich noch
dem IV. Jahrhundert angehören *. Sie bezieht sich direkt auf
den Aufbau der Stadtmauer, denn so ist doch wohl das hier
allein vorkommende Wort άντιπλάδη zu verstehen. Die Ery-
thraier scheinen also gleich nach der Befreiung von der persi-
schen Herrschaft die neue Befestigung ihrer Stadt begonnen
zu haben.
1 Die von Gäbler a. a. O. vermutete Zusammengehörigkeit dieser Inschrift
mit dem von Christ Münchener Sitzungsberichte 1866 I 246 ff. veröffentlichten
Namenverzeichnis in München hat sich nicht bestätigt, wie die von Herrn Dr.
L. Curtius freundlich vermittelte genaue Beschreibung und der Abklatsch erge-
ben haben. Die Maasse sind verschieden und die Buchstabenreste am oberen
Rande des Steines in München stimmen mit den am unteren Rande des Steines
in Smyrna weggebrochenen Enden der Buchstaben TEIXoYS nicht zusammen.
G. WEBER
Entstanden sind diese grossartigen Festungswerke von über
4 km Länge unzweifelhaft in hellenistischer Zeit. Vor den
Perserkriegen war Erythrai unbedeutend (vgl. Gäbler S.io), es
hat sich erst unter , den Diaclochen entwickelt. Die Einziehung
der tiefen Niederung in das Stadtgebiet unter geschickter
Benutzung der umliegenden Idügel ist ein charakteristischer
Zug jener grossen Zeit, in welcher die griechischen Städte
Kleinasiens neben der festen Lage auch die Bequemlichkeit
ins Auge fassten. Der einheitliche Plan und die gleichmäs-
sige Durchführung der Befestigung in sorgfältigem Ouader-
bau beweisen, dass sie in kurzer Zeit und auf einmal aus-
geführt worden ist, und zeugen für die Leistungsfähigkeit der
Einwohner.
Zwei Inschriften nehmen auf diesen Bau Bezug. Die eine
(Dittenberger Sylloge'1 211, jetzt im Museum der evangelischen
Schule in Smyrna) stammt nach der Schrift vielleicht noch aus
der Mitte des IV. Jahrhunderts. Es ist ein Dekret zu Ehren
eines Φανής ΜνησιΦέου, der unter anderem den Erythraiern
Geld ohne Zins geliehen hat zur κατασκαφή τής ακροπόλεως.
Daraus ist zu schliessen, dass man die alten Befestigungswerke
gründlich abtrug, ehe man an den Neubau heranging ; das
würde dann auch erklären, warum heute keine Spur mehr von
jenen alten Mauern erhalten ist. Die andere Inschrift (Gäbler
Erythrä 93 : Έφ’ ΐεροποιοΰ Δαμάλου; τειχών έπιστάται τής άντι-
πλάδης του τείχους) zeigt Buchstabenformen, die sicherlich noch
dem IV. Jahrhundert angehören *. Sie bezieht sich direkt auf
den Aufbau der Stadtmauer, denn so ist doch wohl das hier
allein vorkommende Wort άντιπλάδη zu verstehen. Die Ery-
thraier scheinen also gleich nach der Befreiung von der persi-
schen Herrschaft die neue Befestigung ihrer Stadt begonnen
zu haben.
1 Die von Gäbler a. a. O. vermutete Zusammengehörigkeit dieser Inschrift
mit dem von Christ Münchener Sitzungsberichte 1866 I 246 ff. veröffentlichten
Namenverzeichnis in München hat sich nicht bestätigt, wie die von Herrn Dr.
L. Curtius freundlich vermittelte genaue Beschreibung und der Abklatsch erge-
ben haben. Die Maasse sind verschieden und die Buchstabenreste am oberen
Rande des Steines in München stimmen mit den am unteren Rande des Steines
in Smyrna weggebrochenen Enden der Buchstaben TEIXoYS nicht zusammen.