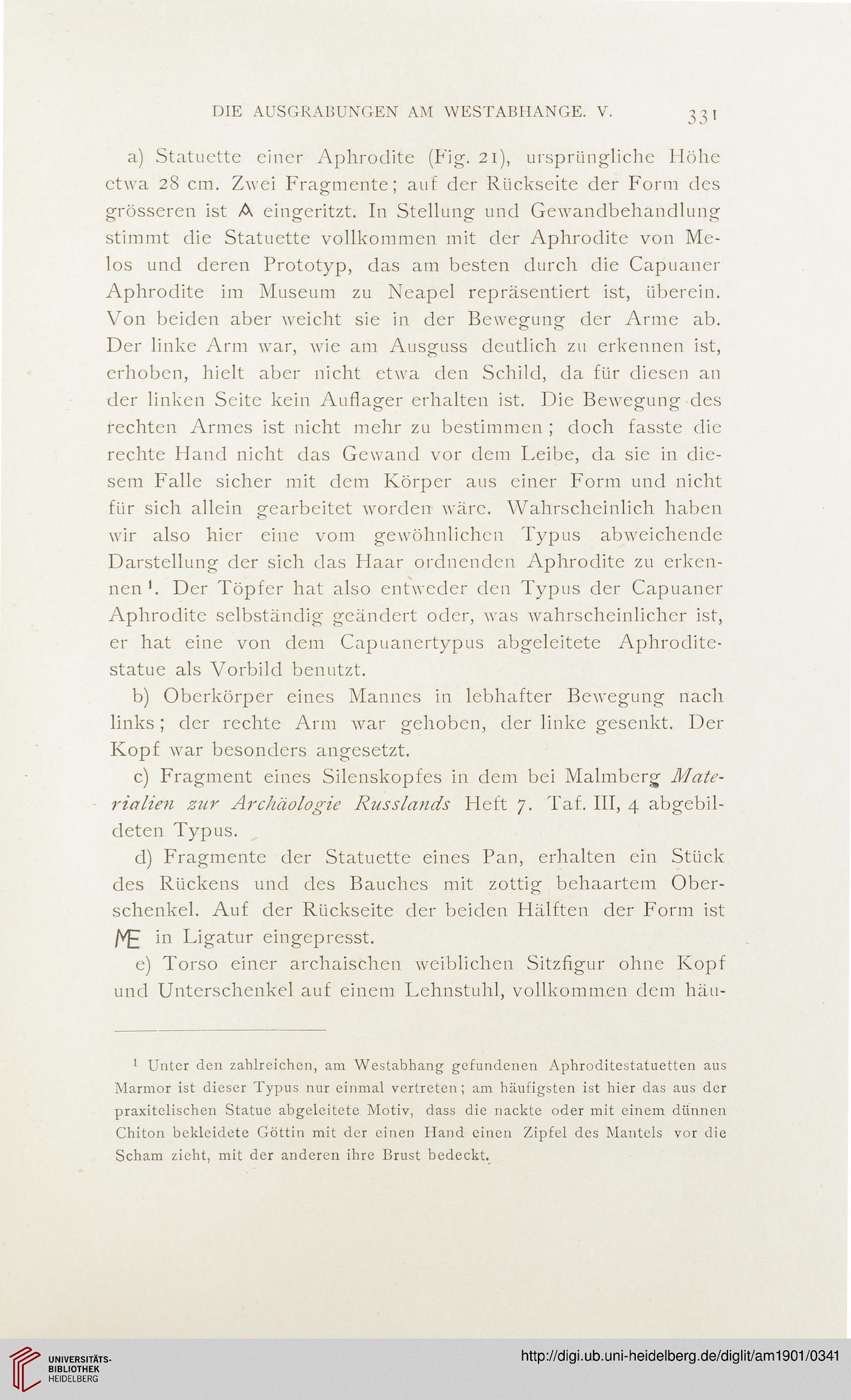DIE AUSGRABUNGEN AM WESTABHANGE. V.
33'
a) Statuette einer Aphrodite (Fig. 21), ursprüngliche Höhe
etwa 28 cm. Zwei Fragmente; auf der Rückseite der Form des
grösseren ist A eingeritzt. In Stellung und Gewandbehandlung
stimmt die Statuette vollkommen mit der Aphrodite von Me-
los und deren Prototyp, das am besten durch die Capuaner
Aphrodite im Museum zu Neapel repräsentiert ist, überein.
Von beiden aber weicht sie in der Bewegung der Arme ab.
Der linke Arm w7ar, wie am Ausguss deutlich zu erkennen ist,
erhoben, hielt aber nicht etwa den Schild, da für diesen an
der linken Seite kein Auflager erhalten ist. Die Bewegung des
rechten Armes ist nicht mehr zu bestimmen ; doch fasste die
rechte Hand nicht das Gewand vor dem Leibe, da sie in die-
sem Falle sicher mit dem Körper aus einer Form und nicht
für sich allein gearbeitet worden wäre. Wahrscheinlich haben
wir also hier eine vom gewöhnlichen Typus abweichende
Darstellung der sich das Haar ordnenden Aphrodite zu erken-
nen1. Der Töpfer hat also entweder den Typus der Capuaner
Aphrodite selbständig geändert oder, was wahrscheinlicher ist,
er hat eine von dem Capuanertypus abgeleitete Aphrodite-
statue als Vorbild benutzt.
b) Oberkörper eines Mannes in lebhafter Bewegung nach
links ; der rechte Arm war gehoben, der linke gesenkt. Der
Kopf war besonders angesetzt.
c) Fragment eines Silenskopfes in dem bei Malmberg Mate-
rialien zur Archäologie Russlands Heft 7. Taf. III, 4 abgebil-
deten Typus.
d) Fragmente der Statuette eines Pan, erhalten ein Stück
des Rückens und des Bauches mit zottig behaartem Ober-
schenkel. Auf der Rückseite der beiden Hälften der Form ist
ΜΞ in Ligatur eingepresst.
e) Torso einer archaischen weiblichen Sitzfigur ohne Kopf
und Unterschenkel auf einem Lehnstuhl, vollkommen dem häu-
1 Unter den zahlreichen, am Westabhang gefundenen Aphroditestatuetten aus
Marmor ist dieser Typus nur einmal vertreten; am häufigsten ist hier das aus der
praxitelischen Statue abgeleitete Motiv, dass die nackte oder mit einem dünnen
Chiton bekleidete Göttin mit der einen Hand einen Zipfel des Mantels vor die
Scham zieht, mit der anderen ihre Brust bedeckt.
33'
a) Statuette einer Aphrodite (Fig. 21), ursprüngliche Höhe
etwa 28 cm. Zwei Fragmente; auf der Rückseite der Form des
grösseren ist A eingeritzt. In Stellung und Gewandbehandlung
stimmt die Statuette vollkommen mit der Aphrodite von Me-
los und deren Prototyp, das am besten durch die Capuaner
Aphrodite im Museum zu Neapel repräsentiert ist, überein.
Von beiden aber weicht sie in der Bewegung der Arme ab.
Der linke Arm w7ar, wie am Ausguss deutlich zu erkennen ist,
erhoben, hielt aber nicht etwa den Schild, da für diesen an
der linken Seite kein Auflager erhalten ist. Die Bewegung des
rechten Armes ist nicht mehr zu bestimmen ; doch fasste die
rechte Hand nicht das Gewand vor dem Leibe, da sie in die-
sem Falle sicher mit dem Körper aus einer Form und nicht
für sich allein gearbeitet worden wäre. Wahrscheinlich haben
wir also hier eine vom gewöhnlichen Typus abweichende
Darstellung der sich das Haar ordnenden Aphrodite zu erken-
nen1. Der Töpfer hat also entweder den Typus der Capuaner
Aphrodite selbständig geändert oder, was wahrscheinlicher ist,
er hat eine von dem Capuanertypus abgeleitete Aphrodite-
statue als Vorbild benutzt.
b) Oberkörper eines Mannes in lebhafter Bewegung nach
links ; der rechte Arm war gehoben, der linke gesenkt. Der
Kopf war besonders angesetzt.
c) Fragment eines Silenskopfes in dem bei Malmberg Mate-
rialien zur Archäologie Russlands Heft 7. Taf. III, 4 abgebil-
deten Typus.
d) Fragmente der Statuette eines Pan, erhalten ein Stück
des Rückens und des Bauches mit zottig behaartem Ober-
schenkel. Auf der Rückseite der beiden Hälften der Form ist
ΜΞ in Ligatur eingepresst.
e) Torso einer archaischen weiblichen Sitzfigur ohne Kopf
und Unterschenkel auf einem Lehnstuhl, vollkommen dem häu-
1 Unter den zahlreichen, am Westabhang gefundenen Aphroditestatuetten aus
Marmor ist dieser Typus nur einmal vertreten; am häufigsten ist hier das aus der
praxitelischen Statue abgeleitete Motiv, dass die nackte oder mit einem dünnen
Chiton bekleidete Göttin mit der einen Hand einen Zipfel des Mantels vor die
Scham zieht, mit der anderen ihre Brust bedeckt.