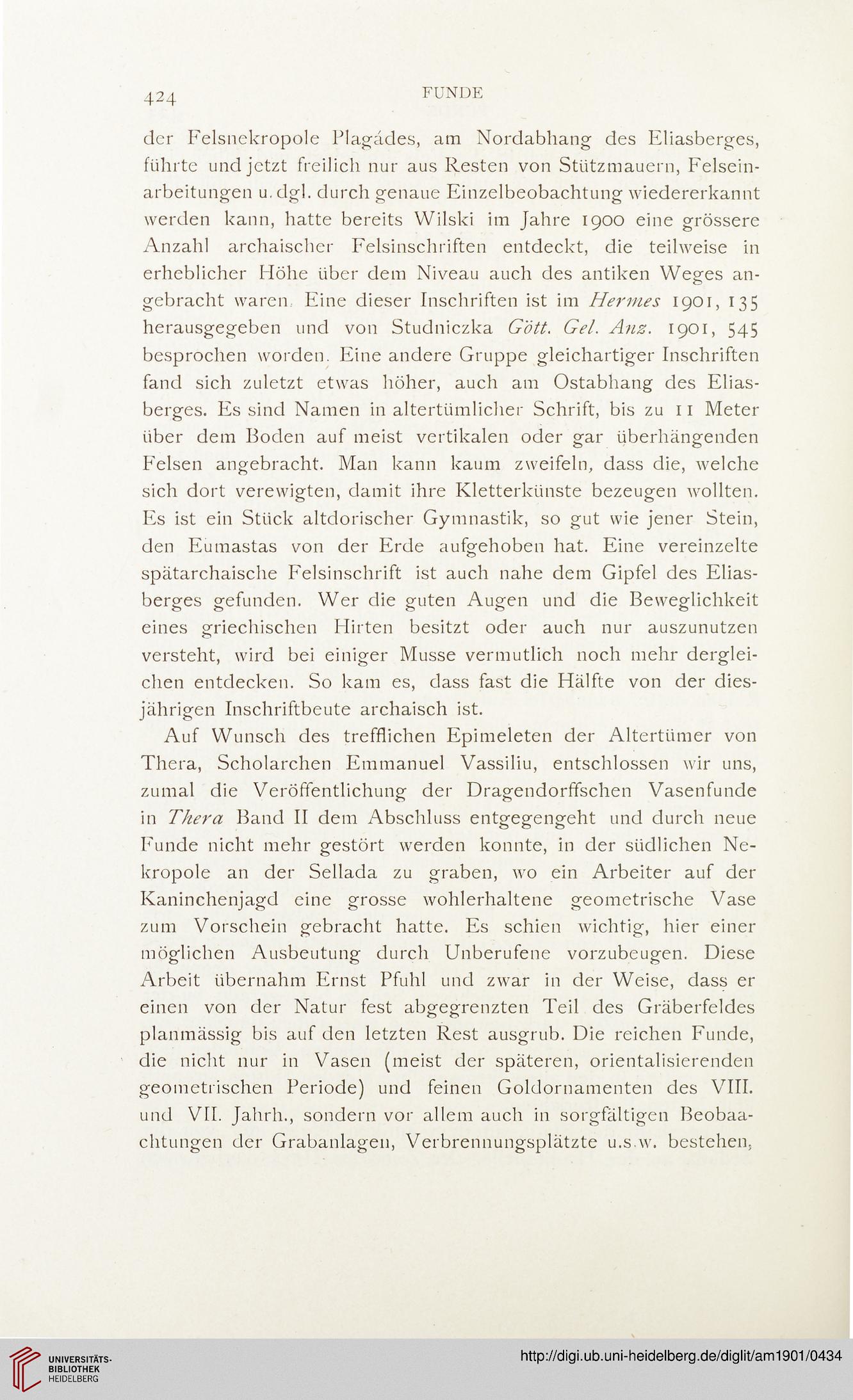424
FUNDE
der Felsnekropole Plagädes, am Nordabhang des Eliasberges,
führte und jetzt freilich nur aus Resten von Stützmauern, Felsein-
arbeitungen u.dgl. durch genaue Einzelbeobachtung wiedererkannt
werden kann, hatte bereits Wilski im Jahre 1900 eine grössere
Anzahl archaischer Felsinschriften entdeckt, die teilweise in
erheblicher Höhe über dem Niveau auch des antiken Weges an-
gebracht waren Eine dieser Inschriften ist im Hermes 1901, 135
herausgegeben und von Studniczka Gott. Gel. Auz. 1901, 545
besprochen worden. Eine andere Gruppe gleichartiger Inschriften
fand sich zuletzt etwas höher, auch am Ostabhang des Elias-
berges. Es sind Namen in altertümlicher Schrift, bis zu 11 Meter
über dem Boden auf meist vertikalen oder gar überhängenden
Felsen angebracht. Man kann kaum zweifeln, dass die, welche
sich dort verewigten, damit ihre Kletterkünste bezeugen wollten.
Es ist ein Stück altdorischer Gymnastik, so gut wie jener Stein,
den Eumastas von der Erde aufgehoben hat. Eine vereinzelte
spätarchaische Felsinschrift ist auch nahe dem Gipfel des Elias-
berges gefunden. Wer die guten Augen und die Beweglichkeit
eines griechischen Hirten besitzt oder auch nur auszunutzen
versteht, wird bei einiger Müsse vermutlich noch mehr derglei-
chen entdecken. So kam es, dass fast die Hälfte von der dies-
jährigen Inschriftbeute archaisch ist.
Auf Wunsch des trefflichen Epimeleten der Altertümer von
Thera, Scholarchen Emmanuel Vassiliu, entschlossen wir uns,
zumal die Veröffentlichung der Dragendorfifschen Vasenfunde
in Thera Band II dem Abschluss entgegengeht und durch neue
Bunde nicht mehr gestört werden konnte, in der südlichen Ne-
kropole an der Sellada zu graben, wo ein Arbeiter auf der
Kaninchenjagd eine grosse wohlerhaltene geometrische Vase
zum Vorschein gebracht hatte. Es schien wichtig, hier einer
möglichen Ausbeutung durch Unberufene vorzubeugen. Diese
Arbeit übernahm Ernst Pfuhl und zwar in der Weise, dass er
einen von der Natur fest abgegrenzten Teil des Gräberfeldes
plamnässig bis auf den letzten Rest ausgrub. Die reichen Funde,
die nicht nur in Vasen (meist der späteren, orientalisierenden
geometrischen Periode) und feinen Goldornamenten des VIII.
und VII. Jahrh., sondern vor allem auch in sorgfältigen Beobaa-
chtungen der Grabanlagen, Verbrennungsplätzte u.s.w. bestehen,
FUNDE
der Felsnekropole Plagädes, am Nordabhang des Eliasberges,
führte und jetzt freilich nur aus Resten von Stützmauern, Felsein-
arbeitungen u.dgl. durch genaue Einzelbeobachtung wiedererkannt
werden kann, hatte bereits Wilski im Jahre 1900 eine grössere
Anzahl archaischer Felsinschriften entdeckt, die teilweise in
erheblicher Höhe über dem Niveau auch des antiken Weges an-
gebracht waren Eine dieser Inschriften ist im Hermes 1901, 135
herausgegeben und von Studniczka Gott. Gel. Auz. 1901, 545
besprochen worden. Eine andere Gruppe gleichartiger Inschriften
fand sich zuletzt etwas höher, auch am Ostabhang des Elias-
berges. Es sind Namen in altertümlicher Schrift, bis zu 11 Meter
über dem Boden auf meist vertikalen oder gar überhängenden
Felsen angebracht. Man kann kaum zweifeln, dass die, welche
sich dort verewigten, damit ihre Kletterkünste bezeugen wollten.
Es ist ein Stück altdorischer Gymnastik, so gut wie jener Stein,
den Eumastas von der Erde aufgehoben hat. Eine vereinzelte
spätarchaische Felsinschrift ist auch nahe dem Gipfel des Elias-
berges gefunden. Wer die guten Augen und die Beweglichkeit
eines griechischen Hirten besitzt oder auch nur auszunutzen
versteht, wird bei einiger Müsse vermutlich noch mehr derglei-
chen entdecken. So kam es, dass fast die Hälfte von der dies-
jährigen Inschriftbeute archaisch ist.
Auf Wunsch des trefflichen Epimeleten der Altertümer von
Thera, Scholarchen Emmanuel Vassiliu, entschlossen wir uns,
zumal die Veröffentlichung der Dragendorfifschen Vasenfunde
in Thera Band II dem Abschluss entgegengeht und durch neue
Bunde nicht mehr gestört werden konnte, in der südlichen Ne-
kropole an der Sellada zu graben, wo ein Arbeiter auf der
Kaninchenjagd eine grosse wohlerhaltene geometrische Vase
zum Vorschein gebracht hatte. Es schien wichtig, hier einer
möglichen Ausbeutung durch Unberufene vorzubeugen. Diese
Arbeit übernahm Ernst Pfuhl und zwar in der Weise, dass er
einen von der Natur fest abgegrenzten Teil des Gräberfeldes
plamnässig bis auf den letzten Rest ausgrub. Die reichen Funde,
die nicht nur in Vasen (meist der späteren, orientalisierenden
geometrischen Periode) und feinen Goldornamenten des VIII.
und VII. Jahrh., sondern vor allem auch in sorgfältigen Beobaa-
chtungen der Grabanlagen, Verbrennungsplätzte u.s.w. bestehen,