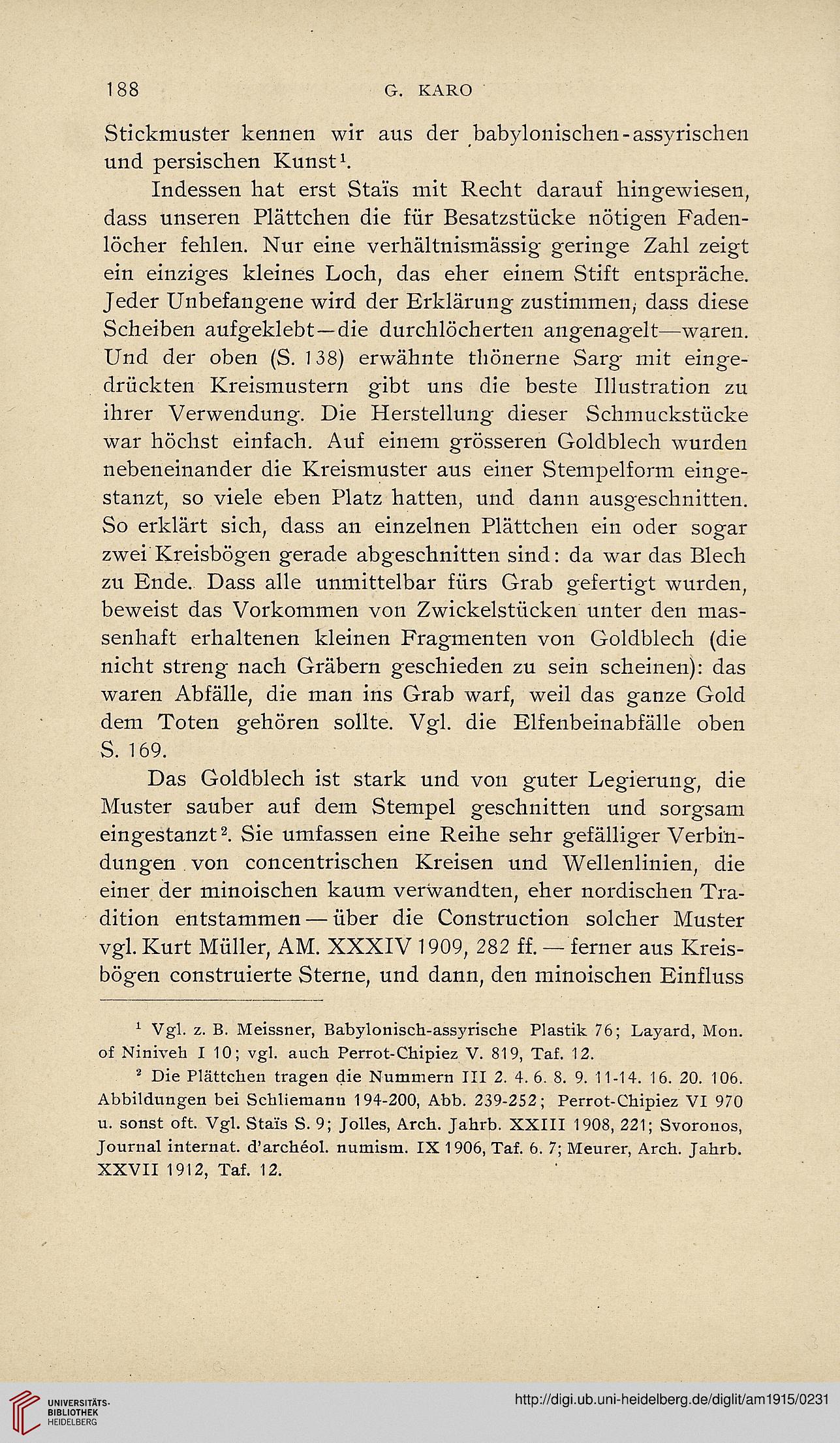188
G. KARO
Stickmuster kennen wir aus der babylonischen-assyrischen
und persischen Kunst1.
Indessen hat erst Sta'is mit Recht darauf hingewiesen,
dass unseren Plättchen die für Besatzstücke nötigen Faden-
löcher fehlen. Nur eine verhältnismässig geringe Zahl zeigt
ein einziges kleines Loch, das eher einem Stift entspräche.
Jeder Unbefangene wird der Erklärung zustimmen, dass diese
Scheiben aufgeklebt —die durchlöcherten angenagelt—waren.
Und der oben (S. 138) erwähnte thönerne Sarg' mit einge-
drückten Kreismustern gibt uns die beste Illustration zu
ihrer Verwendung. Die Herstellung dieser Schmuckstücke
war höchst einfach. Auf einem grösseren Goldblech wurden
nebeneinander die Kreismuster aus einer Stempelform einge-
stanzt, so viele eben Platz hatten, und dann ausgeschnitten.
So erklärt sich, dass an einzelnen Plättchen ein oder sogar
zwei Kreisbögen gerade abgeschnitten sind: da war das Blech
zu Ende. Dass alle unmittelbar fürs Grab gefertigt wurden,
beweist das Vorkommen von Zwickelstücken unter den mas-
senhaft erhaltenen kleinen Fragmenten von Goldblech (die
nicht streng nach Gräbern geschieden zu sein scheinen): das
waren Abfälle, die man ins Grab warf, weil das ganze Gold
dem Toten gehören sollte. Vgl. die Elfenbeinabfälle oben
S. 169.
Das Goldblech ist stark und von guter Legierung, die
Muster sauber auf dem Stempel geschnitten und sorgsam
eingestanzt2. Sie umfassen eine Reihe sehr gefälliger Verbin-
dungen von concentrischen Kreisen und Wellenlinien, die
einer der minoischen kaum verwandten, eher nordischen Tra-
dition entstammen — über die Construction solcher Muster
vgl. Kurt Müller, AM. XXXIV 1909, 282 ff. — ferner aus Kreis-
bögen construierte Sterne, und dann, den minoischen Einfluss
1 Vgl. z. B. Meissner, Babylonisch-assyrische Plastik 76; Layard, Mon.
of Niniveh 110; vgl. auch Perrot-Chipiez V. 819, Taf. 12.
2 Die Plättchen tragen die Nummern III 2. 4. 6. 8. 9. 11-14. 16. 20. 106.
Abbildungen bei Schliemann 194-200, Abb. 239-252; Perrot-Chipiez VI 970
u. sonst oft. Vgl. Stals S. 9; Jolles, Arch. Jahrb. XXIII 1908, 221; Svoronos,
Journal internat. d’archeol. numism. IX 1906, Taf. 6. 7; Meurer, Arch. Jahrb.
XXVII 1912, Taf. 12.
G. KARO
Stickmuster kennen wir aus der babylonischen-assyrischen
und persischen Kunst1.
Indessen hat erst Sta'is mit Recht darauf hingewiesen,
dass unseren Plättchen die für Besatzstücke nötigen Faden-
löcher fehlen. Nur eine verhältnismässig geringe Zahl zeigt
ein einziges kleines Loch, das eher einem Stift entspräche.
Jeder Unbefangene wird der Erklärung zustimmen, dass diese
Scheiben aufgeklebt —die durchlöcherten angenagelt—waren.
Und der oben (S. 138) erwähnte thönerne Sarg' mit einge-
drückten Kreismustern gibt uns die beste Illustration zu
ihrer Verwendung. Die Herstellung dieser Schmuckstücke
war höchst einfach. Auf einem grösseren Goldblech wurden
nebeneinander die Kreismuster aus einer Stempelform einge-
stanzt, so viele eben Platz hatten, und dann ausgeschnitten.
So erklärt sich, dass an einzelnen Plättchen ein oder sogar
zwei Kreisbögen gerade abgeschnitten sind: da war das Blech
zu Ende. Dass alle unmittelbar fürs Grab gefertigt wurden,
beweist das Vorkommen von Zwickelstücken unter den mas-
senhaft erhaltenen kleinen Fragmenten von Goldblech (die
nicht streng nach Gräbern geschieden zu sein scheinen): das
waren Abfälle, die man ins Grab warf, weil das ganze Gold
dem Toten gehören sollte. Vgl. die Elfenbeinabfälle oben
S. 169.
Das Goldblech ist stark und von guter Legierung, die
Muster sauber auf dem Stempel geschnitten und sorgsam
eingestanzt2. Sie umfassen eine Reihe sehr gefälliger Verbin-
dungen von concentrischen Kreisen und Wellenlinien, die
einer der minoischen kaum verwandten, eher nordischen Tra-
dition entstammen — über die Construction solcher Muster
vgl. Kurt Müller, AM. XXXIV 1909, 282 ff. — ferner aus Kreis-
bögen construierte Sterne, und dann, den minoischen Einfluss
1 Vgl. z. B. Meissner, Babylonisch-assyrische Plastik 76; Layard, Mon.
of Niniveh 110; vgl. auch Perrot-Chipiez V. 819, Taf. 12.
2 Die Plättchen tragen die Nummern III 2. 4. 6. 8. 9. 11-14. 16. 20. 106.
Abbildungen bei Schliemann 194-200, Abb. 239-252; Perrot-Chipiez VI 970
u. sonst oft. Vgl. Stals S. 9; Jolles, Arch. Jahrb. XXIII 1908, 221; Svoronos,
Journal internat. d’archeol. numism. IX 1906, Taf. 6. 7; Meurer, Arch. Jahrb.
XXVII 1912, Taf. 12.