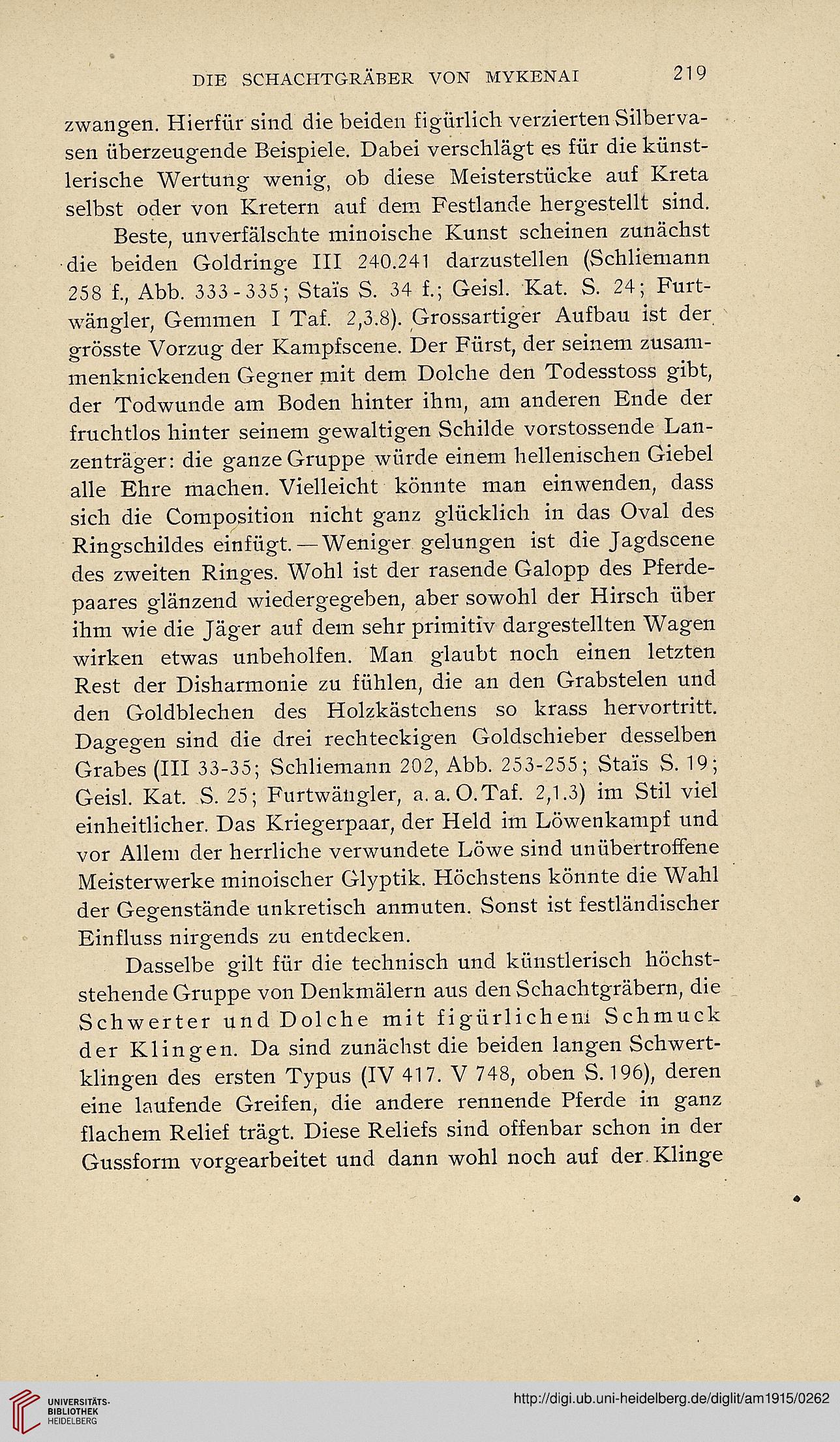DIE SCHACHTGRÄBER VON MYKENAI
219
zwangen. Hierfür sind die beiden figürlich verzierten Silberva-
sen überzeugende Beispiele. Dabei verschlägt es für die künst-
lerische Wertung wenig, ob diese Meisterstücke auf Kreta
selbst oder von Kretern auf dem Festlande hergestellt sind.
Beste, unverfälschte minoische Kunst scheinen zunächst
die beiden Goldringe III 240.241 darzustellen (Schliemann
258 f., Abb. 333 - 335; Stals S. 34 f.; Geisl. Kat. S. 24; Furt-
wängler, Gemmen I Taf. 2,3.8). Grossartiger Aufbau ist der
grösste Vorzug der Kampfscene. Der Fürst, der seinem zusam-
menknickenden Gegner mit dem Dolche den Todesstoss gibt,
der Todwunde am Boden hinter ihm, am anderen Ende der
fruchtlos hinter seinem gewaltigen Schilde vorstossende Lan-
zenträger: die ganze Gruppe würde einem hellenischen Giebel
alle Ehre machen. Vielleicht könnte man einwenden, dass
sich die Composition nicht ganz glücklich in das Oval des
Ringschildes einfügt.—Weniger gelungen ist die Jagdscene
des zweiten Ringes. Wohl ist der rasende Galopp des Pferde-
paares glänzend wiedergegeben, aber sowohl der Hirsch über
ihm wie die Jäger auf dem sehr primitiv dargestellten Wagen
wirken etwas unbeholfen. Man glaubt noch einen letzten
Rest der Disharmonie zu fühlen, die an den Grabstelen und
den Goldblechen des Holzkästchens so krass hervortritt.
Dagegen sind die drei rechteckigen Goldschieber desselben
Grabes (III 33-35; Schliemann 202, Abb. 253-255; Stai's S. 19;
Geisl. Kat. S. 25; Furtwängler, a. a. O.Taf. 2,1.3) im Stil viel
einheitlicher. Das Kriegerpaar, der Held im Löwenkampf und
vor Allem der herrliche verwundete Löwe sind unübertroffene
Meisterwerke minoischer Glyptik. Höchstens könnte die Wahl
der Gegenstände unkretisch anmuten. Sonst ist festländischer
Einfluss nirgends zu entdecken.
Dasselbe gilt für die technisch und künstlerisch höchst-
stehende Gruppe von Denkmälern aus den Schachtgräbern, die
Schwerter und Dolche mit figürlichem Schmuck
der Klingen. Da sind zunächst die beiden langen Schwert-
klingen des ersten Typus (IV 417. V 748, oben S. 196), deren
eine laufende Greifen, die andere rennende Pferde in ganz
flachem Relief trägt. Diese Reliefs sind offenbar schon in der
Gussform vorgearbeitet und dann wohl noch auf der Klinge
219
zwangen. Hierfür sind die beiden figürlich verzierten Silberva-
sen überzeugende Beispiele. Dabei verschlägt es für die künst-
lerische Wertung wenig, ob diese Meisterstücke auf Kreta
selbst oder von Kretern auf dem Festlande hergestellt sind.
Beste, unverfälschte minoische Kunst scheinen zunächst
die beiden Goldringe III 240.241 darzustellen (Schliemann
258 f., Abb. 333 - 335; Stals S. 34 f.; Geisl. Kat. S. 24; Furt-
wängler, Gemmen I Taf. 2,3.8). Grossartiger Aufbau ist der
grösste Vorzug der Kampfscene. Der Fürst, der seinem zusam-
menknickenden Gegner mit dem Dolche den Todesstoss gibt,
der Todwunde am Boden hinter ihm, am anderen Ende der
fruchtlos hinter seinem gewaltigen Schilde vorstossende Lan-
zenträger: die ganze Gruppe würde einem hellenischen Giebel
alle Ehre machen. Vielleicht könnte man einwenden, dass
sich die Composition nicht ganz glücklich in das Oval des
Ringschildes einfügt.—Weniger gelungen ist die Jagdscene
des zweiten Ringes. Wohl ist der rasende Galopp des Pferde-
paares glänzend wiedergegeben, aber sowohl der Hirsch über
ihm wie die Jäger auf dem sehr primitiv dargestellten Wagen
wirken etwas unbeholfen. Man glaubt noch einen letzten
Rest der Disharmonie zu fühlen, die an den Grabstelen und
den Goldblechen des Holzkästchens so krass hervortritt.
Dagegen sind die drei rechteckigen Goldschieber desselben
Grabes (III 33-35; Schliemann 202, Abb. 253-255; Stai's S. 19;
Geisl. Kat. S. 25; Furtwängler, a. a. O.Taf. 2,1.3) im Stil viel
einheitlicher. Das Kriegerpaar, der Held im Löwenkampf und
vor Allem der herrliche verwundete Löwe sind unübertroffene
Meisterwerke minoischer Glyptik. Höchstens könnte die Wahl
der Gegenstände unkretisch anmuten. Sonst ist festländischer
Einfluss nirgends zu entdecken.
Dasselbe gilt für die technisch und künstlerisch höchst-
stehende Gruppe von Denkmälern aus den Schachtgräbern, die
Schwerter und Dolche mit figürlichem Schmuck
der Klingen. Da sind zunächst die beiden langen Schwert-
klingen des ersten Typus (IV 417. V 748, oben S. 196), deren
eine laufende Greifen, die andere rennende Pferde in ganz
flachem Relief trägt. Diese Reliefs sind offenbar schon in der
Gussform vorgearbeitet und dann wohl noch auf der Klinge