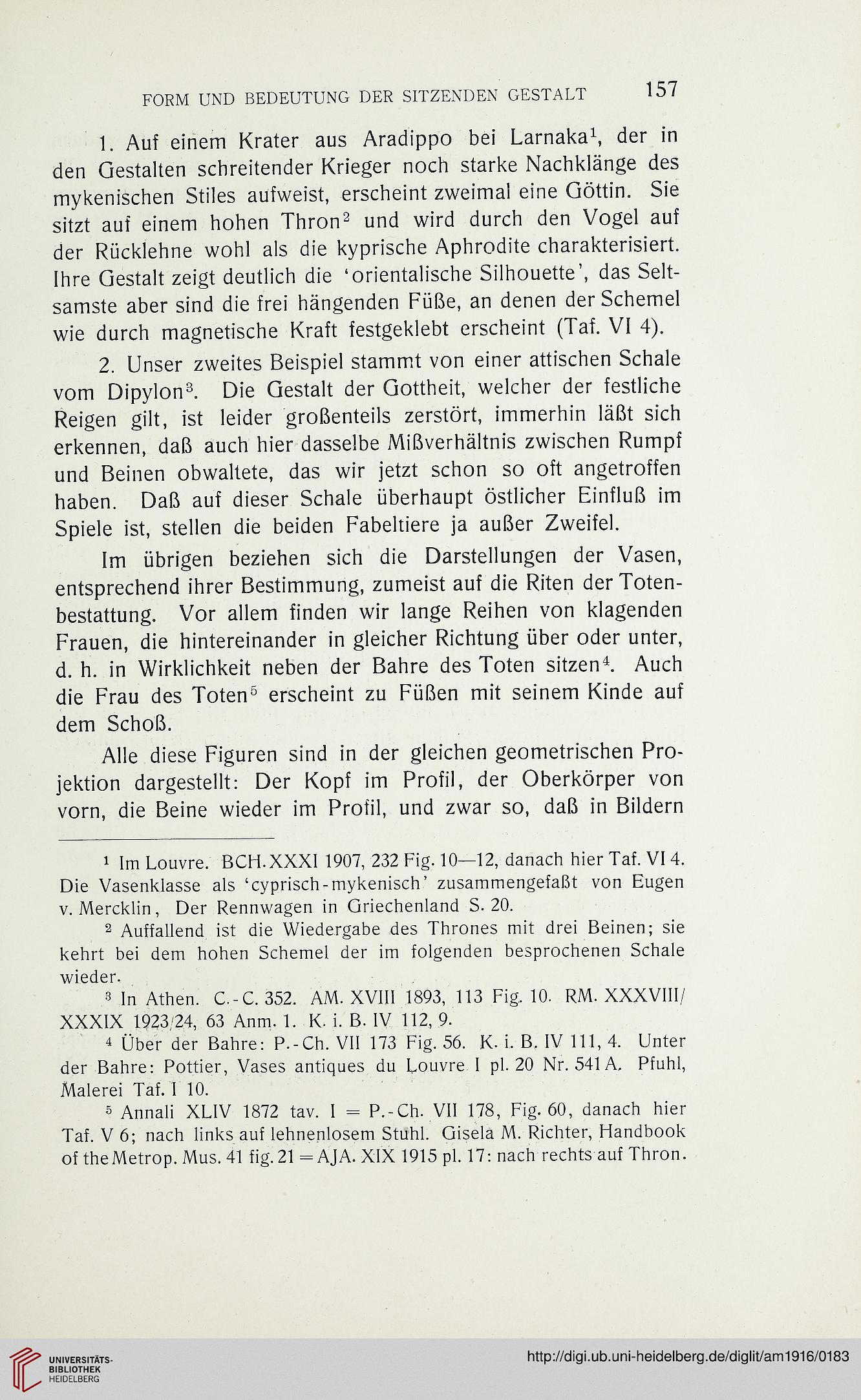FORM UND BEDEUTUNG DER SITZENDEN GESTALT 157
1. Auf einem Krater aus Aradippo bei Larnaka1, der in
den Gestalten schreitender Krieger noch starke Nachklänge des
mykenischen Stiles aufweist, erscheint zweimal eine Göttin. Sie
sitzt auf einem hohen Thron2 und wird durch den Vogel auf
der Rücklehne wohl als die kyprische Aphrodite charakterisiert.
Ihre Gestalt zeigt deutlich die ‘orientalische Silhouette’, das Selt-
samste aber sind die frei hängenden Füße, an denen der Schemel
wie durch magnetische Kraft festgeklebt erscheint (Taf. VI 4).
2. Unser zweites Beispiel stammt von einer attischen Schale
vom Dipylon3. Die Gestalt der Gottheit, welcher der festliche
Reigen gilt, ist leider großenteils zerstört, immerhin läßt sich
erkennen, daß auch hier dasselbe Mißverhältnis zwischen Rumpf
und Beinen obwaltete, das wir jetzt schon so oft angetroffen
haben. Daß auf dieser Schale überhaupt östlicher Einfluß im
Spiele ist, stellen die beiden Fabeltiere ja außer Zweifel.
Im übrigen beziehen sich die Darstellungen der Vasen,
entsprechend ihrer Bestimmung, zumeist auf die Riten der Toten-
bestattung. Vor allem finden wir lange Reihen von klagenden
Frauen, die hintereinander in gleicher Richtung über oder unter,
d. h. in Wirklichkeit neben der Bahre des Toten sitzen4 5. Auch
die Frau des Toten6 erscheint zu Füßen mit seinem Kinde auf
dem Schoß.
Alle diese Figuren sind in der gleichen geometrischen Pro-
jektion dargestellt: Der Kopf im Profil, der Oberkörper von
vorn, die Beine wieder im Profil, und zwar so, daß in Bildern
1 Im Louvre. BCH.XXXI 1907, 232 Fig. 10—12, danach hier Taf. VI 4.
Die Vasenklasse als ‘cyprisch-mykenisch’ zusammengefaßt von Eugen
v. Mercklin, Der Rennwagen in Griechenland S. 20.
2 Auffallend ist die Wiedergabe des Thrones mit drei Beinen; sie
kehrt bei dem hohen Schemel der im folgenden besprochenen Schale
wieder.
3 ln Athen. C.-C. 352. AM. XVIII 1893, 113 Fig. 10. RM. XXXVIII/
XXXIX 1923 24, 63 Anm. 1. K. i. B. IV 112, 9.
4 Über der Bahre: P.-Ch. VII 173 Fig. 56. K- i. B. IV 111, 4. Unter
der Bahre: Pottier, Vases antiques du Louvre I pl. 20 Nr. 541 A, Pfuhl,
Malerei Taf. I 10.
5 Annali XLIV 1872 tav. 1 = P.-Ch. VII 178, Fig. 60, danach hier
Taf. V 6; nach links auf lehnenlosem Stuhl. Gisela M. Richter, Handbook
of theMetrop. Mus. 41 fig. 21 = AJA. XIX 1915 pl. 17: nach rechts auf Thron.
1. Auf einem Krater aus Aradippo bei Larnaka1, der in
den Gestalten schreitender Krieger noch starke Nachklänge des
mykenischen Stiles aufweist, erscheint zweimal eine Göttin. Sie
sitzt auf einem hohen Thron2 und wird durch den Vogel auf
der Rücklehne wohl als die kyprische Aphrodite charakterisiert.
Ihre Gestalt zeigt deutlich die ‘orientalische Silhouette’, das Selt-
samste aber sind die frei hängenden Füße, an denen der Schemel
wie durch magnetische Kraft festgeklebt erscheint (Taf. VI 4).
2. Unser zweites Beispiel stammt von einer attischen Schale
vom Dipylon3. Die Gestalt der Gottheit, welcher der festliche
Reigen gilt, ist leider großenteils zerstört, immerhin läßt sich
erkennen, daß auch hier dasselbe Mißverhältnis zwischen Rumpf
und Beinen obwaltete, das wir jetzt schon so oft angetroffen
haben. Daß auf dieser Schale überhaupt östlicher Einfluß im
Spiele ist, stellen die beiden Fabeltiere ja außer Zweifel.
Im übrigen beziehen sich die Darstellungen der Vasen,
entsprechend ihrer Bestimmung, zumeist auf die Riten der Toten-
bestattung. Vor allem finden wir lange Reihen von klagenden
Frauen, die hintereinander in gleicher Richtung über oder unter,
d. h. in Wirklichkeit neben der Bahre des Toten sitzen4 5. Auch
die Frau des Toten6 erscheint zu Füßen mit seinem Kinde auf
dem Schoß.
Alle diese Figuren sind in der gleichen geometrischen Pro-
jektion dargestellt: Der Kopf im Profil, der Oberkörper von
vorn, die Beine wieder im Profil, und zwar so, daß in Bildern
1 Im Louvre. BCH.XXXI 1907, 232 Fig. 10—12, danach hier Taf. VI 4.
Die Vasenklasse als ‘cyprisch-mykenisch’ zusammengefaßt von Eugen
v. Mercklin, Der Rennwagen in Griechenland S. 20.
2 Auffallend ist die Wiedergabe des Thrones mit drei Beinen; sie
kehrt bei dem hohen Schemel der im folgenden besprochenen Schale
wieder.
3 ln Athen. C.-C. 352. AM. XVIII 1893, 113 Fig. 10. RM. XXXVIII/
XXXIX 1923 24, 63 Anm. 1. K. i. B. IV 112, 9.
4 Über der Bahre: P.-Ch. VII 173 Fig. 56. K- i. B. IV 111, 4. Unter
der Bahre: Pottier, Vases antiques du Louvre I pl. 20 Nr. 541 A, Pfuhl,
Malerei Taf. I 10.
5 Annali XLIV 1872 tav. 1 = P.-Ch. VII 178, Fig. 60, danach hier
Taf. V 6; nach links auf lehnenlosem Stuhl. Gisela M. Richter, Handbook
of theMetrop. Mus. 41 fig. 21 = AJA. XIX 1915 pl. 17: nach rechts auf Thron.