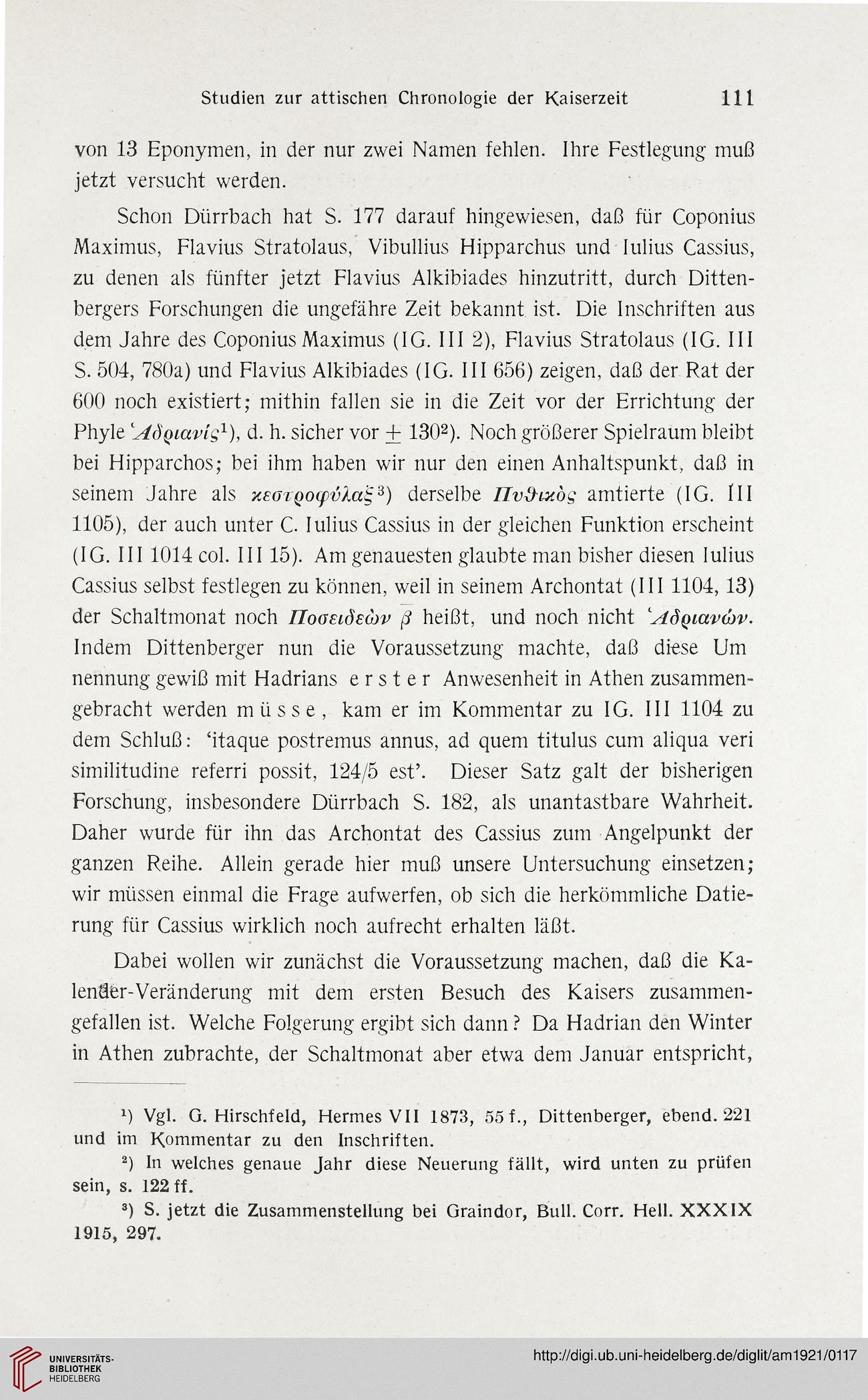Studien zur attischen Chronologie der Kaiserzeit
111
von 13 Eponymen, in der nur zwei Namen fehlen. Ihre Festlegung muß
jetzt versucht werden.
Schon Dürrbach hat S. 177 darauf hingewiesen, daß für Coponius
Maximus, Flavius Stratolaus, Vibullius Hipparchus und Iulius Cassius,
zu denen als fünfter jetzt Flavius Alkibiades hinzutritt, durch Ditten-
bergers Forschungen die ungefähre Zeit bekannt ist. Die Inschriften aus
dem Jahre des Coponius Maximus (IG. III 2), Flavius Stratolaus (IG. III
S. 504, 780a) und Flavius Alkibiades (IG. III 656) zeigen, daß der Rat der
600 noch existiert; mithin fallen sie in die Zeit vor der Errichtung der
Phyle ‘AÖQiavig1), d. h. sicher vor + 1302). Noch größerer Spielraum bleibt
bei Hipparchos; bei ihm haben wir nur den einen Anhaltspunkt, daß in
seinem Jahre als xeoTQoqivkai;3) derselbe IIv&ixös amtierte (IG. III
1105), der auch unter C. Iulius Cassius in der gleichen Funktion erscheint
(IG. III 1014 col. III15). Am genauesten glaubte man bisher diesen Iulius
Cassius selbst festlegen zu können, weil in seinem Archontat (III 1104,13)
der Schaltmonat noch IIooEideöjv ß heißt, und noch nicht ‘AÖQiavtov.
Indem Dittenberger nun die Voraussetzung machte, daß diese Um
nennung gewiß mit Hadrians e r s t e r Anwesenheit in Athen zusammen-
gebracht werden müsse, kam er im Kommentar zu IG. III 1104 zu
dem Schluß: ‘itaque postremus annus, ad quem titulus cum aliqua veri
similitudine referri possit, 124/5 est’. Dieser Satz galt der bisherigen
Forschung, insbesondere Dürrbach S. 182, als unantastbare Wahrheit.
Daher wurde für ihn das Archontat des Cassius zum Angelpunkt der
ganzen Reihe. Allein gerade hier muß unsere Untersuchung einsetzen;
wir müssen einmal die Frage aufwerfen, ob sich die herkömmliche Datie-
rung für Cassius wirklich noch aufrecht erhalten läßt.
Dabei wollen wir zunächst die Voraussetzung machen, daß die Ka-
lenäfer-Veränderung mit dem ersten Besuch des Kaisers zusammen-
gefallen ist. Welche Folgerung ergibt sich dann ? Da Hadrian den Winter
in Athen zubrachte, der Schaltmonat aber etwa dem Januar entspricht,
0 Vgl. G. Hirschfeld, Hermes VII 1873, 55 f., Dittenberger, ebend. 221
und im Kommentar zu den Inschriften.
2) In welches genaue Jahr diese Neuerung fällt, wird unten zu prüfen
sein, s. 122 ff.
3) S. jetzt die Zusammenstellung bei Graindor, Bull. Corr. Hell. XXXIX
1915, 297.
111
von 13 Eponymen, in der nur zwei Namen fehlen. Ihre Festlegung muß
jetzt versucht werden.
Schon Dürrbach hat S. 177 darauf hingewiesen, daß für Coponius
Maximus, Flavius Stratolaus, Vibullius Hipparchus und Iulius Cassius,
zu denen als fünfter jetzt Flavius Alkibiades hinzutritt, durch Ditten-
bergers Forschungen die ungefähre Zeit bekannt ist. Die Inschriften aus
dem Jahre des Coponius Maximus (IG. III 2), Flavius Stratolaus (IG. III
S. 504, 780a) und Flavius Alkibiades (IG. III 656) zeigen, daß der Rat der
600 noch existiert; mithin fallen sie in die Zeit vor der Errichtung der
Phyle ‘AÖQiavig1), d. h. sicher vor + 1302). Noch größerer Spielraum bleibt
bei Hipparchos; bei ihm haben wir nur den einen Anhaltspunkt, daß in
seinem Jahre als xeoTQoqivkai;3) derselbe IIv&ixös amtierte (IG. III
1105), der auch unter C. Iulius Cassius in der gleichen Funktion erscheint
(IG. III 1014 col. III15). Am genauesten glaubte man bisher diesen Iulius
Cassius selbst festlegen zu können, weil in seinem Archontat (III 1104,13)
der Schaltmonat noch IIooEideöjv ß heißt, und noch nicht ‘AÖQiavtov.
Indem Dittenberger nun die Voraussetzung machte, daß diese Um
nennung gewiß mit Hadrians e r s t e r Anwesenheit in Athen zusammen-
gebracht werden müsse, kam er im Kommentar zu IG. III 1104 zu
dem Schluß: ‘itaque postremus annus, ad quem titulus cum aliqua veri
similitudine referri possit, 124/5 est’. Dieser Satz galt der bisherigen
Forschung, insbesondere Dürrbach S. 182, als unantastbare Wahrheit.
Daher wurde für ihn das Archontat des Cassius zum Angelpunkt der
ganzen Reihe. Allein gerade hier muß unsere Untersuchung einsetzen;
wir müssen einmal die Frage aufwerfen, ob sich die herkömmliche Datie-
rung für Cassius wirklich noch aufrecht erhalten läßt.
Dabei wollen wir zunächst die Voraussetzung machen, daß die Ka-
lenäfer-Veränderung mit dem ersten Besuch des Kaisers zusammen-
gefallen ist. Welche Folgerung ergibt sich dann ? Da Hadrian den Winter
in Athen zubrachte, der Schaltmonat aber etwa dem Januar entspricht,
0 Vgl. G. Hirschfeld, Hermes VII 1873, 55 f., Dittenberger, ebend. 221
und im Kommentar zu den Inschriften.
2) In welches genaue Jahr diese Neuerung fällt, wird unten zu prüfen
sein, s. 122 ff.
3) S. jetzt die Zusammenstellung bei Graindor, Bull. Corr. Hell. XXXIX
1915, 297.