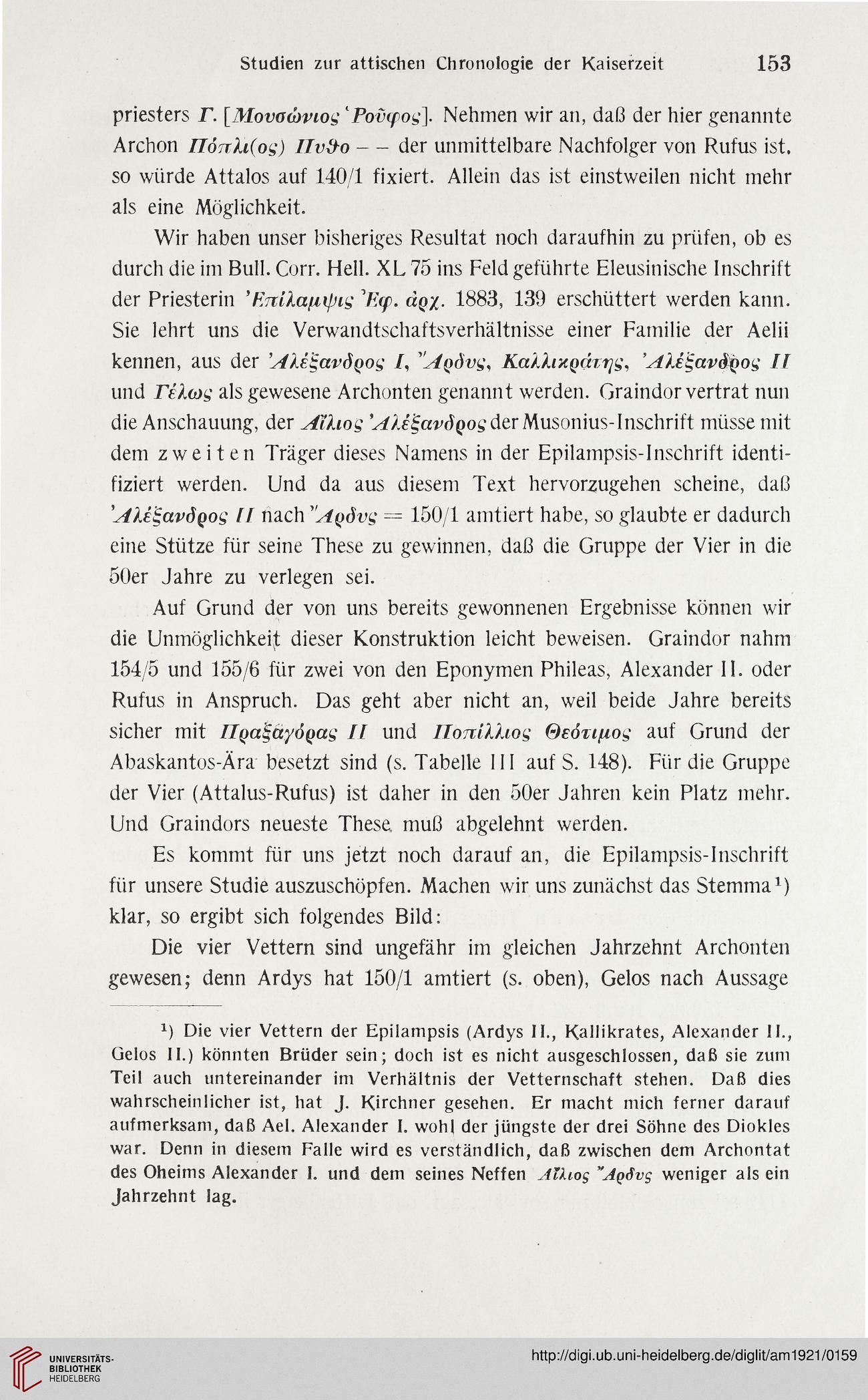Studien zur attischen Chronologie der Kaiserzeit
153
priesters r. [Movowviog lPovq>og\ Nehmen wir an, daß der hier genannte
Archon IIÖTrltfog) IIv&o — der unmittelbare Nachfolger von Rufus ist.
so würde Attalos auf 140/1 fixiert. Allein das ist einstweilen nicht mehr
als eine Möglichkeit.
Wir haben unser bisheriges Resultat noch daraufhin zu priifen, ob es
durch die im Bull. Corr. Hell. XL 75 ins Feldgeführte Eleusinische Inschrift
der Priesterin 'Emlafupig 'E(p. dQ%. 1883, 139 erschüttert werden kann.
Sie lehrt uns die Verwandtschaftsverhältnisse einer Familie der Aelii
kennen, aus der Akei-avÖQos /, 'MQdvg, Ka/.loiQävtjg, ’Ale^avöQos II
und Peloyg als gewesene Archonten genannt werden. Graindor vertrat nun
die Anschauung, der AThog ’AlegavdQosderMusonius-Inschrift müsse mit
dem zweiten Träger dieses Namens in der Epilampsis-Inschrift identi-
fiziert werden. Und da aus diesem Text hervorzugehen scheine, daß
'Ale^avÖQos ll nach "Aqövs = 150/1 amtiert habe, so glaubte er dadurch
eine Stütze für seine These zu gewinnen, daß die Gruppe der Vier in die
50er Jahre zu verlegen sei.
Auf Grund der von uns bereits gewonnenen Ergebnisse können wir
die Unmöglichkeit dieser Konstruktion leicht beweisen. Graindor nahm
154/5 und 155/6 für zwei von den Eponymen Phileas, Alexander II. oder
Rufus in Anspruch. Das geht aber nicht an, weil beide Jahre bereits
sicher mit ÜQa^ayÖQas II und nonilhos Oeötifios auf Grund der
Abaskantos-Ära besetzt sind (s. Tabelle III auf S. 148). Fiir die Gruppe
der Vier (Attalus-Rufus) ist daher in den 50er Jahren kein Platz melir.
Und Graindors neueste These. muß abgelehnt werden.
Es kommt für uns jetzt noch darauf an, die Epilampsis-Inschrift
für unsere Studie auszuschöpfen. Machen wir uns zunächst das Stemma1)
klar, so ergibt sich folgendes Bild:
Die vier Vettern sind ungefähr im gleichen Jahrzehnt Archonten
gewesen; denn Ardys hat 150/1 amtiert (s. oben), Gelos nach Aussage
x) Die vier Vettern der Epilampsis (Ardys II., Kallikrates, Alexander II.,
Gelos II.) könnten Brüder sein; doch ist es nicht ausgeschlossen, daß sie zum
Teil auch untereinander im Verhältnis der Vetternschaft stehen. Daß dies
wahrscheinlicher ist, hat J. Kirchner gesehen. Er macht mich ferner darauf
aufmerksam, daß Ael. Alexander I. wohl der jüngste der drei Söhne des Diokles
war. Denn in diesem Falle wird es verständlich, daß zwischen dem Archontat
des Oheims Alexander I. und dem seines Neffen Mhog "Aqövs weniger als ein
Jahrzehnt Iag.
153
priesters r. [Movowviog lPovq>og\ Nehmen wir an, daß der hier genannte
Archon IIÖTrltfog) IIv&o — der unmittelbare Nachfolger von Rufus ist.
so würde Attalos auf 140/1 fixiert. Allein das ist einstweilen nicht mehr
als eine Möglichkeit.
Wir haben unser bisheriges Resultat noch daraufhin zu priifen, ob es
durch die im Bull. Corr. Hell. XL 75 ins Feldgeführte Eleusinische Inschrift
der Priesterin 'Emlafupig 'E(p. dQ%. 1883, 139 erschüttert werden kann.
Sie lehrt uns die Verwandtschaftsverhältnisse einer Familie der Aelii
kennen, aus der Akei-avÖQos /, 'MQdvg, Ka/.loiQävtjg, ’Ale^avöQos II
und Peloyg als gewesene Archonten genannt werden. Graindor vertrat nun
die Anschauung, der AThog ’AlegavdQosderMusonius-Inschrift müsse mit
dem zweiten Träger dieses Namens in der Epilampsis-Inschrift identi-
fiziert werden. Und da aus diesem Text hervorzugehen scheine, daß
'Ale^avÖQos ll nach "Aqövs = 150/1 amtiert habe, so glaubte er dadurch
eine Stütze für seine These zu gewinnen, daß die Gruppe der Vier in die
50er Jahre zu verlegen sei.
Auf Grund der von uns bereits gewonnenen Ergebnisse können wir
die Unmöglichkeit dieser Konstruktion leicht beweisen. Graindor nahm
154/5 und 155/6 für zwei von den Eponymen Phileas, Alexander II. oder
Rufus in Anspruch. Das geht aber nicht an, weil beide Jahre bereits
sicher mit ÜQa^ayÖQas II und nonilhos Oeötifios auf Grund der
Abaskantos-Ära besetzt sind (s. Tabelle III auf S. 148). Fiir die Gruppe
der Vier (Attalus-Rufus) ist daher in den 50er Jahren kein Platz melir.
Und Graindors neueste These. muß abgelehnt werden.
Es kommt für uns jetzt noch darauf an, die Epilampsis-Inschrift
für unsere Studie auszuschöpfen. Machen wir uns zunächst das Stemma1)
klar, so ergibt sich folgendes Bild:
Die vier Vettern sind ungefähr im gleichen Jahrzehnt Archonten
gewesen; denn Ardys hat 150/1 amtiert (s. oben), Gelos nach Aussage
x) Die vier Vettern der Epilampsis (Ardys II., Kallikrates, Alexander II.,
Gelos II.) könnten Brüder sein; doch ist es nicht ausgeschlossen, daß sie zum
Teil auch untereinander im Verhältnis der Vetternschaft stehen. Daß dies
wahrscheinlicher ist, hat J. Kirchner gesehen. Er macht mich ferner darauf
aufmerksam, daß Ael. Alexander I. wohl der jüngste der drei Söhne des Diokles
war. Denn in diesem Falle wird es verständlich, daß zwischen dem Archontat
des Oheims Alexander I. und dem seines Neffen Mhog "Aqövs weniger als ein
Jahrzehnt Iag.