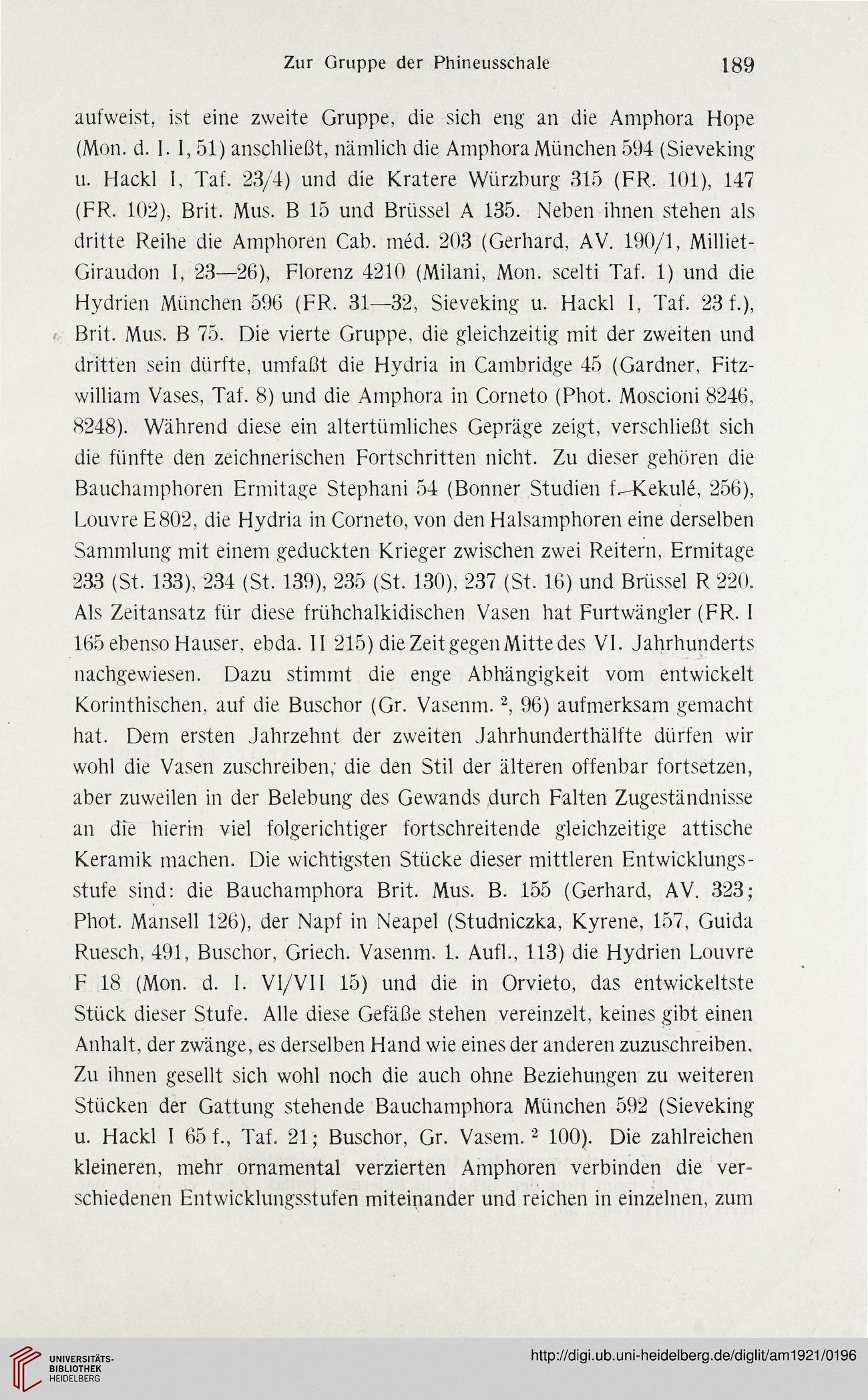Zur Gruppe der Phineusschale
189
aufweist, ist eine zweite Gruppe, die sich eng an die Amphora Hope
(Mon. d. I. I, 51) anschließt, nämlich die AmphoraMünchen 594 (Sieveking
u. Hackl I, Taf. 23/4) und die Kratere Würzburg 315 (FR. 101), 147
(FR. 102), Brit. Mus. B 15 und Briissel A 135. Neben ihnen stehen als
dritte Reihe die Amphoren Cab. med. 203 (Gerhard, AV. 190/1, Milliet-
Giraudon I, 23—26), Florenz 4210 (Milani, Mon. scelti Taf. 1) und die
Hydrien München 596 (FR. 31—32, Sieveking u. Hackl I, Taf. 23 f.),
Brit. Mus. B 75. Die vierte Gruppe, die gleichzeitig mit der zweiten und
dritten sein dürfte, umfaßt die Hydria in Cambridge 45 (Gardner, Fitz-
william Vases, Taf. 8) und die Amphora in Corneto (Phot. Moscioni 8246,
8248). Während diese ein altertiimliches Gepräge zeigt, verschließt sich
die fünfte den zeichnerischen Fortschritten nicht. Zu dieser gehpren die
Bauchamphoren Ermitage Stephani 54 (Bonner Studien f^Kekule, 256),
Louvre E802, die Hydria in Corneto, von den Halsamphoren eine derselben
Sammlung mit einem geduckten Krieger zwischen zwei Reitern, Ermitage
233 (St. 133), 234 (St. 139), 235 (St. 130), 237 (St. 16) und Brüssel R 220.
Als Zeitansatz für diese frühchalkidischen Vasen hat Furtwängler (FR. I
165 ebenso Hauser, ebda. II 215) dieZeitgegenMittedes VI. Jahrhunderts
nachgewiesen. Dazu stimmt die enge Abhängigkeit vom entwickelt
Korinthischen, auf die Buschor (Gr. Vasenm.2, 96) aufmerksam gemacht
hat. Dem ersten Jahrzehnt der zweiten Jahrhunderthälfte dürfen wir
wohl die Vasen zuschreiben; die den Stil der älteren offenbar fortsetzen,
aber zuweilen in der Belebung des Gewands durch Falten Zugeständnisse
an die hierin viel folgerichtiger fortschreitende gleichzeitige attische
Keramik machen. Die wichtigsten Stücke dieser mittleren Entwicklungs-
stufe sind: die Bauchamphora Brit. Mus. B. 155 (Gerhard, AV. 323;
Phot. Mansell 126), der Napf in Neapel (Studniczka, Kyrene, 157, Guida
Ruesch, 491, Buschor, Griech. Vasenm. 1. Aufl., 113) die Hydrien Louvre
F 18 (Mon. d. I. VI/VII 15) und die in Orvieto, das entwickeltste
Stück dieser Stufe. Alle diese Gefäße stehen vereinzelt, keines gibt einen
Anhalt, der zwänge, es derselben Hand wie eines der anderen zuzuschreiben.
Zu ihnen gesellt sich wohl noch die auch ohne Beziehungen zu weiteren
Stiicken der Gattung stehende Bauchamphora München 592 (Sieveking
u. Hackl I 65 f., Taf. 21; Buschor, Gr. Vasem.2 100). Die zahlreichen
kleineren, mehr ornamental verzierten Amphoren verbinden die ver-
schiedenen Entwicklungsstufen miteinander und reichen in einzelnen, zum
189
aufweist, ist eine zweite Gruppe, die sich eng an die Amphora Hope
(Mon. d. I. I, 51) anschließt, nämlich die AmphoraMünchen 594 (Sieveking
u. Hackl I, Taf. 23/4) und die Kratere Würzburg 315 (FR. 101), 147
(FR. 102), Brit. Mus. B 15 und Briissel A 135. Neben ihnen stehen als
dritte Reihe die Amphoren Cab. med. 203 (Gerhard, AV. 190/1, Milliet-
Giraudon I, 23—26), Florenz 4210 (Milani, Mon. scelti Taf. 1) und die
Hydrien München 596 (FR. 31—32, Sieveking u. Hackl I, Taf. 23 f.),
Brit. Mus. B 75. Die vierte Gruppe, die gleichzeitig mit der zweiten und
dritten sein dürfte, umfaßt die Hydria in Cambridge 45 (Gardner, Fitz-
william Vases, Taf. 8) und die Amphora in Corneto (Phot. Moscioni 8246,
8248). Während diese ein altertiimliches Gepräge zeigt, verschließt sich
die fünfte den zeichnerischen Fortschritten nicht. Zu dieser gehpren die
Bauchamphoren Ermitage Stephani 54 (Bonner Studien f^Kekule, 256),
Louvre E802, die Hydria in Corneto, von den Halsamphoren eine derselben
Sammlung mit einem geduckten Krieger zwischen zwei Reitern, Ermitage
233 (St. 133), 234 (St. 139), 235 (St. 130), 237 (St. 16) und Brüssel R 220.
Als Zeitansatz für diese frühchalkidischen Vasen hat Furtwängler (FR. I
165 ebenso Hauser, ebda. II 215) dieZeitgegenMittedes VI. Jahrhunderts
nachgewiesen. Dazu stimmt die enge Abhängigkeit vom entwickelt
Korinthischen, auf die Buschor (Gr. Vasenm.2, 96) aufmerksam gemacht
hat. Dem ersten Jahrzehnt der zweiten Jahrhunderthälfte dürfen wir
wohl die Vasen zuschreiben; die den Stil der älteren offenbar fortsetzen,
aber zuweilen in der Belebung des Gewands durch Falten Zugeständnisse
an die hierin viel folgerichtiger fortschreitende gleichzeitige attische
Keramik machen. Die wichtigsten Stücke dieser mittleren Entwicklungs-
stufe sind: die Bauchamphora Brit. Mus. B. 155 (Gerhard, AV. 323;
Phot. Mansell 126), der Napf in Neapel (Studniczka, Kyrene, 157, Guida
Ruesch, 491, Buschor, Griech. Vasenm. 1. Aufl., 113) die Hydrien Louvre
F 18 (Mon. d. I. VI/VII 15) und die in Orvieto, das entwickeltste
Stück dieser Stufe. Alle diese Gefäße stehen vereinzelt, keines gibt einen
Anhalt, der zwänge, es derselben Hand wie eines der anderen zuzuschreiben.
Zu ihnen gesellt sich wohl noch die auch ohne Beziehungen zu weiteren
Stiicken der Gattung stehende Bauchamphora München 592 (Sieveking
u. Hackl I 65 f., Taf. 21; Buschor, Gr. Vasem.2 100). Die zahlreichen
kleineren, mehr ornamental verzierten Amphoren verbinden die ver-
schiedenen Entwicklungsstufen miteinander und reichen in einzelnen, zum